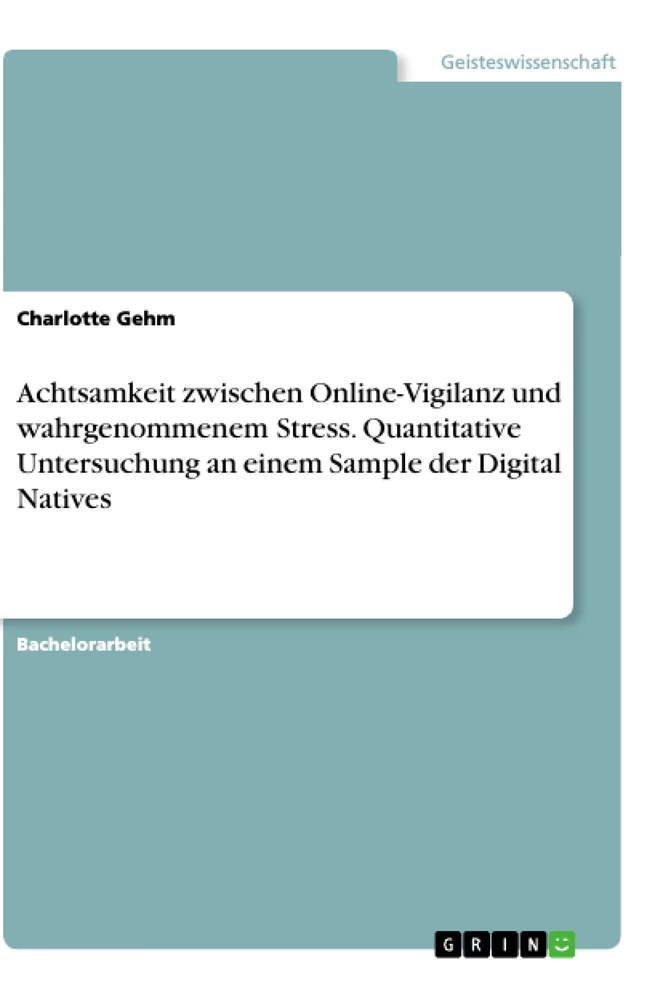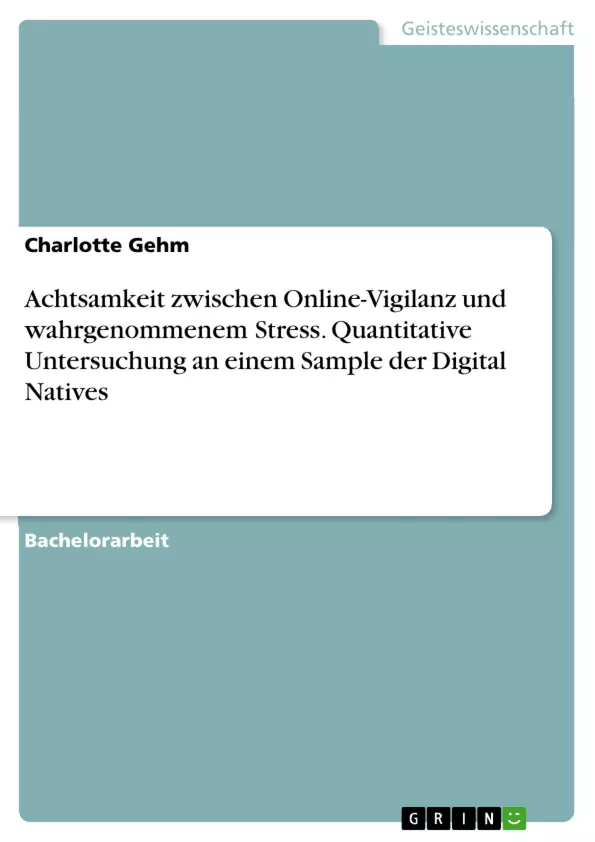Diese Arbeit untersucht die Zusammenhänge zwischen Online-Vigilanz, Achtsamkeit und wahrgenommenem Stress sowie der einzelnen Achtsamkeits- und Online-Vigilanz-Dimensionen untereinander. Ziel der Arbeit ist es zu überprüfen, ob Achtsamkeit als intervenierende Variable zwischen Online-Vigilanz und wahrgenommenem Stress wirkt.
In eine mediale Konversation involviert zu sein oder die Verfügbarkeit für diese sicherzustellen, wird nahezu an jedem Ort und zu jeder Zeit vorausgesetzt. Auch wenn sich Menschen im Gespräch mit einer physisch anwesenden Person befinden, im Straßenverkehr unterwegs sind oder eine Mahlzeit zu sich nehmen, wird die Aufmerksamkeit häufig auf das Smartphone-Display gerichtet. Aufgrund der Allgegenwärtigkeit digitaler Medien denken, fühlen und handeln Menschen in der Erwartung, permanent über das Internet vernetzt zu sein. Das Konzept der Online-Vigilanz beschreibt, wie Mediennutzer ihrer inneren und äußeren Welt gegenüberstehen. Zunehmend mehr Belege deuten darauf hin, dass die dauerhafte Auseinandersetzung mit Medien(inhalten) diverse gesundheitsrelevante Risiken nach sich zieht.
Aufgrund der durch IKT bereitgestellten schnellen und zuverlässigen Belohnungen sowie Formen der Bedürfnisbefriedigung, richten Menschen ihre Kognitionen oftmals habituell auf die Online-Umgebung aus. Aus der Intensivierung und Beschleunigung der Informationsübermittlung ergeben sich sowohl Episoden des Multitaskings als auch verschiedene Formen kognitiver Überlastungen. Diese können in einer Überlastung der Sinne sowie in einer zunehmend fragmentierten und diskontinuierlichen Wahrnehmung der Gegenwart resultieren.
Online-Vigilanz, Mediengewohnheiten, Multitasking und kognitive Überstimulation können sich nachteilig auf das Wohlbefinden der Nutzer auswirken, indem z. B. Stressreaktionen ausgelöst werden. Aus diesem Grund wächst das Interesse an Strategien zur Förderung eines vorteilhaften Medienumgangs sowie zur Stressbewältigung, welche zumeist auf Achtsamkeit beruhen.
Achtsamkeit umfasst in den gängigen Konzeptualisierungen eine Aufmerksamkeitslenkung auf den gegenwärtigen Moment sowie ein offenes und nicht wertendes Bewusstsein für innere und äußere Reize. Ein urteilsfreies und offenes Gewahrsein stellt die Voraussetzung dafür dar, dass nachteilige Mediengewohnheiten und dysfunktionale Copingstrategien von Stress als solche enttarnt und schließlich gezielt eingegrenzt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 THEORETISCHER UND EMPIRISCHER HINTERGRUND
- 2.1 Online-Vigilanz
- 2.1.1 POPC-Forschung
- 2.1.2 Definition von Online-Vigilanz
- 2.1.3 Abgrenzung der Online-Vigilanz von Gewohnheit, Sucht und Multitasking
- 2.1.4 Verstärkungsfaktoren von Online-Vigilanz
- 2.2 Achtsamkeit
- 2.2.1 Definition und Geschichte von Achtsamkeit
- 2.2.2 Achtsamkeitsbasierte Interventionen
- 2.2.3 Auswirkungen von Achtsamkeit
- 2.3 Digitaler Stress
- 2.3.1 Definition und Konzeptualisierung von Stress
- 2.3.2 Entstehung von digitalem Stress
- 2.3.3 Forschungsstand von digitalem Stress
- 2.4 Achtsamkeit und POPC-Verhalten
- 2.4.1 Herausforderungen von POPC-Bedingungen
- 2.4.2 Vorteilhaftes POPC-Verhalten durch Achtsamkeit
- 2.4.3 Forschungsstand von Achtsamkeit und Online-Vigilanz
- 2.5 Überblick über die vorliegende Studie
- 2.6 Fragestellung und Hypothesen
- 2.1 Online-Vigilanz
- 3 METHODE
- 3.1 Stichprobe
- 3.2 Planung und Durchführung der Untersuchung
- 3.3 Fragebogenverfahren
- 4 ERGEBNISSE
- 4.1 Deskriptivstatistische Ergebnisse
- 4.2 Inferenzstatistische Ergebnisse
- 5 DISKUSSION
- 5.1 Implikationen und Bedeutung der Ergebnisse
- 5.2 Einordnung in den aktuellen Forschungsstand
- 5.3 Limitation
- 5.4 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht den Einfluss von Achtsamkeit auf die Beziehung zwischen Online-Vigilanz und wahrgenommenem Stress bei Digital Natives. Ziel ist es, die mediierende Rolle der Achtsamkeit zwischen diesen beiden Konstrukten zu überprüfen. Die Arbeit basiert auf dem transaktionalen Stressmodell von Lazarus und Launier (1981).
- Der Zusammenhang zwischen Online-Vigilanz und wahrgenommenem Stress
- Die Rolle von Achtsamkeit als intervenierende Variable
- Die Auswirkungen verschiedener Achtsamkeitsaspekte auf Online-Vigilanz
- Die Anwendung des transaktionalen Stressmodells auf digitalen Stress
- Implikationen für die Intervention von digitalem Stress
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Arbeit ein, indem es die Relevanz der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Online-Vigilanz, Achtsamkeit und wahrgenommenem Stress im Kontext der Digital Natives begründet. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und formuliert die Forschungsfrage und Hypothesen.
2 Theoretischer und Empirischer Hintergrund: Dieses Kapitel präsentiert die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es definiert und erläutert die Konzepte der Online-Vigilanz, Achtsamkeit und digitalen Stresses, beleuchtet den Forschungsstand zu diesen Themen und beschreibt das transaktionalen Stressmodell von Lazarus und Launier (1981) als theoretische Grundlage. Es werden insbesondere die verschiedenen Facetten und Dimensionen der einzelnen Konstrukte detailliert dargestellt, und der Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und dem Umgang mit den Herausforderungen der permanenten Online-Erreichbarkeit wird diskutiert. Die Kapitel 2.1 bis 2.4 bilden dabei die Grundlage für die Fragestellung und die Hypothesenbildung im abschließenden Kapitel 2.6.
3 Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erläutert die Zusammensetzung der Stichprobe (322 Digital Natives), das verwendete Online-Fragebogenverfahren, sowie den Ablauf der Datenerhebung und -aufbereitung. Es werden die verwendeten Messinstrumente und deren Skalierung beschrieben, sowie die statistischen Verfahren zur Hypothesentestung vorgestellt. Dieses Kapitel legt die methodische Grundlage der empirischen Überprüfung der im Kapitel 2 aufgestellten Hypothesen.
4 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten statistischen Analysen (Regressions- und Korrelationsanalysen). Es werden sowohl deskriptive als auch inferenzstatistische Ergebnisse dargestellt und interpretiert. Die Ergebnisse liefern die empirische Basis für die Diskussion der Hypothesen im folgenden Kapitel.
5 Diskussion: Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Studie im Kontext des aktuellen Forschungsstandes. Es bewertet die Bedeutung der Ergebnisse für die Intervention von digitalem Stress und beleuchtet Limitationen der Studie. Es schließt mit einem Fazit und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Online-Vigilanz, Achtsamkeit, wahrgenommener Stress, Digitaler Stress, Digital Natives, transaktionaler Stress, Mediationsanalyse, Korrelationsanalyse, Regressionsanalyse, Mindfulness, Stressbewältigung, Mediennutzung.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Einfluss von Achtsamkeit auf Online-Vigilanz und wahrgenommenen Stress bei Digital Natives
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Achtsamkeit auf die Beziehung zwischen Online-Vigilanz und wahrgenommenem Stress bei Digital Natives. Das zentrale Forschungsziel ist die Überprüfung der mediierenden Rolle der Achtsamkeit zwischen Online-Vigilanz und Stress. Die Arbeit stützt sich auf das transaktionale Stressmodell von Lazarus und Launier (1981).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den Zusammenhang zwischen Online-Vigilanz und wahrgenommenem Stress, die Rolle der Achtsamkeit als intervenierende Variable, die Auswirkungen verschiedener Achtsamkeitsaspekte auf Online-Vigilanz, die Anwendung des transaktionalen Stressmodells auf digitalen Stress und Implikationen für die Intervention von digitalem Stress.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und formuliert die Forschungsfrage und Hypothesen. Kapitel 2 (Theoretischer und Empirischer Hintergrund) definiert und erläutert die zentralen Konzepte (Online-Vigilanz, Achtsamkeit, digitaler Stress) und den aktuellen Forschungsstand. Kapitel 3 (Methode) beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung (Stichprobe, Fragebogenverfahren, statistische Verfahren). Kapitel 4 (Ergebnisse) präsentiert die Ergebnisse der statistischen Analysen. Kapitel 5 (Diskussion) diskutiert die Ergebnisse, bewertet deren Bedeutung, beleuchtet Limitationen und gibt einen Ausblick.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet ein Online-Fragebogenverfahren mit einer Stichprobe von 322 Digital Natives. Zur Datenanalyse kommen deskriptive und inferenzstatistische Verfahren (Regressions- und Korrelationsanalysen) zum Einsatz. Die verwendeten Messinstrumente und deren Skalierung werden detailliert im Methodenkapitel beschrieben.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der statistischen Analysen (Regressions- und Korrelationsanalysen), sowohl deskriptive als auch inferenzstatistische, werden im Kapitel 4 detailliert dargestellt und interpretiert. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für die Diskussion der Hypothesen im darauffolgenden Kapitel.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse im Kontext des aktuellen Forschungsstandes, bewertet deren Bedeutung für die Intervention von digitalem Stress und beleuchtet Limitationen der Studie. Es schließt mit einem Fazit und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Online-Vigilanz, Achtsamkeit, wahrgenommener Stress, Digitaler Stress, Digital Natives, transaktionaler Stress, Mediationsanalyse, Korrelationsanalyse, Regressionsanalyse, Mindfulness, Stressbewältigung, Mediennutzung.
- Citation du texte
- Charlotte Gehm (Auteur), 2020, Achtsamkeit zwischen Online-Vigilanz und wahrgenommenem Stress. Quantitative Untersuchung an einem Sample der Digital Natives, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/946985