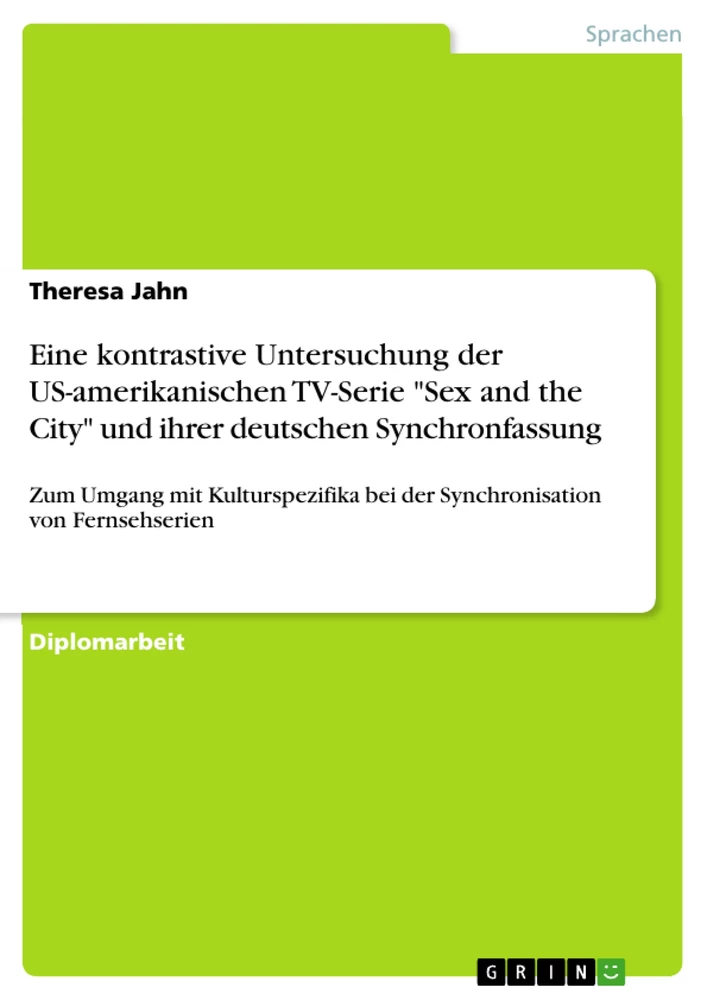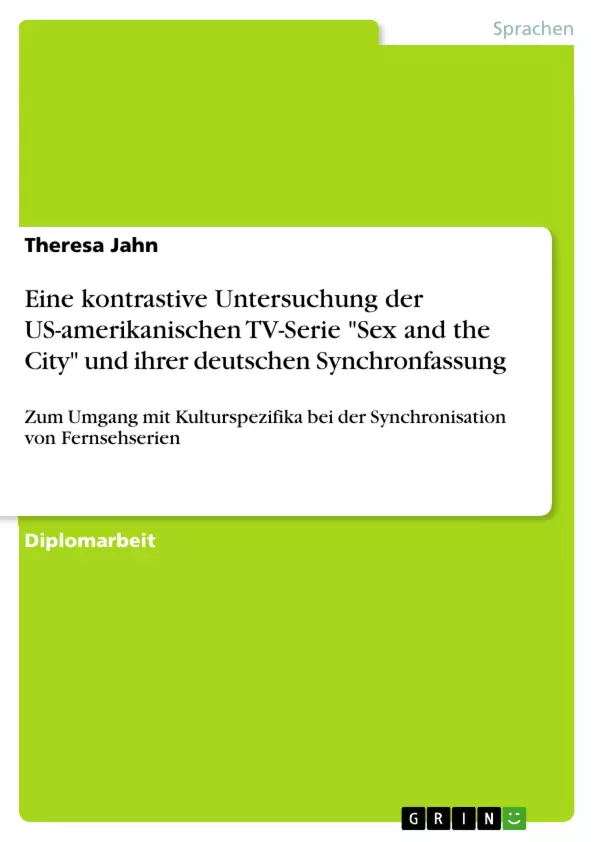Wer an einem beliebigen Wochentag den Fernseher einschaltet, stellt schnell fest, dass US-amerikanische Produktionen im deutschen Fernsehprogramm rund um die Uhr verfügbar sind. Der Serienmarkt in Deutschland ist fest in amerikanischer Hand. Besonders die Privatsender halten sich an die Importe aus der Traumfabrik. Damit diese beim Publikum Erfolg haben, müssen die Originalversionen natürlich noch publikumsgerecht aufbereitet werden. Da Deutschland auf eine achtzigjährige Synchronisationskultur zurückblickt, wird auch weiterhin der größte Teil der fürs Fernsehen bestimmten Serien synchronisiert.
Bei einer gelungenen Synchronisation stellt der sprachliche Aspekt lediglich eine Seite der Medaille dar. Übersetzerische Entscheidungen stehen nicht allein, sondern unterliegen z.T. stark den mediumspezifischen Beschränkungen. Es muss schließlich auch das filmische Ganze in Betracht gezogen werden: Wie wirken die sprachlichen Äußerungen in Zusammenhang mit der Mimik und Gestik der Schauspieler, der Kulisse, der Musik? Hier wird schnell deutlich, dass sich die Arbeitsweise eines Synchronbuchautors ganz gehörig von der eines Literaturübersetzers unterscheidet. Denn während das übersetzte Stück Weltliteratur für sich allein steht, ist das Endresultat ‚Synchrontext‘ nur ein winziges Puzzlestück im Gesamtkunstwerk ‚Film‘. Das aber muss genau passen.
Ziel dieser Arbeit ist es, zu klären, welche Übersetzungsverfahren generell in Frage kommen, und welche bei der Synchronisation von Sex and the City tatsächlich angewandt wurden. Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt auf dem Umgang mit den außersprachlichen Kulturspezifika bei der Synchronisation.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Gegenstand der vorliegenden Arbeit
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 1.3 Relevanz des gewählten Forschungsschwerpunkts
- 2 Zur Synchronisation
- 2.1 Begriffserklärung
- 2.2 Arten der Synchronität
- 2.2.1 Inhaltliche Synchronität
- 2.2.2 Lippensynchronität
- 2.2.1.1 Quantitative Lippensynchronität
- 2.2.1.2 Qualitative Lippensynchronität
- 2.2.3 Charaktersynchronität
- 2.2.3.1 Gestensynchronität
- 2.2.3.2 Nukleussynchronität
- 2.2.4 Hierarchie
- 2.3 Der Synchronisationsprozess
- 2.3.1 Erstellung des Synchrondialogs
- 2.3.2 Einteilen des Filmmaterials in takes
- 2.3.3 Aufnahme der Synchrondialoge
- 2.3.4 Serienspezifische Übertragungsprobleme
- 2.3.4.1 Anredeformen
- 2.3.4.2 Standardsätze und innerserielle Bezüge
- 2.3.4.3 Anspielungen auf die Eigenheiten und Beziehungen der Charaktere
- 3 Kulturtransfer in der Synchronisation
- 3.1 Definitionen und Abgrenzungen
- 3.1.1 Kultur
- 3.1.2 Kulturspezifik
- 3.1.3 Kulturtransfer
- 3.1.4 Kulturkompetenz
- 3.2 Kulturspezifik auf der Mattscheibe
- 3.3 Kulturelle Verstehensbarrieren im Fernsehalltag – Präsentation möglicher Übersetzungsprobleme
- 3.3.1 Sprachimmanente kulturspezifische Elemente
- 3.3.2 Außersprachliche kulturspezifische Elemente
- 3.3.2.1 Realia
- 3.3.2.2 Nonverbale Elemente
- 3.4 Der Übersetzungsprozess
- 3.4.1 Allgemeine paratextuelle Vorüberlegungen
- 3.4.1.1 Skopos
- 3.4.1.2 Adressatenanalyse
- 3.4.1.3 Pragmatische Aspekte
- 3.4.2 Vorüberlegungen zum Umgang mit Kulturspezifika
- 3.4.2.1 Zur Funktion von Kulturspezifika im Filmdialog
- 3.4.2.2 Präsuppositionen
- 3.4.2.3 Konnotationen
- 3.4.2.4 Mediumspezifische Gesichtspunkte
- 3.4.3 Übersetzungsstrategien für Realia
- 3.4.3.1 Ausgangssprachlich orientierte Übersetzungsverfahren
- 3.4.3.1.1 Zitatwort
- 3.4.3.1.2 Zitatwort mit Hinzufügung
- 3.4.3.1.3 Lehnbildung
- 3.4.3.2 Zielsprachlich orientierte Übersetzungsverfahren
- 3.4.3.2.1 Generalisierung
- 3.4.3.2.2 Analogiebildung
- 3.4.3.2.3 Paraphrase
- 3.4.3.3 Offizielle Entsprechung
- 3.4.3.4 Auslassung
- 3.4.4 Übersetzungsstrategien für nonverbale Elemente
- 3.5 Anforderungen an den Synchronautor in der Rolle des Kulturmittlers
- 4 Translationswissenschaftlich orientierte Analyse der TV-Serie Sex and the City
- 4.1 Korpusanalyse – Die Serie
- 4.1.1 Hintergrund und Entstehungsgeschichte
- 4.1.2 Die Hauptcharaktere
- 4.1.2.1 Carrie Bradshaw
- 4.1.2.2 Miranda Hobbes
- 4.1.2.3 Samantha Jones
- 4.1.2.4 Charlotte York
- 4.1.3 Die Handlung
- 4.1.3.1 Staffel 1
- 4.1.3.2 Staffel 2
- 4.1.3.3 Staffel 3
- 4.1.3.4 Staffel 4
- 4.1.3.5 Staffel 5
- 4.1.3.6 Staffel 6
- 4.1.4 Übersetzungsrelevante Besonderheiten
- 4.1.4.1 Paratextuelle Vorüberlegungen zur Synchronisation von Sex and the City
- 4.1.4.2 Sprachliche Besonderheiten
- 4.2 Analyse der Übersetzungsprobleme im Hinblick auf Kulturspezifika
- 4.2.1 Übersetzungsprobleme und angewandte Lösungsstrategien
- 4.2.1.1 Urbane Topographie - Straßen, Stadtviertel, Regionen
- 4.2.1.2 Geschichtliches - Berühmte Politiker, Gedenktage, Schauplätze
- 4.2.1.3 Gesellschaftsordnung – Justizwesen, Polizei, Behörden
- 4.2.1.4 Politik - Parteien, Ministerien, Amtssitz
- 4.2.1.5 Gesellschaftliche Verhältnisse – Gesellschaftsschichten
- 4.2.1.6 Alltagskultur I – Maßeinheiten
- 4.2.1.7 Alltagskultur II – Markennamen, Geschäfte, Handelsketten
- 4.2.1.8 Alltagskultur III - Beziehungen
- 4.2.1.9 Religion – Kirchen, Konfessionen, Rituale
- 4.2.1.10 Bildung – Fakultäten, Universitäten
- 4.2.1.11 Medien - Fernsehkanäle und -sendungen
- 4.2.1.12 Sport
- 4.2.1.13 Kulturelles Angebot – Werke aus Literatur und Musik
- 4.2.1.14 Bekannte Persönlichkeiten
- 4.2.1.15 Nonverbale kulturspezifische Elemente
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Umgang mit kulturspezifischen Elementen bei der Synchronisation von Fernsehserien. Im Fokus steht ein kontrastiver Vergleich der US-amerikanischen Serie „Sex and the City“ und ihrer deutschen Fassung. Ziel ist es, die Herausforderungen bei der Übersetzung kulturspezifischer Aspekte zu analysieren und die angewandten Übersetzungsstrategien zu bewerten.
- Herausforderungen der Synchronisation von kulturspezifischen Elementen
- Analyse verschiedener Übersetzungsstrategien
- Kontrastiver Vergleich der Original- und Synchronfassung
- Der Einfluss kultureller Unterschiede auf die Rezeption
- Die Rolle des Synchronautors als Kulturmittler
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein, beschreibt den Gegenstand der Untersuchung (den Umgang mit Kulturspezifika bei der Synchronisation von Fernsehserien am Beispiel von „Sex and the City“) und skizziert den Aufbau der Arbeit. Es wird die Relevanz des gewählten Forschungsschwerpunktes im Kontext der Translationswissenschaft begründet und die Methodik der Untersuchung kurz umrissen. Die Einleitung stellt den Rahmen für die folgenden Kapitel dar und legt die Forschungsfrage fest.
2 Zur Synchronisation: Das Kapitel definiert den Begriff der Synchronisation und beschreibt verschiedene Arten der Synchronität (inhaltlich, lippensynchron, charaktersynchron). Es erläutert detailliert den Synchronisationsprozess, von der Erstellung des Dialogs bis zur Aufnahme, und beleuchtet dabei serienspezifische Übertragungsprobleme wie Anredeformen, innerserielle Bezüge und Anspielungen auf Charaktereigenschaften. Dieser Abschnitt liefert das theoretische Fundament für die spätere Analyse der „Sex and the City“-Synchronisation.
3 Kulturtransfer in der Synchronisation: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Kulturtransfer im Kontext der Synchronisation. Es definiert zentrale Begriffe wie Kultur, Kulturspezifik und Kulturkompetenz und untersucht kulturelle Verstehensbarrieren, die im Fernsehen auftreten können, sowohl sprachimmanenter als auch außersprachlicher Natur (z.B. Realia und nonverbale Elemente). Es werden verschiedene Übersetzungsstrategien im Umgang mit Kulturspezifika vorgestellt und die Rolle des Synchronautors als Kulturmittler herausgestellt. Dieses Kapitel bildet die theoretische Grundlage für die praktische Analyse im folgenden Kapitel.
4 Translationswissenschaftlich orientierte Analyse der TV-Serie Sex and the City: Dieses Kapitel präsentiert die Korpusanalyse der Serie „Sex and the City“, inklusive Hintergrundinformationen, Charakterbeschreibungen und Handlungszusammenfassung. Der Fokus liegt auf der Analyse von Übersetzungsproblemen im Hinblick auf Kulturspezifika verschiedener Bereiche (urbane Topographie, Geschichte, Gesellschaftsordnung, Alltagskultur, Religion, Bildung, Medien, Sport etc.). Für jedes Problemfeld werden konkrete Beispiele aus der Serie analysiert und die angewandten Übersetzungsstrategien bewertet. Das Kapitel verbindet die Theorie der vorherigen Kapitel mit einer konkreten Fallstudie.
Schlüsselwörter
Synchronisation, Fernsehserien, Kulturspezifika, Kulturtransfer, Übersetzung, Übersetzungsstrategien, „Sex and the City“, kontrastive Analyse, Translationswissenschaft, Kulturkompetenz, Realia, Nonverbale Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Kulturtransfer in der Synchronisation von Fernsehserien am Beispiel von "Sex and the City"
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Umgang mit kulturspezifischen Elementen in der Synchronisation von Fernsehserien. Im Mittelpunkt steht ein detaillierter Vergleich der Originalfassung der US-amerikanischen Serie "Sex and the City" und ihrer deutschen Synchronisation.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Herausforderungen bei der Übersetzung kulturspezifischer Aspekte und bewertet die angewandten Übersetzungsstrategien. Sie untersucht den Einfluss kultureller Unterschiede auf die Rezeption der Serie und beleuchtet die Rolle des Synchronautors als Kulturmittler.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen der Synchronisation kulturspezifischer Elemente, der Analyse verschiedener Übersetzungsstrategien, einem kontrastiven Vergleich der Original- und Synchronfassung, dem Einfluss kultureller Unterschiede auf die Rezeption und der Rolle des Synchronautors als Kulturmittler.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Zur Synchronisation, Kulturtransfer in der Synchronisation und eine translationswissenschaftlich orientierte Analyse von "Sex and the City". Die Einleitung führt in die Thematik ein und definiert die Forschungsfrage. Kapitel 2 erklärt den Synchronisationsprozess und verschiedene Arten der Synchronität. Kapitel 3 behandelt den Kulturtransfer und relevante Übersetzungsstrategien. Kapitel 4 analysiert "Sex and the City" anhand konkreter Beispiele und bewertet die angewandten Übersetzungsstrategien.
Welche Arten der Synchronität werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet inhaltliche Synchronität, Lippensynchronität (quantitativ und qualitativ), Charaktersynchronität (Gestensynchronität und Nukleussynchronität) und die Hierarchie zwischen diesen Arten.
Welche Übersetzungsstrategien werden im Umgang mit Kulturspezifika betrachtet?
Die Arbeit untersucht sowohl ausgangssprachlich orientierte Verfahren (Zitatwort, Zitatwort mit Hinzufügung, Lehnbildung) als auch zielsprachlich orientierte Verfahren (Generalisierung, Analogiebildung, Paraphrase), sowie offizielle Entsprechungen und Auslassungen. Dies wird insbesondere am Beispiel von Realia und nonverbalen Elementen erläutert.
Welche Aspekte von "Sex and the City" werden analysiert?
Die Analyse von "Sex and the City" umfasst die Hintergrundinformationen zur Serie, die Charaktere, die Handlung und vor allem die Übersetzungsprobleme im Hinblick auf Kulturspezifika in verschiedenen Bereichen wie urbane Topographie, Geschichte, Gesellschaftsordnung, Alltagskultur, Religion, Bildung, Medien, Sport etc.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Synchronisation, Fernsehserien, Kulturspezifika, Kulturtransfer, Übersetzung, Übersetzungsstrategien, "Sex and the City", kontrastive Analyse, Translationswissenschaft, Kulturkompetenz, Realia, Nonverbale Kommunikation.
- Quote paper
- Theresa Jahn (Author), 2009, Eine kontrastive Untersuchung der US-amerikanischen TV-Serie "Sex and the City" und ihrer deutschen Synchronfassung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141776