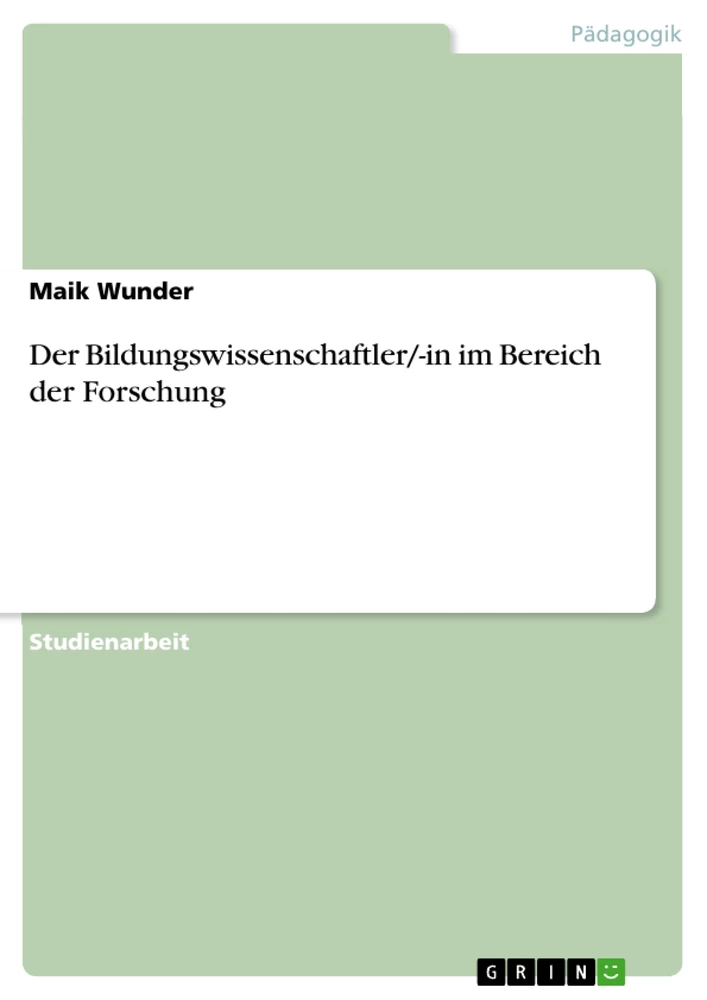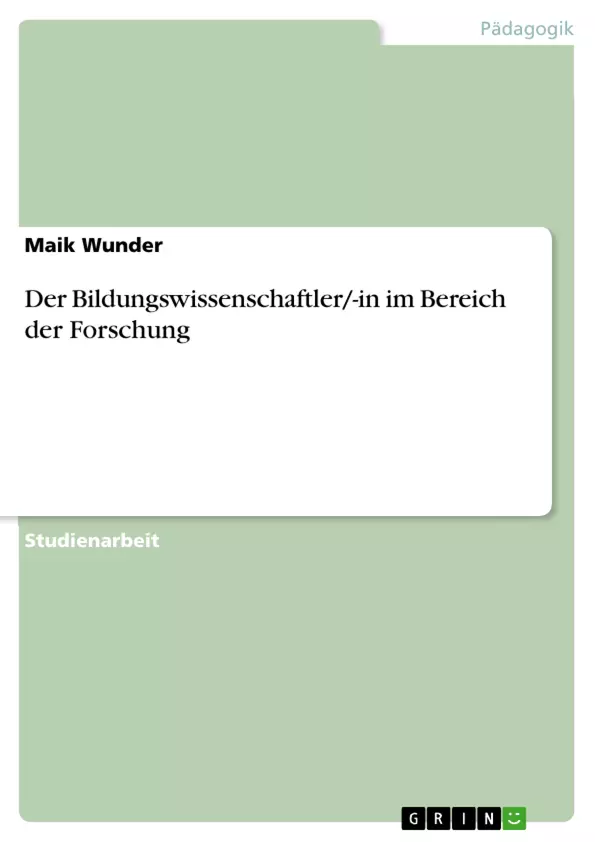Im Modul 2B BA Bildungswissenschaft ist eine Hausarbeit zum Four Component
Instructional Design Model (4CID-Modell) vorzulegen. Maßgeblich wurde dieses Modell
von van Merrienboër im Jahr 1997 entwickelt, um authentische Lernsituationen zu
schaffen. Mit diesem soll es dem Lernenden ermöglicht werden, komplexe kognitive
Fähigkeiten zu trainieren (Niegemann 2001, S. 58). Als Ziel soll ein größtmöglicher
Lernerfolg, bzw. Zuwachs an Kompetenzen erreicht werden.
Dieses Modell wird im ersten Teil anhand eines praktischen Anwendungsbeispielesder/
die BildungswissenschaftlerIn im Bereich der Forschung- vorgestellt (Im weiteren
Verlauf der Arbeit wird wegen der besseren Lesbarkeit, nur die männliche Form
verwendet. In einem ersten Schritt wird das 4CID Modell vereinfacht dargestellt. Diese
Darstellung wird im weiteren Verlauf vertieft und es wird am konkreten, praktischen
Anwendungsbeispiel die Anwendung von 4CID aufgezeigt. Dazu wird zum
Anwendungsbeispiel eine Hierarchie mit den zu vermittelnden Kompetenzen erstellt
und daraus vereinfachte Annahmen mit den dazugehörigen Aufgabenklassen
entwickelt. Zur ersten Aufgabenklasse werden drei zu bewältigende Lernaufgaben
dargestellt, sowie Erläuterungen zu unterstützenden Informationen und just-in-time
Informationen geben.
Der zweite Teil widmet sich der Theorie des 4CID Modells. Zunächst werden
lerntheoretische Überlegungen zum situierten Lernen angestellt und in einem weiteren
Schritt einige didaktische Szenarien aufgezeigt, die sich zur Integration des 4CID
Modells eignen. Ebenfalls wird auf Medien eingegangen, die der Unterstützung des
Blueprints dienen. Ein zusammenfassendes Fazit schließt die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das 4CID Modell vereinfacht dargestellt:
- 2.1. Analyse der Kompetenz: Entwicklung einer Fertigkeitshierarchie:
- 2.2. Das Erstellen von Aufgabenklassen:
- 2.3. Das Erstellen von Lernaufgaben:
- 2.4. Unterstützende Informationen und just-in-time Informationen:
- 3. Das 4CID Modell in der Theorie:
- 3.1. Lerntheoretische Überlegungen und situiertes Lernen:
- 3.2. Didaktische Szenarien zur Integration des 4cid Modells:
- 3.3. Medien zur Unterstützung des Blueprints:
- 4. Zusammenfassung und Fazit:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht das Four Component Instructional Design Model (4CID-Modell) von van Merrienboër (1997) und seine Anwendung im Kontext der Ausbildung von Bildungswissenschaftlern im Bereich der Forschung. Ziel ist es, die praktischen Anwendungsmöglichkeiten des Modells zu demonstrieren und seine lerntheoretischen Grundlagen zu beleuchten.
- Anwendung des 4CID-Modells in der praktischen Ausbildung
- Entwicklung einer Fertigkeitshierarchie für Bildungswissenschaftler in der Forschung
- Erstellung von Lernaufgaben und Aufgabenklassen im Rahmen des 4CID-Modells
- Lerntheoretische Grundlagen des situierten Lernens
- Geeignete Medien zur Unterstützung des 4CID-Blueprints
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt das Four Component Instructional Design Model (4CID-Modell) als Instrument zur Schaffung authentischer Lernsituationen für komplexe kognitive Fähigkeiten. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit: eine vereinfachte Darstellung des 4CID-Modells anhand eines praktischen Beispiels (Bildungswissenschaftler in der Forschung) gefolgt von einer vertieften theoretischen Auseinandersetzung mit dem Modell, einschließlich lerntheoretischer Überlegungen und didaktischer Szenarien.
2. Das 4CID Modell vereinfacht dargestellt: Dieses Kapitel bietet eine vereinfachte Einführung in das 4CID-Modell als systematischen Ansatz zur Gestaltung authentischer Lernumgebungen. Es betont die vier interagierenden Entwurfskomponenten: Lernaufgaben (zur Entwicklung kognitiver Schemata), unterstützende Informationen (für nicht-wiederkehrende Aufgaben), Just-in-time Informationen (für wiederkehrende Aufgaben) und Scaffolding (graduelle Reduktion von Unterstützung bei den Lernaufgaben). Das Kapitel dient als Grundlage für die spätere detailliertere Betrachtung des Modells und seiner Anwendung.
2.1. Analyse der Kompetenz: Entwicklung einer Fertigkeitshierarchie: Dieser Abschnitt fokussiert auf die Zerlegung komplexer Fertigkeiten in Teilkompetenzen, um die Komplexität von Lernumgebungen zu reduzieren. Es wird die Erstellung einer Fertigkeitshierarchie erläutert, die die zeitliche (temporale) und bedingte (konditionale) Abfolge von Teilfertigkeiten darstellt. Am Beispiel eines Bildungswissenschaftlers, der ein Forschungsprojekt durchführt, wird die praktische Anwendung der Hierarchie-Erstellung verdeutlicht, beginnend mit der Ressourcenbeschaffung über das Forschungsdesign bis hin zur Datenauswertung und -evaluation.
Schlüsselwörter
4CID-Modell, Instruktionsdesign, situiertes Lernen, Kompetenzanalyse, Fertigkeitshierarchie, Lernaufgaben, Aufgabenklassen, unterstützende Informationen, Just-in-time Informationen, Scaffolding, authentische Lernsituationen, empirische Sozialforschung, Forschungsdesign.
Häufig gestellte Fragen zum 4CID-Modell in der Ausbildung von Bildungswissenschaftlern
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das Four Component Instructional Design Model (4CID-Modell) von van Merrienboër (1997) und dessen Anwendung in der Ausbildung von Bildungswissenschaftlern im Bereich der Forschung. Sie demonstriert die praktischen Anwendungsmöglichkeiten des Modells und beleuchtet seine lerntheoretischen Grundlagen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt die Anwendung des 4CID-Modells in der praktischen Ausbildung, die Entwicklung einer Fertigkeitshierarchie für Bildungswissenschaftler in der Forschung, die Erstellung von Lernaufgaben und Aufgabenklassen im Rahmen des 4CID-Modells, die lerntheoretischen Grundlagen des situierten Lernens und geeignete Medien zur Unterstützung des 4CID-Blueprints.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit beginnt mit einer Einleitung, die das 4CID-Modell und den Aufbau der Arbeit beschreibt. Es folgt eine vereinfachte Darstellung des 4CID-Modells anhand eines praktischen Beispiels (Bildungswissenschaftler in der Forschung). Anschließend erfolgt eine vertiefte theoretische Auseinandersetzung mit dem Modell, einschließlich lerntheoretischer Überlegungen und didaktischer Szenarien. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung und einem Fazit.
Was ist das 4CID-Modell?
Das 4CID-Modell ist ein systematischer Ansatz zur Gestaltung authentischer Lernumgebungen. Es besteht aus vier interagierenden Entwurfskomponenten: Lernaufgaben (zur Entwicklung kognitiver Schemata), unterstützende Informationen (für nicht-wiederkehrende Aufgaben), Just-in-time Informationen (für wiederkehrende Aufgaben) und Scaffolding (graduelle Reduktion von Unterstützung bei den Lernaufgaben).
Wie wird das 4CID-Modell in der Hausarbeit angewendet?
Die Hausarbeit zeigt die Anwendung des 4CID-Modells anhand der Ausbildung von Bildungswissenschaftlern. Es wird eine Fertigkeitshierarchie für die Durchführung eines Forschungsprojekts entwickelt, Lernaufgaben und Aufgabenklassen erstellt und die geeigneten Medien zur Unterstützung des Lernprozesses diskutiert.
Welche lerntheoretischen Grundlagen werden betrachtet?
Die Hausarbeit beleuchtet die lerntheoretischen Grundlagen des situierten Lernens im Kontext des 4CID-Modells. Es wird untersucht, wie das Modell dazu beiträgt, authentische Lernsituationen zu schaffen, die die Entwicklung komplexer kognitiver Fähigkeiten fördern.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: 4CID-Modell, Instruktionsdesign, situiertes Lernen, Kompetenzanalyse, Fertigkeitshierarchie, Lernaufgaben, Aufgabenklassen, unterstützende Informationen, Just-in-time Informationen, Scaffolding, authentische Lernsituationen, empirische Sozialforschung, Forschungsdesign.
Welche Kapitel enthält die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist in folgende Kapitel gegliedert: Einleitung, Das 4CID Modell vereinfacht dargestellt (inkl. Analyse der Kompetenz, Erstellen von Aufgabenklassen, Erstellen von Lernaufgaben, Unterstützende Informationen und Just-in-time Informationen), Das 4CID Modell in der Theorie (inkl. Lerntheoretische Überlegungen und situiertes Lernen, Didaktische Szenarien zur Integration des 4cid Modells, Medien zur Unterstützung des Blueprints), Zusammenfassung und Fazit.
- Quote paper
- Maik Wunder (Author), 2009, Der Bildungswissenschaftler/-in im Bereich der Forschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181614