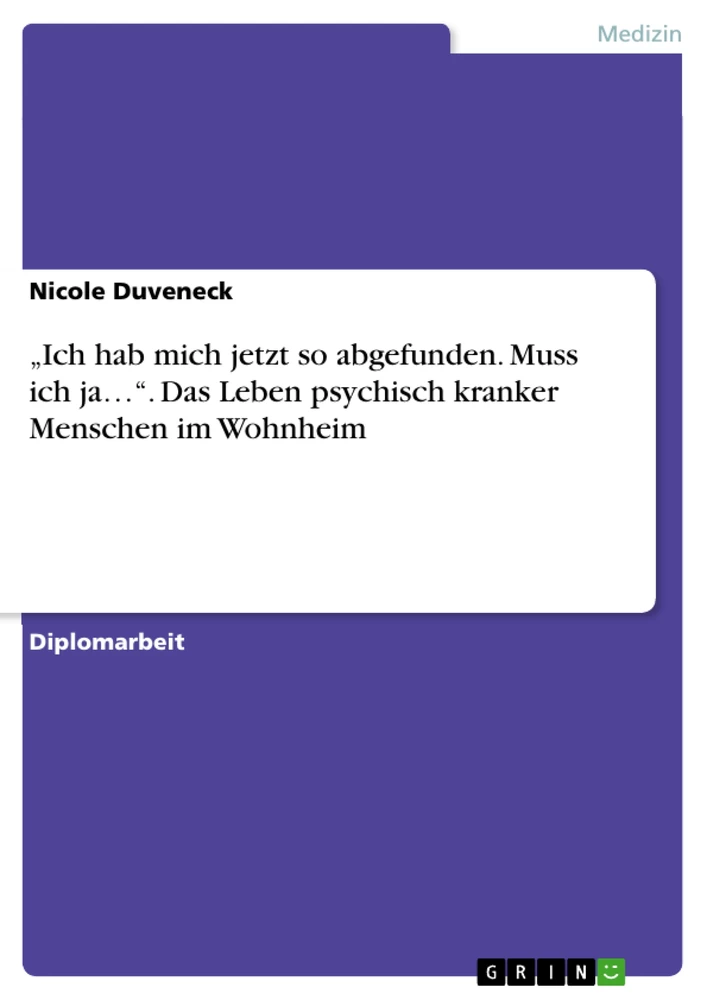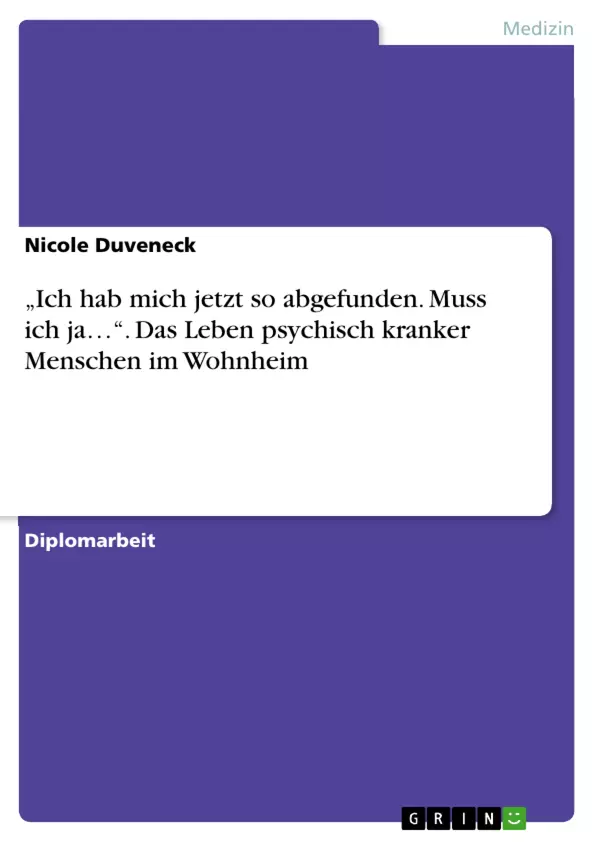Fragestellung:
Trotz der Reformen des psychiatrischen Versorgungssystems lebt weiterhin ein Großteil chronisch psychisch kranker Menschen in stationären Einrichtungen. In weite Ferne gerückt erscheint das gemeindepsychiatrische Ziel, auch Menschen mit chronisch rezidivierenden psychischen Erkrankungen zu befähigen, selbstbestimmt und normal im eigenen Lebensfeld zurechtzukommen. Im Bereich der Pflegeforschung ist die Situation psychisch kranker Menschen bislang relativ dethematisiert, in anderen Disziplinen wird sie wenig aktuell und dürftig behandelt, obendrein zumeist ausschließlich unter standardisierten Kriterien zur Lebensqualität. Mit Fokus auf die subjektive Sicht der Bewohner hat die Studie zum Ziel, die Einflüsse bzw. Einschränkungen, mit denen psychisch kranke Menschen in einem Wohnheim leben, sowie die Auswirkungen der institutionellen Lebensbedingungen auf die Persönlichkeit sowohl theoretisch als auch empirisch herauszuarbeiten und die pflegerischen Bedarfe und Bedürfnisse psychisch kranker Menschen in stationären Wohneinrichtungen zu identifizieren.
Methoden:
Die explorative Studie basiert auf fünf leitfadengestützten Interviews mit psychisch kranken Bewohnern eines Wohnheims, die inhaltsanalytisch mittels Qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet wurden.
Ergebnisse:
Die Ergebnisse zeigen, dass das Leben der Bewohner durch die Unterbringung in einem Wohnheim entscheidend geprägt wird. Die Institution als Ort pflegerischer Versorgung von psychisch kranken Menschen ist durch ein hohes Maß an Fremdbestimmung gekennzeichnet. In zahlreichen Bereichen unterliegt das Leben der Interviewten erheblichen Restriktionen. Die Fremdbestimmung führt bei den Bewohnern zum Abbau von Fähigkeiten zur autonomen Lebensführung und zu Problemen beim Entwurf einer eigenständigen biographischen Konstruktion. Nach Einschätzung der Bewohner tragen die Pflegenden die fremdbestimmenden, institutionellen Strukturen mit und werden als nicht Autonomie fördernd wahrgenommen.
Schlussfolgerung:
Die Pflegenden unterliegen ebenso wie die Bewohner den institutionellen Bedingungen des Wohnheims; ihre Funktion im System Heim ist ihnen unbekannt. Im Bestreben um eine professionelle pflegerische Handlungskompetenz bestimmt der Beitrag die Befähigung zu verständigungsorientierter Interaktion mit den Bewohnern und zur Reflexion der Macht- und Abhängigkeitsstrukturen im Heim als zentrale Ausbildungsziele, um die Autonomie der Bewohner besser zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Psychiatrische Versorgung
- Die Psychiatriereform - ein historischer Abriss
- Heutige Versorgungsstrukturen
- Hilfen im Bereich Wohnen
- Kritik
- Zusammenfassung
- Theoretischer Bezugsrahmen
- Das Konzept der totalen Institution
- Begriffsbestimmung
- Macht und Strategien der Anpassung
- Kritik
- Fremdwerden der eigenen Biographie
- Prozesse des Sich-selbst-gegenüber-fremd-Werdens
- Dimensionen der Verlusterfahrungen
- Zusammenfassung
- Das Konzept der totalen Institution
- Entwicklungs- und Forschungsstand
- Methodologische Grundannahmen der Untersuchung
- Durchführung der Untersuchung
- Ethische Überlegungen
- Datenerhebung
- Feldzugang und Sample
- Datenauswertung
- Ergebnisse
- Positive Lebenserfahrungen
- Negative Lebenserfahrungen
- Erkrankungen
- Folgen der psychischen Erkrankung
- Einfluss psychiatrischer Behandlung
- Autonomie
- Fremdbestimmung
- Privatsphäre
- Folgen des institutionellen Wohnens
- Hilfen
- Zufriedenheit
- Resignation
- Veränderungswünsche im Wohnheim
- Wünsche und konkrete Pläne für die Zukunft
- Diskussion
- Schlussfolgerungen für eine professionelle pflegerische Handlungskompetenz
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Leben psychisch kranker Menschen in einem Wohnheim. Ziel ist es, die Lebensrealitäten dieser Bewohner zu beleuchten und ihre Erfahrungen mit den institutionellen Rahmenbedingungen zu analysieren. Die Arbeit trägt dazu bei, ein besseres Verständnis für die Herausforderungen und Bedürfnisse dieser Personengruppe zu entwickeln.
- Lebensqualität und Lebenserfahrungen psychisch kranker Menschen im Wohnheim
- Einfluss von institutionellen Strukturen auf die Autonomie und Selbstbestimmung
- Die Rolle psychiatrischer Behandlung und deren Auswirkungen
- Positive und negative Aspekte des Wohnheimlebens
- Zukunftsperspektiven und Wünsche der Bewohner
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt die Relevanz der Untersuchung des Lebens psychisch kranker Menschen im Wohnheim. Sie skizziert die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit.
Psychiatrische Versorgung: Dieses Kapitel gibt einen historischen Überblick über die Psychiatriereform und beschreibt die heutigen Versorgungsstrukturen für psychisch kranke Menschen. Es beleuchtet verschiedene Hilfen im Bereich Wohnen und kritisch die bestehenden Strukturen.
Theoretischer Bezugsrahmen: Dieses Kapitel entwickelt den theoretischen Rahmen der Arbeit. Es analysiert das Konzept der totalen Institution nach Goffman, untersucht die damit verbundenen Machtstrukturen und Strategien der Anpassung, sowie den Prozess des Fremdwerdens der eigenen Biographie. Die Kapitel analysiert Prozesse des Sich-selbst-gegenüber-fremd-Werdens und Dimensionen der Verlusterfahrungen im Kontext psychischer Erkrankung und institutioneller Unterbringung.
Entwicklungs- und Forschungsstand: Dieses Kapitel fasst den aktuellen Forschungsstand zum Thema zusammen und beschreibt die relevanten Studien und Theorien. Es dient als Grundlage für die eigene Untersuchung.
Methodologische Grundannahmen der Untersuchung: Dieses Kapitel erläutert die methodischen Ansätze der Studie und die damit verbundenen ethischen Überlegungen. Es beschreibt die angewandte Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden.
Durchführung der Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Durchführung der Untersuchung, einschließlich der ethischen Überlegungen, der Datenerhebung, des Feldzugangs, des Samples und der Datenauswertung. Es legt die methodischen Grundlagen der Studie dar.
Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, differenziert nach positiven und negativen Lebenserfahrungen, den Auswirkungen der Erkrankung und der Behandlung, Aspekten von Autonomie und Fremdbestimmung, sowie der Zufriedenheit und den Zukunftswünschen der Bewohner. Es analysiert den Einfluss des institutionellen Wohnens.
Diskussion: Dieses Kapitel analysiert die Ergebnisse im Kontext des theoretischen Rahmens und des Forschungsstandes. Es diskutiert die Bedeutung der Ergebnisse und mögliche Limitationen der Untersuchung.
Schlüsselwörter
Psychische Erkrankung, Wohnheim, Lebensqualität, Institution, Autonomie, Selbstbestimmung, Psychiatriereform, Partizipation, Rehabilitation, Integration, Qualitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Leben psychisch kranker Menschen in einem Wohnheim
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht das Leben psychisch kranker Menschen in einem Wohnheim. Sie beleuchtet die Lebensrealitäten der Bewohner und analysiert deren Erfahrungen mit den institutionellen Rahmenbedingungen. Ziel ist ein besseres Verständnis der Herausforderungen und Bedürfnisse dieser Personengruppe.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Lebensqualität und Lebenserfahrungen der Bewohner, den Einfluss institutioneller Strukturen auf Autonomie und Selbstbestimmung, die Rolle psychiatrischer Behandlung und deren Auswirkungen, positive und negative Aspekte des Wohnheimlebens sowie die Zukunftsperspektiven und Wünsche der Bewohner.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Psychiatrische Versorgung, Theoretischer Bezugsrahmen (inkl. Goffmans Konzept der totalen Institution und dem Fremdwerden der eigenen Biographie), Entwicklungs- und Forschungsstand, Methodologische Grundannahmen der Untersuchung, Durchführung der Untersuchung, Ergebnisse, Diskussion, Schlussfolgerungen für eine professionelle pflegerische Handlungskompetenz und Ausblick.
Wie ist der theoretische Rahmen der Arbeit aufgebaut?
Der theoretische Rahmen basiert auf Goffmans Konzept der totalen Institution, analysiert Machtstrukturen und Anpassungsstrategien innerhalb solcher Institutionen und untersucht den Prozess des Fremdwerdens der eigenen Biographie im Kontext psychischer Erkrankung und institutioneller Unterbringung. Es werden Prozesse des Sich-selbst-gegenüber-fremd-Werdens und Dimensionen von Verlusterfahrungen betrachtet.
Welche Methoden wurden in der Untersuchung angewendet?
Die Arbeit beschreibt detailliert die methodischen Ansätze, ethische Überlegungen, die Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden sowie den Feldzugang und das Sample. Die methodischen Grundlagen der Studie werden ausführlich dargestellt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse werden differenziert nach positiven und negativen Lebenserfahrungen, den Auswirkungen der Erkrankung und der Behandlung, Aspekten von Autonomie und Fremdbestimmung, Zufriedenheit und den Zukunftswünschen der Bewohner präsentiert. Der Einfluss des institutionellen Wohnens wird analysiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen für eine professionelle pflegerische Handlungskompetenz und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und Entwicklungen im Bereich der Versorgung psychisch kranker Menschen in Wohnheimen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Psychische Erkrankung, Wohnheim, Lebensqualität, Institution, Autonomie, Selbstbestimmung, Psychiatriereform, Partizipation, Rehabilitation, Integration, Qualitative Forschung.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse kurz und prägnant beschreibt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachkräfte im Bereich der Psychiatrie und Pflege, Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich für die Lebensbedingungen und die Versorgung psychisch kranker Menschen interessieren.
- Citar trabajo
- Nicole Duveneck (Autor), 2010, „Ich hab mich jetzt so abgefunden. Muss ich ja…“. Das Leben psychisch kranker Menschen im Wohnheim, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188013