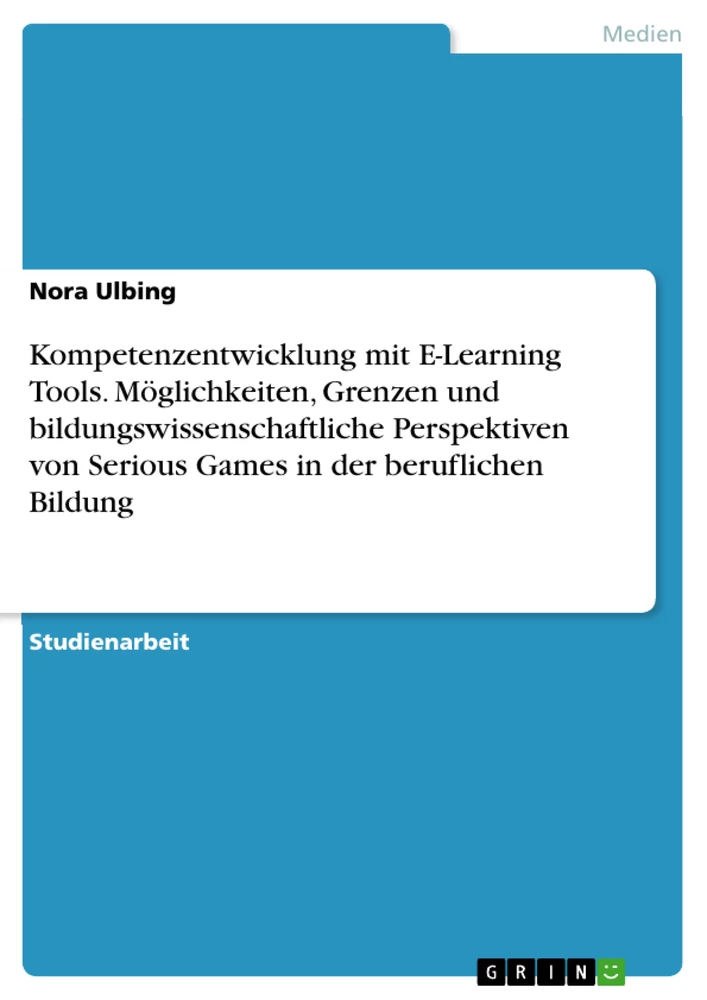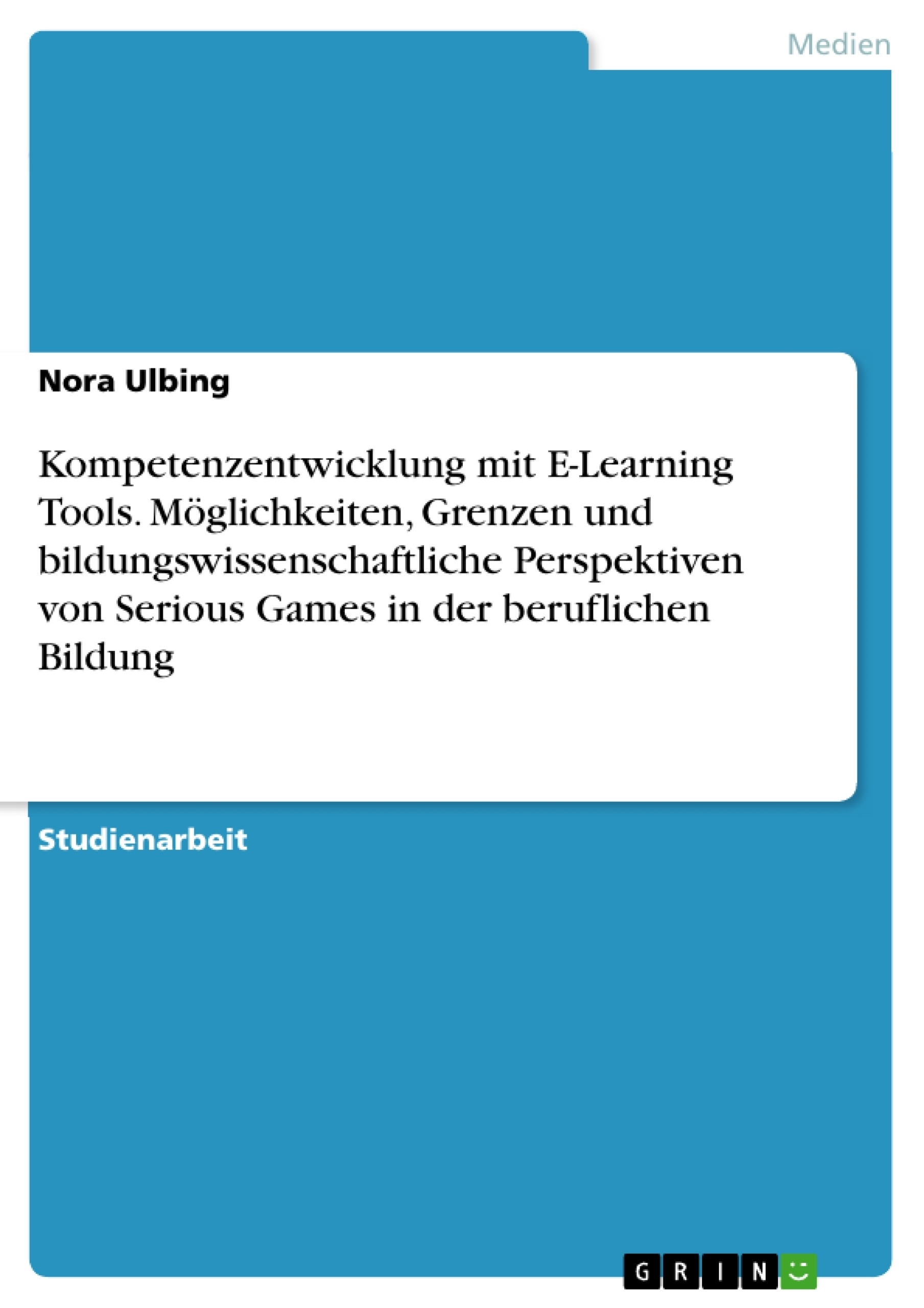Gemäß de Witt ist Lernen „ein komplexer Prozess, der den Erwerb von neuen Verhaltensweisen, Kenntnissen und Fertigkeiten“ erfordert, um nicht nur „alltägliche“, sondern auch „berufliche Situationen bewältigen zu können“. In der beruflichen Qualifizierung impliziert die digitale Medienaneignung Medienhandeln als selbstbestimmte Gestaltung mediatisierter Arbeits- und Lebenswelten und erfordert eine spezifizierte soziale, mediale und kommunikative Kompetenz (Bröckling & Glade, 2013, S. 45). Dabei verspricht jedoch nicht die neueste bzw. innovativste Medientechnik den größten Lernerfolg. Bröckling und Glade (2013) definieren, dass „die aus den Lebenswelten Auszubildender entnommene, gewohnte Medientechnik“ die besten Lernerfolge erzielen kann, da diese „näher an den vertrauten Handlungsmustern und Strukturen ist“. In Bezug hierauf hat sich die Relevanz des Mediums Computerspiel längst verändert, zumal es heute als eine signifikante Interaktionsform unserer Gesellschaft gilt (Wagner, 2009, S. 4). Sonach haben sich Computerspiele kontinuierlich in den Lebenswelten aller Altersschichten, männlichen als auch weiblichen Geschlechts manifestiert, sind also zu einem Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens geworden. Otto (2011, S. 5) legt dar, dass im Besonderen Strategie- und Simulationsspiele ebenso wie Denkaufgaben oder kurze Unterhaltungs- und Browserspiele, nicht immer im Einzelspielermodus sondern oft im Mehrspielermodus, gespielt werden. Aufgrund des steigenden Bedarfs, um nicht zu sagen des heutigen Faibles für Computerspiele, wird die Wirtschaft kumulativ davon profitieren. Selbst in der beruflichen Aus- und Weiterbildung haben sich bereits Computerspiele – sogenannte Serious Games – etabliert. Diese dienen nicht vorwiegend Unterhaltungszwecken da ihnen hauptsächlich ein Informations- und Bildungsauftrag zugrunde liegt. Die Anzahl von Serious Games und Lernspielen nimmt durch gegebene Möglichkeiten der Digitalisierung seit einigen Jahren vermehrt zu (Korn, 2011, S.18).
Ziel der Hausarbeit, mit dem Titel „Kompetenzentwicklung unter Mithilfe von E-Learning Tools – Möglichkeiten, Grenzen und bildungswissenschaftliche Perspektiven von Serious Games in der beruflichen Bildung“, ist herauszufinden worin die Herausforderungen und Potentiale von digitalen Spielen bzw. Serious Games liegen und zu zeigen ob Spiele im Kontext beruflicher Bildung sinnvoll genutzt werden können. Es soll darüberhinaus herausgearbeitet werden, inwiefern der Einsatz...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lernen in der beruflichen Bildung
- Lerntheoretische Grundlagen
- Die Relevanz von Kompetenzentwicklung im E-Learning
- Die Bedeutung von Medienkompetenz
- Lernspiele in der beruflichen Bildung
- Anwendungsbereiche von E-Learning
- Begriffliche Abgrenzung
- Interaktive Präsentationsformen
- Der Nutzen von (digitalen) Lernspielen
- Definition von Serious Games
- Anwendungsbereiche von Serious Games
- Möglichkeiten und Grenzen von Serious Games
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit „Kompetenzentwicklung unter Mithilfe von E-Learning Tools – Möglichkeiten, Grenzen und bildungswissenschaftliche Perspektiven von Serious Games in der beruflichen Bildung“ befasst sich mit der Frage, ob und wie digitale Spiele, insbesondere Serious Games, in der beruflichen Bildung sinnvoll eingesetzt werden können. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und Potentiale dieser Spiele und untersucht, inwiefern sie zur Kompetenzentwicklung beitragen können.
- Die Bedeutung von Kompetenzentwicklung im E-Learning
- Die Rolle von Lernspielen und Serious Games in der beruflichen Bildung
- Die Möglichkeiten und Grenzen von Serious Games im Kontext der Kompetenzentwicklung
- Die bildungswissenschaftlichen Perspektiven auf den Einsatz von Serious Games
- Die Relevanz von Medienkompetenz im Umgang mit digitalen Lernspielen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Kompetenzentwicklung im Kontext von E-Learning Tools ein und beleuchtet die Relevanz von digitalen Spielen, insbesondere Serious Games, in der beruflichen Bildung. Sie stellt die Forschungsfrage der Arbeit dar und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den lerntheoretischen Grundlagen des Lernens in der beruflichen Bildung. Es beleuchtet die Bedeutung von Kompetenzentwicklung im E-Learning und die Relevanz von Medienkompetenz im Umgang mit digitalen Lernspielen.
Das dritte Kapitel widmet sich den Lernspielen in der beruflichen Bildung. Es behandelt die Anwendungsbereiche von E-Learning, die begriffliche Abgrenzung von Lernspielen und Serious Games sowie die verschiedenen interaktiven Präsentationsformen. Darüber hinaus werden die Möglichkeiten und Grenzen von Serious Games im Kontext der Kompetenzentwicklung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Kompetenzentwicklung, E-Learning Tools, Serious Games, berufliche Bildung, Möglichkeiten und Grenzen, bildungswissenschaftliche Perspektiven, Medienkompetenz, Lernspiele, digitale Spiele, interaktive Präsentationsformen, Simulationen, Rollenspiele, Planspiele, Game Based Learning, Digital Game-Based Learning, und die Relevanz von Lernspielen im Kontext der beruflichen Bildung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Serious Games in der beruflichen Bildung?
Serious Games sind digitale Spiele, die nicht primär der Unterhaltung dienen, sondern einen Informations- und Bildungsauftrag verfolgen, um berufliche Kompetenzen zu fördern.
Warum sind Computerspiele für den Lernprozess relevant?
Da Computerspiele fester Bestandteil der Lebenswelt vieler Menschen sind, bieten sie vertraute Handlungsmuster. Dies kann den Lernerfolg steigern, da die Medientechnik nah an gewohnten Strukturen liegt.
Welche Kompetenzen werden durch E-Learning Tools gefördert?
Neben fachlichen Kenntnissen werden vor allem soziale, mediale und kommunikative Kompetenzen sowie die allgemeine Medienkompetenz im Umgang mit digitalen Arbeitswelten gestärkt.
Welche Spielformen werden im beruflichen Kontext genutzt?
Häufig zum Einsatz kommen Strategie- und Simulationsspiele, Denkaufgaben, Rollenspiele und Planspiele, die sowohl im Einzel- als auch im Mehrspielermodus absolviert werden können.
Was sind die Grenzen von Serious Games?
Die Arbeit untersucht kritisch, wo die Möglichkeiten enden, etwa bei der Übertragbarkeit komplexer Verhaltensweisen oder technischen Hürden in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung.
- Citar trabajo
- Nora Ulbing (Autor), 2014, Kompetenzentwicklung mit E-Learning Tools. Möglichkeiten, Grenzen und bildungswissenschaftliche Perspektiven von Serious Games in der beruflichen Bildung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283910