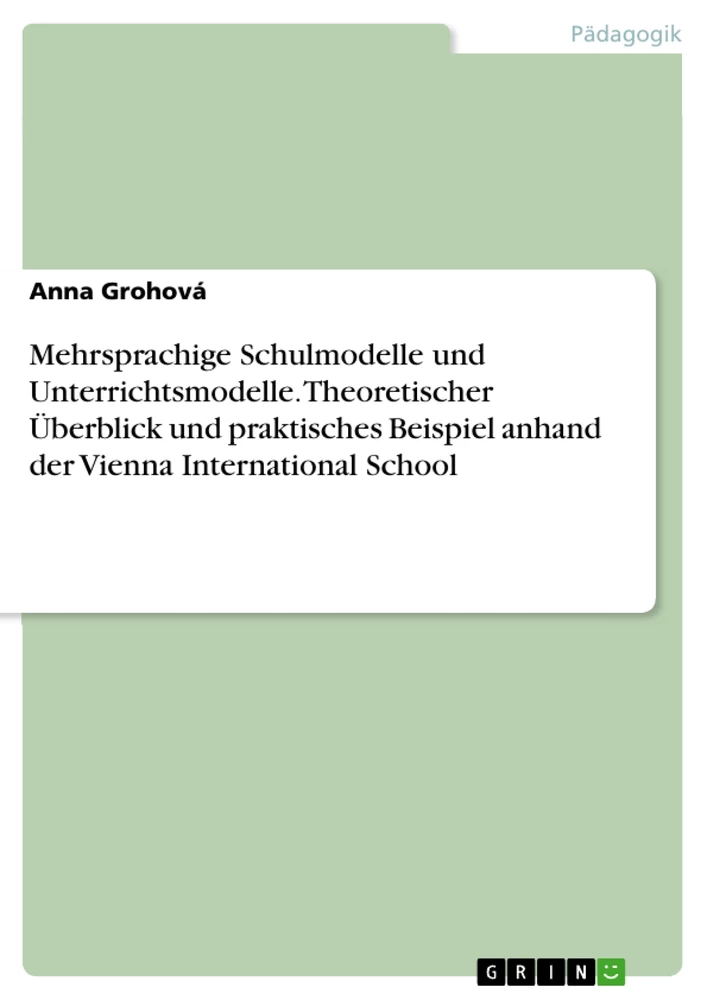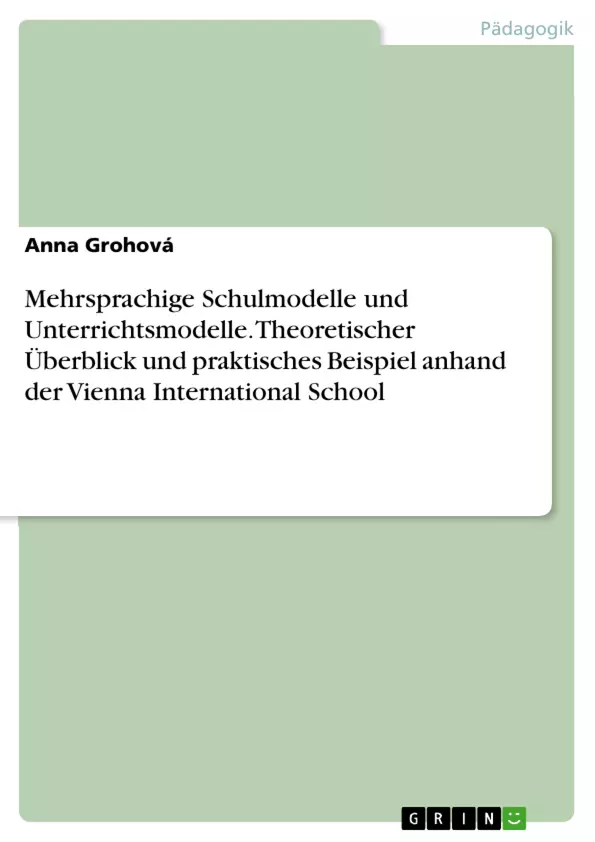Es lassen sich sprachenpolitische Ziele in Europa folgend interpretieren: Allen Europäern sollte es ermöglicht werden, Kenntnisse in ihrer L1 sowie in weiteren Fremdsprachen zu gewinnen, zu bewahren und zu erweitern, und zwar im Rahmen von differenzierten und komplexen Bildungsprogrammen, in denen eine Fremdsprache nicht als Barriere gilt.
In der Referatsausarbeitung werden die Möglichkeiten vorgestellt, wie sich Schulen mit dieser Herausforderung auseinandersetzen können. Am Beispiel der Vienna International School wird die praktische Anwendung von Prinzipien und theoretischen Thesen des mehrsprachigen Unterrichts gezeigt.
Die Europäische Union erklärte Fremdsprachenlernen zu einem der wichtigsten Ziele im Rahmen der Förderung von Mobilität und interkultureller Verständigung. Jede/r EuropäerIn sollte außer seiner Erstsprache zwei andere Fremdsprachen auf kommunikativem Niveau beherrschen. Da die Erziehung zur Mehrsprachigkeit so früh wie möglich beginnen sollte, spielen Schulen eine der wichtigsten Rollen in der Förderung von Mehrsprachigkeit. Fremde Sprachen und Kulturen gleichmäßig wertschätzen, die inspirierende Umgebung für kontinuierliches Fremdsprachenlernen schaffen und den Erhalt der Erstsprache beim plurilingualen Spracherwerb unterstützen – das alles sind grundlegende Prinzipien, die schon im Kindergarten oder Primarbereich beigebracht werden können und die Teilnahme an einer modernen, mehrsprachigen Gesellschaft wesentlich vereinfachen.
Methoden und Prinzipien des mehrsprachigen Unterrichts werden bereits in traditionell mehrsprachigen Ländern und Regionen angewandt. Dort werden sie als natürliche Konsequenz der sprachlichen und kulturellen Diversität gesehen, egal, ob ihr Ursprung in Autochthonität oder in Globalisierung liegt. In solchen Schulsystemen gilt die Sprachenvielfalt als „kreative Herausforderung, Bereicherung und pädagogische Verpflichtung“ (Schader 2004). Es gibt aber auch Länder oder Regionen, die sich selbst traditionell einsprachig sehen oder sich für sprachlich homogen halten. Die „tun einfach so, als gäbe es sie (die Mehrsprachigkeit) nicht, als wäre alles beim Alten.“ (Schader 2004) Dieses Denken spiegelt sich dann natürlich auch in ihren Schulsystemen und teilweise auch in (fehlenden) sprachenpolitischen Maßnahmen wieder, die zeigen, dass der monolinguale Habitus immer noch tief eingewurzelt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Mehrsprachigkeit in der Schule
- Mehrsprachige Schul- und Unterrichtsmodelle
- Bilinguale vs. mehrsprachige Schulen
- Arbeitssprachen, unterrichtete Sprachen und ihre Auswahl
- Heritage languages
- Community languages
- Élite multilingualism
- Förderung der Erstsprache
- Förderung direkt im Unterricht
- Förderung außerhalb des Regelunterrichts
- Methoden des Unterrichts
- CLIL (Content and Language Integrated Learning)
- Canadian Immersion Programme
- Bilingual Poster Production
- Ein praktisches Beispiel – VIENNA INTERNATIONAL SCHOOL
- Unterrichtssprachen, Fremdsprachen und ihre Auswahl
- Förderung der Unterrichtssprache
- Erstsprachen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Referatsausarbeitung befasst sich mit dem Thema der Mehrsprachigkeit in der Schule. Ziel ist es, einen Überblick über verschiedene mehrsprachige Schul- und Unterrichtsmodelle zu geben und die Herausforderungen der Sprachenpolitik in Europa zu beleuchten. Dabei werden verschiedene Ansätze zur Auswahl von Unterrichtssprachen, die Förderung der Erstsprache und die Methoden des mehrsprachigen Unterrichts betrachtet.
- Mehrsprachige Schul- und Unterrichtsmodelle im Vergleich
- Die Rolle der Erstsprache im mehrsprachigen Unterricht
- Methoden des mehrsprachigen Unterrichts
- Sprachenpolitik in Europa und die Förderung von Mehrsprachigkeit
- Ein praktisches Beispiel: die Vienna International School
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Mehrsprachigkeit in der Schule und die Herausforderungen, die sich aus der Sprachenvielfalt ergeben. Kapitel 1 stellt verschiedene mehrsprachige Schul- und Unterrichtsmodelle vor und analysiert die Auswahl von Arbeitssprachen, unterrichteten Sprachen und die Förderung der Erstsprache. Kapitel 2 zeigt am Beispiel der Vienna International School die praktische Anwendung von mehrsprachigen Unterrichtsprinzipien.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Schul- und Unterrichtsmodelle, Arbeitssprachen, unterrichtete Sprachen, Förderung der Erstsprache, Sprachenpolitik, Europa, Vienna International School, Bilingualismus, Plurilingualismus, CLIL, Immersion Programme.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die sprachenpolitischen Ziele der EU?
Jeder Europäer sollte neben seiner Erstsprache zwei weitere Fremdsprachen auf kommunikativem Niveau beherrschen.
Welche Rolle spielen Schulen bei der Mehrsprachigkeit?
Schulen sollen eine inspirierende Umgebung schaffen, die Erstsprache erhalten und plurilingualen Spracherwerb fördern.
Was ist CLIL?
CLIL steht für "Content and Language Integrated Learning" und bezeichnet eine Methode, bei der Sachfächer in einer Fremdsprache unterrichtet werden.
Welches praktische Beispiel für mehrsprachigen Unterricht wird genannt?
Die Vienna International School (VIS) dient als Beispiel für die Umsetzung mehrsprachiger Unterrichtsprinzipien.
Was versteht man unter dem "monolingualen Habitus"?
Es beschreibt die tief verwurzelte Einstellung in traditionell einsprachig geprägten Regionen, Mehrsprachigkeit im Schulsystem weitgehend zu ignorieren.
- Citar trabajo
- Anna Grohová (Autor), 2016, Mehrsprachige Schulmodelle und Unterrichtsmodelle. Theoretischer Überblick und praktisches Beispiel anhand der Vienna International School, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319108