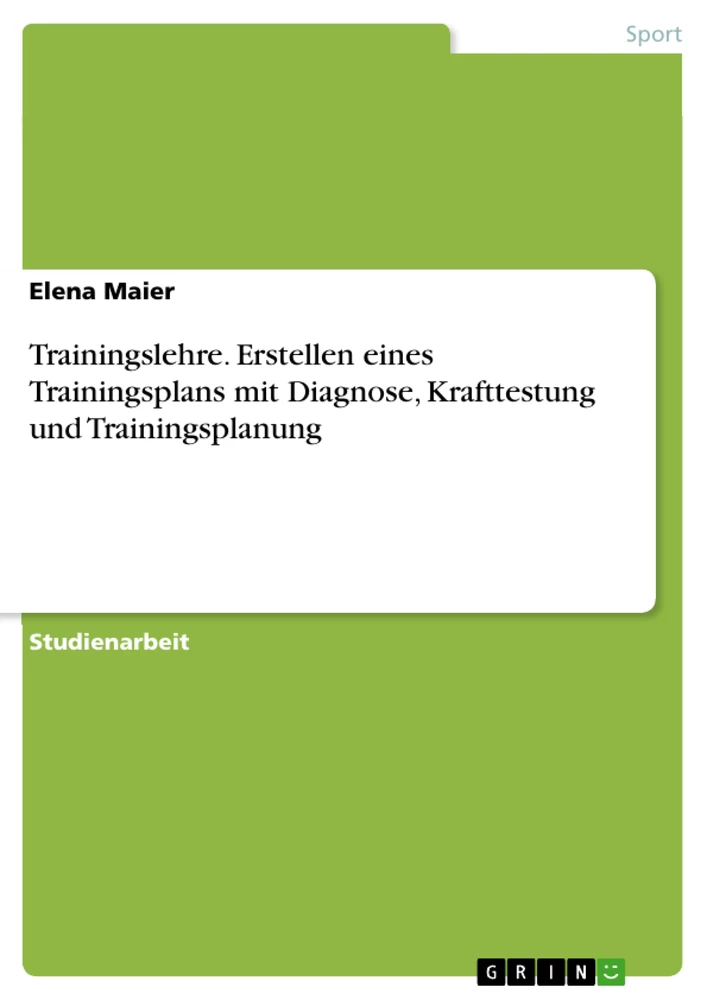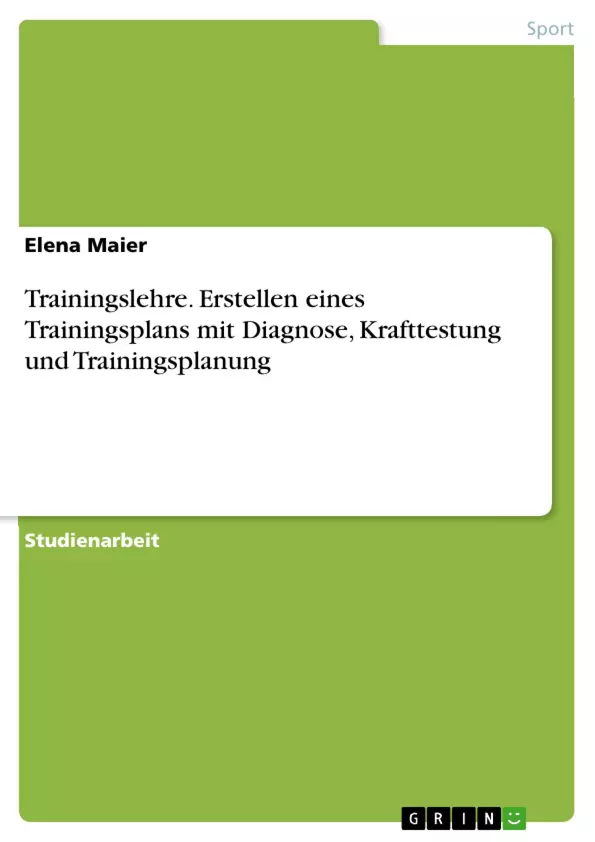Die Hausarbeit "Trainingslehre I" beschreibt das Verfahren zum Erstellen eines Trainingsplanes. Die dafür vorgesehenen Schritte werden konkret beschrieben und anhand einer Probanden genauer erläutert.
Diese Schritte sind:
1. Diagnose und Erfassung der biometrischen Daten;
2. Krafttestung anhand eines Mehrwiederholungskrafttests (X-RM-Test);
3. Zielsetzung und Prognose;
4. Trainingsplanung (Makrozyklus und Mesozyklus)
Inhaltsverzeichnis
- TEILAUFGABE 1 - DIAGNOSE
- 1.1 Allgemeine und biometrische Daten
- 1.2 Krafttestung
- TEILAUFGABE 2 – ZIELSETZUNG/PROGNOSE
- TEILAUFGABE 3 - TRAININGSPLANUNG MAKROZYKLUS
- TEILAUFGABE 4 – TRAININGSPLANUNG MESOZYKLUS
- TEILAUFGABE 5 - LITERATURRECHERCHE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Einsendeaufgabe im Fachmodul Trainingslehre I befasst sich mit der Erstellung eines individuellen Trainingsplans für eine Probandin. Die Aufgabe beinhaltet verschiedene Aspekte, von der Diagnose der körperlichen Voraussetzungen und Krafttestung über die Zielsetzung und Prognose bis hin zur detaillierten Planung des Trainingsplans in Makro- und Mesozyklen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung eines effektiven und sicheren Trainingsprogramms, das auf die Bedürfnisse der Probandin abgestimmt ist.
- Diagnose der körperlichen Voraussetzungen
- Krafttestung zur Bestimmung des individuellen Leistungsstands
- Zielsetzung und Prognose der Trainingsfortschritte
- Trainingsplanung in Makro- und Mesozyklen
- Literaturrecherche und wissenschaftliche Fundierung des Trainingsplans
Zusammenfassung der Kapitel
TEILAUFGABE 1 - DIAGNOSE
In diesem Kapitel werden die allgemeinen und biometrischen Daten der Probandin erhoben, die als Grundlage für die Planung des individuellen Trainingsplans dienen. Außerdem wird eine Krafttestung durchgeführt, um den aktuellen Leistungsstand der Probandin zu ermitteln. Die Ergebnisse der Krafttestung werden in Tabellenform dargestellt.
TEILAUFGABE 2 – ZIELSETZUNG/PROGNOSE
Dieses Kapitel beschreibt die Ziele des Trainingsprogramms, die auf Grundlage der erhobenen Daten und der Wünsche der Probandin definiert werden. Es wird eine Prognose über die zu erwartenden Trainingsfortschritte abgegeben, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Erfahrungen der Probandin basiert.
TEILAUFGABE 3 - TRAININGSPLANUNG MAKROZYKLUS
Dieses Kapitel beschreibt die übergeordnete Struktur des Trainingsplans. Die Planung erfolgt im Makrozyklus, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, und die einzelnen Trainingseinheiten werden im Rahmen von Mesozyklen geplant. Die Trainingsintensität und das Trainingsvolumen werden im Makrozyklus definiert und an die individuellen Bedürfnisse der Probandin angepasst.
TEILAUFGABE 4 – TRAININGSPLANUNG MESOZYKLUS
In diesem Kapitel werden die Mesozyklen des Trainingsplans detailliert beschrieben. Jeder Mesozyklus umfasst mehrere Trainingseinheiten, die sich in Bezug auf Intensität, Volumen und Trainingsmethoden unterscheiden. Die Mesozyklen dienen dazu, die Trainingsfortschritte zu optimieren und die Belastungsintensität zu variieren.
TEILAUFGABE 5 - LITERATURRECHERCHE
Dieses Kapitel beleuchtet die wissenschaftlichen Grundlagen, die für die Planung des individuellen Trainingsplans relevant sind. Es wird eine Literaturrecherche durchgeführt, um aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Krafttraining und Trainingsplanung zu berücksichtigen.
Schlüsselwörter
Krafttraining, Trainingslehre, Trainingsplanung, Makrozyklus, Mesozyklus, Diagnose, Krafttestung, Zielsetzung, Prognose, Literaturrecherche, Fitnessökonomie, Trainingsprinzipien, individuelle Anpassung, Belastungsintensität, Trainingseinheit, Trainingsphilosophie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Schritte sind für die Erstellung eines Trainingsplans notwendig?
Die wesentlichen Schritte sind Diagnose (biometrische Daten), Krafttestung, Zielsetzung/Prognose sowie die detaillierte Makro- und Mesozyklusplanung.
Was ist ein X-RM-Test?
Es handelt sich um einen Mehrwiederholungskrafttest, der dazu dient, das individuelle Kraftniveau und die Belastungsintensität für das Training zu bestimmen.
Was unterscheidet einen Makrozyklus von einem Mesozyklus?
Ein Makrozyklus stellt die langfristige Planung (Monate bis Jahre) dar, während ein Mesozyklus ein mittelfristiger Trainingsabschnitt (meist 4-12 Wochen) zur Erreichung von Teilzielen ist.
Warum ist die Diagnose biometrischer Daten wichtig?
Sie bildet die Grundlage für eine sichere und effektive Trainingsplanung, die auf die individuellen körperlichen Voraussetzungen des Probanden abgestimmt ist.
Wie werden Trainingsziele definiert?
Ziele werden auf Basis der erhobenen Daten, der Wünsche des Trainierenden und wissenschaftlicher Prognosen festgelegt.
Welche Rolle spielt die Literaturrecherche in der Trainingslehre?
Sie stellt sicher, dass der Trainingsplan auf aktuellen sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und fundierten Trainingsprinzipien basiert.
- Quote paper
- Elena Maier (Author), 2017, Trainingslehre. Erstellen eines Trainingsplans mit Diagnose, Krafttestung und Trainingsplanung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370358