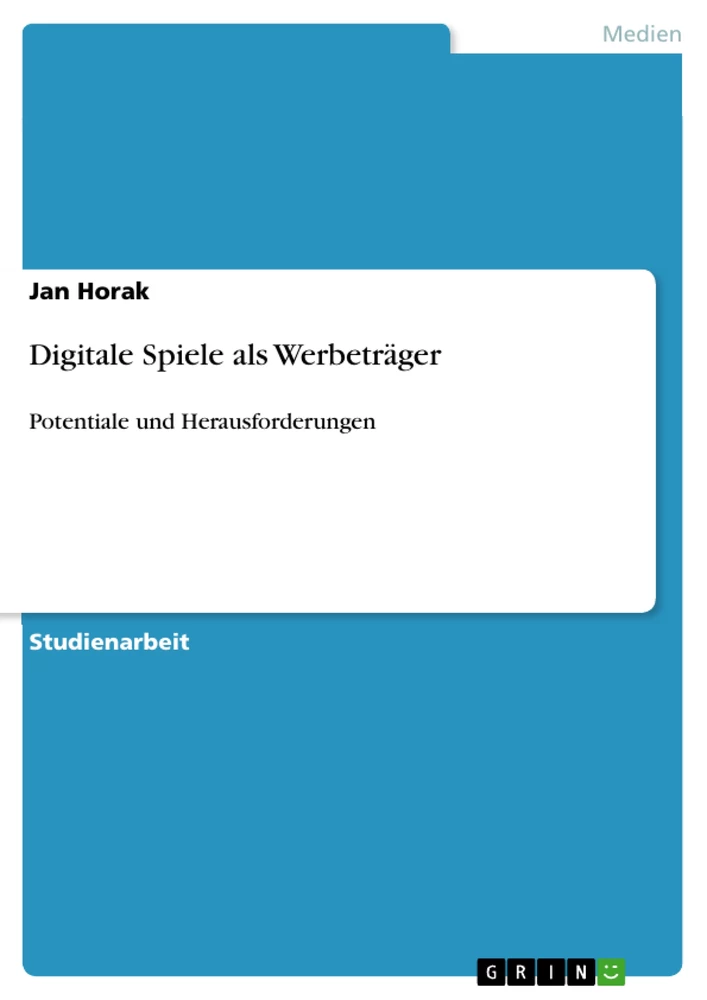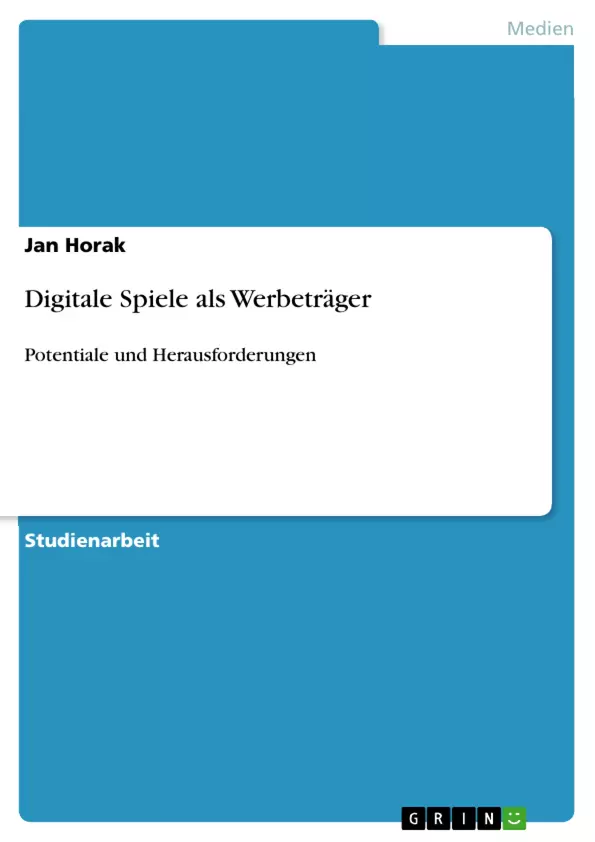Film, Fernsehen, Radio – Unterhaltungsmedien werden stets auch als Werbeträ-ger genutzt. Auch in Computer- und Videospielen findet sich Produktwerbung, und das schon seit Jahrzehnten (vgl. Advertising Lab: History of In-Game Adver-tising and Advergames). Ebenjene Spiele haben in den letzten Jahren einen re-gelrechten Boom erfahren: Die sich rasant Technik entwickelnde Technik ermög-licht immer realistischere Spielerlebnisse, die Nutzerzahlen steigen und die Spieleindustrie vermeldet ungebremstes Wachstum. Die Annahme liegt nahe, dass sich Computer- und Videospiele auch als Werbeträger wachsender Beliebt-heit erfreuen – dies ist jedoch nur eingeschränkt der Fall. Zwar steigen die Wer-beaufwendungen für dieses interaktive Medium stetig an, die Ausgaben liegen jedoch immer noch weit hinter jenen für Film und Fernsehen und bilden weder die Marktverhältnisse noch die Werbepotentiale interaktiver Unterhaltungssoftware adäquat ab (vgl. Stammermann/Thomas 2007: 15ff). Auch in aktuellen wis-senschaftlichen Übersichtsbeiträgen zum Werbemarkt (vgl. u.a. Heffler/Moebus 2011) und in Praxisratgebern für die Mediaplanung (vgl. u.a. Hofsäss 2006) spielt Ingame-Advertising in der Regel bisher keine Rolle. Im Rahmen dieser Arbeit sollen zum einen die Stärken und Potentiale digitaler Spiele als Werbeträger dar-gestellt werden. Zum anderen wird aufgezeigt, welche Herausforderungen das Medium Computer- bzw. Videospiel für die Praxis der Mediaplanung birgt und wie diesen begegnet werden kann. Abschließend werden ausgewählte empirische Befunde zur Wirkung von Ingame-Advertising präsentiert, um die vorange-gangenen Ausführungen qualitativ einordnen und bewerten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung, Eingrenzung und Begriffsklärung
- 2. Ingame-Advertising: Chancen und Potentiale
- 2.1 Aktuelle Entwicklungen der Computer- und Videospielindustrie
- 2.2 Befunde der Nutzungsforschung
- 2.3 Wirkungsweisen digitaler Spiele
- 3. Ingame-Advertising: Herausforderungen für die Mediaplanung
- 3.1 Intermediaplanung
- 3.2 Intramediaplanung
- 3.3 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 3.4 Gestaltung und Platzierung
- 4. Ingame-Advertising: Effizienz
- 4.1 Effizienzmessung
- 4.2 Befunde der Wirkungsforschung
- 4.3 Erfolgsbeispiele
- 5. Implikationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Potential und die Herausforderungen von Ingame-Advertising (IGA). Ziel ist es, die Stärken digitaler Spiele als Werbeträger aufzuzeigen und die spezifischen Probleme für die Mediaplanung zu analysieren. Dabei werden Lösungsansätze präsentiert und empirische Befunde zur Wirkung und zum Erfolg von IGA diskutiert.
- Entwicklung der Computer- und Videospielindustrie und deren Nutzerzahlen
- Chancen und Potentiale von Ingame-Advertising
- Herausforderungen der Mediaplanung im Kontext von IGA
- Effizienzmessung und Wirkungsforschung im Bereich Ingame-Advertising
- Erfolgsbeispiele und Implikationen für zukünftige Strategien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung, Eingrenzung und Begriffsklärung: Die Einleitung stellt die Nutzung digitaler Spiele als Werbeträger in den Kontext bestehender Werbemedien wie Film und Fernsehen. Sie konstatiert ein wachsendes, aber im Vergleich zu anderen Medien immer noch unterrepräsentiertes Werbepotential. Der Begriff "digitale Spiele" wird als Oberbegriff für Computer- und Videospiele geklärt, und "Ingame-Advertising" wird als Produktwerbung innerhalb eigenständiger Spiele definiert, im Gegensatz zu reinen Werbespielen ("Advergames"). Die Arbeit konzentriert sich auf den deutschen Markt.
2. Ingame-Advertising: Chancen und Potentiale: Dieses Kapitel beleuchtet die wachsende Bedeutung digitaler Spiele als Unterhaltungsmedium mit heterogener Nutzerschaft und spezifischer Medialität. Die rasante Entwicklung der Spieleindustrie mit hohen Umsatzzahlen und der Ausdifferenzierung von Genres wird hervorgehoben. Die Befunde der Nutzungsforschung zeigen steigende Nutzerzahlen in allen Altersgruppen und eine zunehmende Nutzung digitaler Spiele, besonders in Kombination mit anderen Spielern. Die spezifischen Wirkungsweisen digitaler Spiele, wie Immersion und hohes Involvement, werden als potenziell werbewirksam beschrieben.
3. Ingame-Advertising: Herausforderungen für die Mediaplanung: Trotz des Marktpotentials spielt IGA in der Werbewirtschaft eine geringe Rolle. Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen der Mediaplanung. Die Intermediaplanung muss die Vor- und Nachteile von IGA im Vergleich zu anderen Medien abwägen, insbesondere die Altersstruktur der Nutzer und die begrenzte regionale Ausrichtung. Die Intramediaplanung betrachtet quantitative Aspekte wie Verkaufszahlen, Raubkopien, gemeinsame Nutzung und "Eyeball-Hours", um das Werbepotential einzelner Spiele zu beurteilen. Rechtliche Aspekte wie das Trennungsgebot, Datenschutz und Jugendschutz werden ebenfalls diskutiert. Die Gestaltung und Platzierung von Werbung im Spiel erfordert ein hohes Maß an Kontextualisierung und Fachwissen, um einen optimalen "Fit" zwischen Werbemittel und Spielumgebung zu erreichen. Die Kapitel behandelt die Schwierigkeiten mit der Messung der Sichtbarkeit von Werbemitteln (effektive Größe, Betrachtungswinkel, Betrachtungszeit) und die Herausforderungen bei statischem im Gegensatz zu dynamischem Ingame-Advertising.
4. Ingame-Advertising: Effizienz: Dieses Kapitel widmet sich der Effizienzmessung von IGA, unterscheidet zwischen Werbewirkung und Werbeerfolg und betont die Schwierigkeiten bei der Messung des anteiligen Einflusses von IGA auf den Gesamterfolg. Es werden widersprüchliche Befunde der Wirkungsforschung präsentiert: Einige Studien zeigen hohe Werbewirkung, andere weisen auf eine geringere Erinnerung an Werbung bei aktiven Spielern im Vergleich zu passiven Beobachtern hin. Die Rolle von impliziten Werbeeffekten und die Akzeptanz von IGA durch Spieler werden diskutiert. Erfolgsbeispiele wie "ORF Ski Challenge" und "Second Life" werden als Illustration für die Möglichkeiten und Herausforderungen von IGA präsentiert, wobei der letztgenannte Fall auch den Aspekt des abnehmenden Interesses zeigt.
Schlüsselwörter
Ingame-Advertising, Digitale Spiele, Mediaplanung, Werbewirkung, Werbeerfolg, Nutzungsforschung, Immersion, Interaktivität, Rechtliche Rahmenbedingungen, Zielgruppenforschung, Effizienzmessung, Marktpotential, Crossmediale Vermarktung, Dynamisches IGA, Statisches IGA, Product Placement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Ingame-Advertising: Chancen, Herausforderungen und Effizienz"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Potential und die Herausforderungen von Ingame-Advertising (IGA), also Werbung innerhalb von Computerspielen. Sie analysiert die Stärken digitaler Spiele als Werbeträger und die spezifischen Probleme der Mediaplanung im Kontext von IGA. Lösungsansätze werden präsentiert und empirische Befunde zur Wirkung und zum Erfolg von IGA diskutiert. Der Fokus liegt auf dem deutschen Markt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Entwicklung der Computer- und Videospielindustrie, die Chancen und Potentiale von IGA, die Herausforderungen der Mediaplanung (Inter- und Intramediaplanung, rechtliche Rahmenbedingungen, Gestaltung und Platzierung), die Effizienzmessung von IGA, die Befunde der Wirkungsforschung, Erfolgsbeispiele und Implikationen für zukünftige Strategien. Es werden sowohl statisches als auch dynamisches Ingame-Advertising betrachtet.
Welche Herausforderungen für die Mediaplanung werden im Detail betrachtet?
Die Herausforderungen umfassen die Intermediaplanung (Vergleich mit anderen Medien, Altersstruktur der Nutzer, regionale Ausrichtung), die Intramediaplanung (Verkaufszahlen, Raubkopien, gemeinsame Nutzung, "Eyeball-Hours"), rechtliche Aspekte (Trennungsgebot, Datenschutz, Jugendschutz), die Gestaltung und Platzierung der Werbung im Spiel (Kontextualisierung, "Fit" zwischen Werbemittel und Spielumgebung), die Messung der Sichtbarkeit von Werbemitteln (Größe, Winkel, Betrachtungszeit) und die Unterschiede zwischen statischem und dynamischem IGA.
Wie wird die Effizienz von Ingame-Advertising gemessen?
Die Arbeit diskutiert die Schwierigkeiten bei der Effizienzmessung von IGA und unterscheidet zwischen Werbewirkung und Werbeerfolg. Sie präsentiert widersprüchliche Befunde der Wirkungsforschung, die sowohl hohe Werbewirkung als auch geringere Erinnerung an Werbung bei aktiven Spielern im Vergleich zu passiven Beobachtern zeigen. Die Rolle impliziter Werbeeffekte und die Akzeptanz von IGA durch Spieler werden ebenfalls analysiert.
Welche Erfolgsbeispiele werden genannt?
Als Beispiele für erfolgreiche IGA-Kampagnen werden "ORF Ski Challenge" und "Second Life" genannt. "Second Life" illustriert dabei auch die Herausforderungen und den potenziellen Rückgang des Interesses an IGA im Laufe der Zeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Ingame-Advertising, Digitale Spiele, Mediaplanung, Werbewirkung, Werbeerfolg, Nutzungsforschung, Immersion, Interaktivität, Rechtliche Rahmenbedingungen, Zielgruppenforschung, Effizienzmessung, Marktpotential, Crossmediale Vermarktung, Dynamisches IGA, Statisches IGA, Product Placement.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einführung, Eingrenzung und Begriffsklärung; 2. Ingame-Advertising: Chancen und Potentiale; 3. Ingame-Advertising: Herausforderungen für die Mediaplanung; 4. Ingame-Advertising: Effizienz; 5. Implikationen. Jedes Kapitel wird in der Arbeit zusammenfassend beschrieben.
Für welche Zielgruppe ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit richtet sich an Personen, die sich akademisch mit dem Thema Ingame-Advertising auseinandersetzen möchten. Sie ist für Studierende, Wissenschaftler und Fachleute in der Werbebranche relevant, die sich für die Möglichkeiten und Herausforderungen von Werbung in digitalen Spielen interessieren.
- Citation du texte
- Jan Horak (Auteur), 2011, Digitale Spiele als Werbeträger, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189678