Excerpt
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Traumaforschung
1.1 Begriffsdefinition
1.2 Dissoziation
1.3 PTSD und ASD
1.4 Faktoren für intensivierte Traumareaktion
2. Deborah Layton
2.1 Transgenerationelles Schweigen und andere Trigger
2.2 Kurzer Abriss der Mitgliedschaft im Volkstempel
2.3 Kritikfähigkeit – The Secret Compartment
2.4 Trauma und Narration
2.4.1 Missbrauch
2.4.2 Zeitlichkeit und Traumaästhetik
2.4.3 Traumatherapie – Aufdeckung und Integration von Trauma durch Versprachlichung
2.5 Seductive Poison – (apokalyptischer) Selbstmord im Kontext von Traumatisierung
3. Amnestische Inseln – abschließende Betrachtungen
Literaturverzeichnis
Einleitung
[…] I could have written it myself had I been there. The letter shows so clearly the state of mind of a person who cannot for a moment think for herself. Sweet Annie was an innocent, who never gained back the ability to reason, who, over the seven years of her involvement, like me, could only deny reality and idealize the person who demanded, then took, her life.[1]
Zwanzig Jahre nach dem Massen(selbst)mord der neureligiösen Gruppierung Peoples Temple[2] um Pfarrer Jim Jones veröffentlicht Deborah Layton, jahrelanges Mitglied der Gemeinschaft, ihre Autobiographie. Sie ermöglicht der Welt damit nicht nur einen detaillierten Einblick in den Auf- wie Abstieg des Volkstempels, sondern präsentiert mit Seductive Poison[3] quasi ihre eigene, selbstständige Traumatherapie.[4] Gemeint ist damit, dass sie durch die Verschriftlichung ihres Lebens sich gleichsam gezwungen sieht, dieses aufzuarbeiten, um es überhaupt in Worte fassen zu können. Ihr „arduous project“ zwang sie „to go deeper into the darkness than [she] thought [she] could”[5], ebenso wie es sie zwang, sich mit den Dämonen ihrer Alpträume auseinanderzusetzen.[6] Sie selbst bezeichnet diese Aufgabe, d.h. in die Schatten ihrer Vergangenheit abzusteigen[7], als zeitweise nahezu „overwhelming.“[8] Denn „tormenting shame and guilt“ hatte sie über Jahre hinweg zum Schweigen gebracht.[9]
Woher die Schuld? Woher kommt die Scham? Und wieso empfindet die Autorin den Prozess des Schreibens als so überwältigend und abgrundtief? Die Antwort auf diese Fragen liegt in einer Auseinandersetzung mit dem Thema des Traumas, d.h. mit Traumatisierung und ihren Folgeerscheinungen, begründet: Laytons Biographie zeugt nicht nur inhaltlich, sondern auch sprachlich, ja sogar in ihrer Struktur von stark traumatisierenden Erfahrungen, die die Autorin, sei es am eigenen Leib als auch als Zeugin erlebt hat. Die vorliegende Arbeit wird sich im Folgenden also mit dem Begriff des Traumas sowie dem aktuellen Stand der Traumaforschung befassen. Darüber hinaus gilt es, Deborah Laytons Biographie inhaltlich, sprachlich und strukturell nach Merkmalen von Traumatisierung zu untersuchen, wobei darauf geachtet werden soll, ob sich, sozusagen Trauma-bedingt, womöglich eine ganz spezifische Poetik herauskristallisiert.
1. Traumaforschung
1.1 Begriffsdefinition
Ursprünglich stammt das Wort Trauma aus dem Griechischen und bedeutet Wunde. Oft gebraucht man den Begriff des Traumas auch im populären Sinne als Metapher für psychische Narben oder mentale Wunden.[10] In der Traumaforschung spricht man dagegen von einer traumatischen Situation, wenn diese als unerträglich empfunden wird, das individuelle Integrationsvermögen sprengt und dem körperlichen oder seelischen Tod sehr nahe kommt.[11] Es handelt sich um ein Ereignis, das sprachlich nicht mehr fassbar ist und sich an jeglicher Kommunizierbarkeit vorbei entwickelt.[12]
Die hier betroffenen Menschen erleben eine Extremsituation. Eine Situation, auf die sie nicht angemessen vorbereitet sind und die all ihre Bewältigungsmechanismen überfordert. Dies nennen wir in der Psychotraumatologie eine „Überflutung mit aversiven Reizen“.[13]
Ein Trauma ist eine den Organismus komplett überfordernde Belastungssituation. „Die Begriffe Trauma, Extrembelastung, exzessiver Stress und Traumatisierung werden [dabei] synonym verwendet.“[14] Es kommt einem „Anschlag auf die Identität des Menschen“ gleich.[15] Diese Situation kann selbst, das heißt als Opfer bzw. Betroffener erlebt werden, als Zeuge, aber auch als Täter.[16] Eine solche Situation wird dann als Trauma empfunden und vom Gehirn als solches abgespeichert, wenn die s.g. Flight or Fight Reaktion nicht mehr stattfinden kann. Was dann bleibt, im Sinne von no Flight no Fight, um der äußersten Bedrohung, nämlich der Auflösung des Selbst, zu entkommen, entspricht der Reaktion von Freeze and Fragment.[17] „Und vom Moment der Freeze-Reaktion an ist klar: Jetzt findet für den Menschen ein Trauma statt.“[18] Das hier metaphorische Einfrieren steht für die Lähmungsreaktion, die dafür sorgt, dass der Organismus sich innerlich vom Geschehen distanzieren kann. Es handelt sich quasi um ein geistiges Wegtreten; das, was physisch nicht mehr möglich ist, geschieht psychisch. Neurologisch wird diese Reaktion unterstützt, indem eine Reihe von Prozessen im Gehirn abläuft, bei denen unter anderem eine Flut von Endorphinen ausgeschüttet wird. Noradrenalin, das normalerweise die Fluchtreaktion hätte unterstützen können, hilft nun, die integrative Wahrnehmung zu blockieren. Freeze bedeutet letztendlich die Entfremdung vom Geschehen.[19] Hinzu kommt die Reaktion des Zersplitterns. Das Erlebte wird fragmentiert, sodass das äußere Ereignis nicht mehr als zusammenhängend wahrgenommen werden kann. Michaela Huber erläutert dies mit dem Bild eines zersplitterten Spiegels: Die Spiegelsplitter lassen nicht mehr erkennen „was passiert ist, sondern nur noch dass etwas passiert ist.“[20] Die in dieser peritraumatischen Situation ablaufenden Prozesse und Reaktionen sichern das physische wie psychische Überleben des Individuums auf Kosten der Integrität des Selbst. Integrität, Assoziationsfähigkeit, letztlich alle höheren Selbstfunktionen, können in der peritraumatischen Situation nicht aufrechterhalten werden, ohne das Überleben zu gefährden, stattdessen wird auf archaischere, reflexhafte Mechanismen zurückgegriffen. Es entsteht ein Traumagedächtnis, auf evolutionsgeschichtlich älteren Gehirnbereichen gründend, das unabhängig vom biographischen Gedächtnis existiert und letzteres immer wieder durch Intrusionen, Flashbacks und amnestische Lücken irritiert.[21]
1.2 Dissoziation
Der Begriff der Dissoziation nun verdeutlicht die Reaktion des Freeze and Fragment weitergehend, denn die Formen von Dissoziation wie Amnesie, Derealisierung und Depersonalisierung, finden sich bereits in den genannten Reaktionen. Die Amnesie wäre dabei die Folge auf das Zersplittern, nämlich unzugängliches Wissen/Erinnerungen, während Depersonalisierung sowie -realisierung sich in der Entfremdung bzw. Distanzierung zum Geschehen ausdrücken. Konkreter spricht man von Depersonalisierung, wenn das Selbst oder Teile davon nicht mehr adäquat wahrgenommen werden können, Schmerzlosigkeit und „neben sich stehen“ gehören ebenso dazu wie das Gefühl, aus dem Körper herauszutreten. Derealisierung bedeutet dagegen die Umgebung oder Teile davon nicht mehr adäquat wahrzunehmen. Weitere Formen bzw. Folgen der Dissoziation sind Fugue, d.h. sich an einem Ort wiederzufinden, ohne sich erinnern zu können, wie man dort angelangt ist und die dissoziative Persönlichkeitsstörung, bei der ein oder mehrere Persönlichkeitszustände die Kontrolle über Körper und Bewusstsein übernehmen.[22] „Jede einzelne Form von Dissoziation tritt häufiger unter Stress auf. Je mehr Stress, desto mehr Dissoziation. “[23] In einer traumatisierenden Situation, die, wie oben beschrieben, als extreme Stressreaktion verstanden werden muss, arbeitet der Mechanismus der Dissoziation dementsprechend stark und entspricht letztlich dem Traumaabwehrmechanismus schlechthin.
Man könnte also bereits in der direkten, d.h. peritraumatischen Situation von ersten dissoziativen Prozessen sprechen. Tatsächlich würde man Derealisierung und -personalisierung, ebenso wie Amnesie, Fugue und die dissoziative Persönlichkeitsstörung, zu den post traumatischen Belastungsstörungen rechnen.
1.3 PTSD und ASD
Die Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung ist relativ neu. Bereits nach dem ersten Weltkrieg ließen sich bei ehemaligen Soldaten Trauma bedingte Symptome, darunter besonders bekannt das "Kriegszittern", feststellen. Freud deutete diese noch als Kriegsneurose, ausgelöst durch einen intrapsychischen Konflikt des Ichs.[24] Erst oder vor allem die Beobachtung psychischer Symptome von Vietnam-Veteranen konnte erheblich zur Erkenntnis und Klassifizierung von p ost t raumatic s tress d isorder (PTSD) beitragen. Hierzu gehören die oben bereits genannten dissoziativen Symptome sowie vor allem Konstriktion, Intrusion und Überregung. Konstriktion beinhaltet die Vermeidung aller Reize, die mit dem Trauma zu tun haben, also eine ungewollte Erinnerung produzieren bzw. triggern könnten.[25] Auch die Einengung der Vitalität und des Verhaltens zählen zur Konstriktion. Intrusion bezieht sich auf das ständige Wiedererleben von einzelnen abgespaltenen Teilerinnerungen bis hin zu Flashbacks. Die Intensität solcher Wiedererlebenssequenzen kann dabei das aktuelle Wahrnehmen komplett überdecken. Es kann zu einer doppelten Wahrnehmung oder einem kompletten Wegtreten inklusive sensorischer Reize (bspw. akustischer oder olfaktorischer Art) kommen. Auch nächtliche Alpträume zählen zu dieser Störungsform. Überregung dagegen bezieht sich auf eine überhöhte Aufmerksamkeit, Schreckhaftigkeit bis hin zu hysterischen und paranoiden Reaktionen insbesondere auf (bereits kleine) Reize, die in assoziative Verbindung zum Trauma gebracht werden können. Auch Konzentrations- und Leistungsstörungen können als PTSD auftreten, ebenso wie Gefühle von Empfindungslosigkeit, Einsamkeit, Entfremdung von Nahestehenden, Kontaktunwilligkeit u.a.[26]
Neben dem nachträglichen Auftreten, also der post-traumatischen Belastungsreaktion/-störung, unterscheidet man auch die ASD (a cute s tress d isorder, was im Deutschen der akuten Belastungsreaktion entspricht). Es handelt sich hierbei um die unmittelbaren Folgen auf das Trauma, wie Verstörung, Durcheinandersein, Fühllosigkeit oder starke Schmerzen, wobei ein Zustand in den anderen kippen kann, sensorische Wahrnehmungslosigkeit, Verlust der raum-zeitlichen Einordnungsfähigkeit bis hin zu Amnesie u.a. Körper und Seele setzen sich damit auseinander, das Geschehen einerseits begreifen, d.h. integrieren zu wollen und sich andererseits zu schonen, indem die Traumaerinnerung von sich geschoben wird.[27]
1.4 Faktoren für intensivierte Traumareaktion
Michaela Hubers Tabelle zu „Ereignisse[n], nach denen besonders schwere Traumareaktionen zu erwarten sind“[28], soll hier übernommen werden, da viele der genannten Faktoren ein interessantes Licht auf Deborah Laytons Situation im Volkstempel werfen.
Es handelt sich um Ereignisse folgender Merkmale:
1. Sie dauern sehr lange;
2. wiederholen sich häufig;
3. lassen das Opfer mit schweren körperlichen Verletzungen zurück;
4. sind vom Opfer schwer zu verstehen;
5. beinhalten zwischenmenschliche Gewalt.
6. Der Täter ist ein nahestehender Mensch;
7. das Opfer mochte (mag) den Täter;
8. das Opfer fühlt sich mitschuldig;
9. die Persönlichkeit ist noch nicht gefestigt oder gestört.
10. Sie beinhalten sexuelle Gewalt;
11. und / oder sadistische Folter.
12. Mehrere Täter haben das Opfer zugerichtet;
13. das Opfer hatte starke Dissoziationen;
14. niemand hat dem Opfer unmittelbar danach beigestanden;
15. niemand hat nach der Tat mit dem Opfer darüber gesprochen.[29]
[...]
[1] Layton, Deborah, Seductive Poison, Anchor Books / Doubleday, New York u.a., 1998, S. 301f.
[2] Zu Deutsch Volkstempel.
[3] Ebd.
[4] Inwiefern diese als erfolgreich abgeschlossen betrachtet werden kann, wird weiter unten noch zur Diskussion stehen.
[5] Ebd., S. 306.
[6] Ebd.
[7] Ebd.
[8] Ebd.
[9] Ebd.
[10] Luckhurst, Roger, The Trauma Question, Routledge, USA (New York) und Kanada, 2008, S. 2f.
[11] Huber, Michaela, Trauma und die Folgen, Junfermann, Paderborn, 2005, S. 22.
[12] Zitiert nach ebd., S. 37.
[13] Ebd., S. 40.
[14] Ebd., S. 34.
[15] Ebd., S. 68.
[16] Ebd.
[17] Vgl. hierzu ebd. S. 43.
[18] Ebd.
[19] Vgl., ebd.
[20] Ebd., S. 43f. Zur Stressverarbeitung im limbischen System vgl. ebd., S. 44-51.
[21] Vgl. ebd., S. 67.
[22] Vgl. ebd., S. 56f.
[23] Ebd., S. 57.
[24] Vgl. Vees-Gulani, Susanne, Trauma and Guilt, Walter de Gruyter, Berlin und New York, 2003, S. 15.
[25] In Bezug auf assoziative Verbindungen auslösende Reize spricht man allgemeinhin auch von sogenannten Triggern, bzw. Reizen, die etwas auslösen d.h. triggern (abgeleitet vom Englischen to trigger).
[26] Vgl. Huber, Michaela, Trauma und die Folgen, a. a. O., S. 74. Vgl. auch ebd., S. 69f.
[27] Vgl. ebd., S. 69.
[28] Ebd., S. 75.
[29] Vgl. ebd.
- Quote paper
- Laura Gemsemer (Author), 2010, Traumaästhetik in "Deborah Laytons Seductive Poison - A Jonestown Survivor`s Story of Life and Death in the Peoples Temple" , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158802
Publish now - it's free
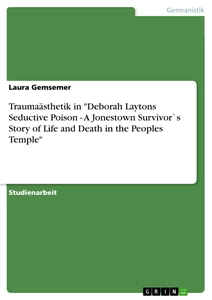
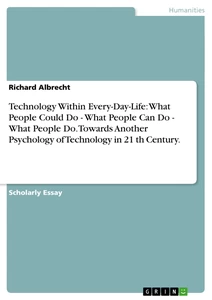


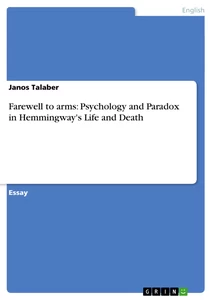
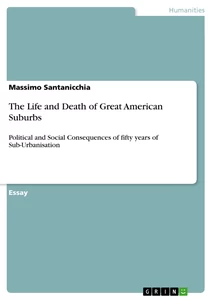

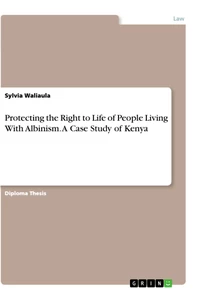
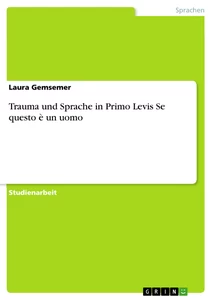
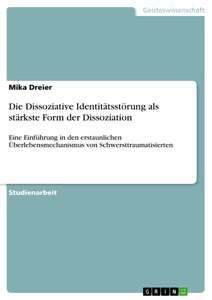
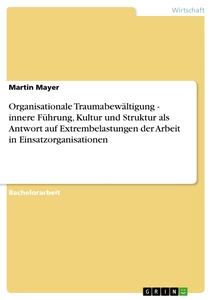

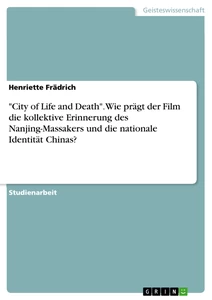
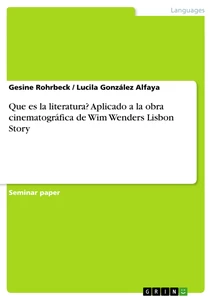
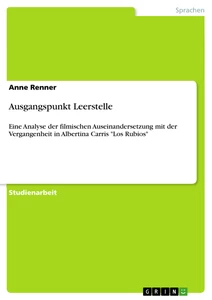




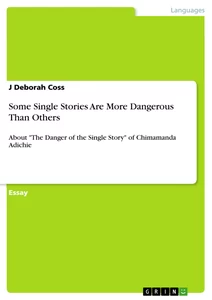
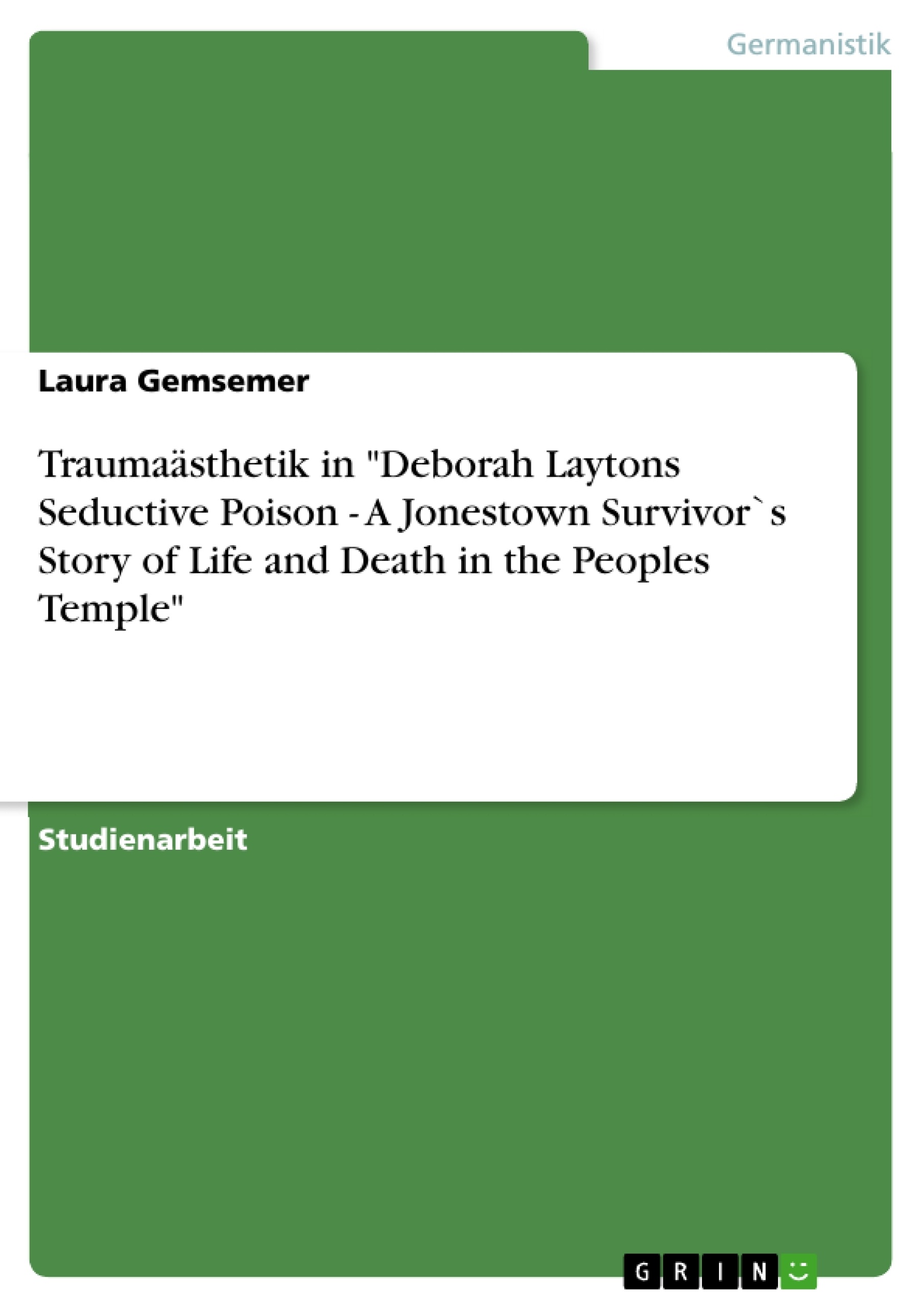

Comments