Leseprobe
Gliederung
1.0 Einleitung
2.0 Sprachpolitik
2.1 Sprache als Menschenrecht
2.2 Sprachplanung
2.3 Möglichkeiten und Grenzen von Sprachplanung
3.0 Sprachplanung auf Europäischer Ebene
3.1 Definitionsproblematik „Minderheit“
3.2 Das „Sprachenproblem“ der EU
4.0 Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
4.1 Die Struktur der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
4.2 Vor- und Nachteile der Struktur
4.3 Die Sonderrolle von Dialekten und Migrantensprachen
5.0 Die geschützten Sprachen in Deutschland
5.1 Dänisch
5.2 Friesisch
5.3 Sorbisch
5.4 Romanes
5.5 Niederdeutsch
6.0 Die Umsetzung der Charta in Deutschland
6.1 Sprachplanerischer Wert der Maßnahmen in den einzelnen Gebrauchsdomänen
6.2 Konkrete Maßnahmen
6.2.1 Umsetzung in den Sprachen Dänisch, Friesisch, Sorbisch und Niederdeutsch
6.2.2 Der Sonderfall Romanes
6.3 Stellungnahmen der Minderheitenvertreter
7.0 Fazit
Anhang 1: European Charter for regional or minority languages
Anhang 2: Auszüge aus dem Bundesgesetzblatt
Anhang 3: Sprachgebiet der deutsch-dänischen Minderheiten
Anhang 4: Sprachgebiet des Friesischen
Anhang 5: Sprachgebiet des Sorbischen
Anhang 6: Sprachgebiet des Niederdeutschen
Literatur
Internetquellen
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.0 Einleitung
Die Europäische Kommission hat als Motto für das Jahr 2008 das „Jahr des Interkulturellen Dialogs“ angenommen. In diesem Zusammenhang wurde auf Wunsch von Kommissionspräsident José Manuel Barroso und Leonard Orban, Kommissar für Mehrsprachigkeit, ein Gremium gebildet, dass sie hinsichtlich des Beitrages den Mehrsprachigkeit zum interkulturellen Dialog leisten kann beraten soll. Ausgangsgedanke der Arbeit dieser Arbeitsgruppe war folgende Annahme:
„Für jede Gesellschaft bringt die sprachliche, kulturelle, ethnische oder religiöse Vielfalt zugleich Vorteile und Nachteile mit sich, sie ist eine Quelle von Reichtum, aber auch von Spannungen. Es zeugt von Klugheit, die Komplexität dieses Phänomens zu Kenntnis zu nehmen und sich gleichzeitig darum zu bemühen seine positiven Auswirkungen zu verstärken und seine negativen so gering wie möglich zu halten. […] Wenn auch die Mehrzahl der europäischen Nationen auf der Basis ihrer identitätsstifenden Sprache begründet wurde, so kann sich die Europäische Union nur auf ihre Sprachenvielfalt gründen. […] Geboren aus dem Willen ihrer verschiedenen Völker, die aus freien Stücken die Wahl getroffen haben, sich zu vereinen, ist die Europäische Union weder berufen, noch imstande, ihre Vielfalt auszulöschen.“ (Maalouf 2008: 4-6).
Die sprachliche Vielgestaltigkeit in Europa manifestiert sich nicht nur in den vielen Nationalsprachen die auf europäischem Boden gesprochen werden. In nahezu jedem Land existieren darüber hinaus auch Minderheiten, die eigene, von der jeweiligen Nationalsprache klar abgrenzbare Sprachen sprechen. Viele dieser Minderheitensprachen sind vom Aussterben bedroht, da die Bedrohung von Sprachen bis hin zum Sprachtod zumeist in bi- oder multilingualen Kontexten auftritt, in denen eine „Mehrheitssprache“ den Nutzungsbereich und die Funktionalität einer Minderheitensprache ersetzt und letztere damit verdrängt (vgl. May 2000: 366). Fest steht, dass mit jeder verschwindenden Sprache Quellen spezifischer Sichtweisen und Ideen unwiederbringlich verloren gehen (vgl. Bußmann 2002: 630).
Die große Bedeutung die Sprache als Kommunikationsmittel für den Menschen hat, macht deutlich, dass der wissenschaftliche Umgang mit ihr nur durch interdisziplinäre Behandlung zufrieden stellend erfüllt werden kann. Gerade Maßnahmen zum Schutz vom Aussterben bedrohter Sprachen verlangen die Kooperation mit anderen Disziplinen (vgl. Coulmas 1985: 3). Lange Zeit galt es in den europäischen Staaten als politische Zielsetzung, die Minderheiten im eigenen Staat zu assimilieren. Nur langsam etablierte sich in Europa das Bewusstsein, dass es sich bei den vielen Regional- und Minderheitensprachen auf europäischem Gebiet um wertvolle Güter handelt, deren Schutz und Förderung nicht nur zur so häufig zitierten kulturellen Vielfalt sondern auch zum inneren wie äußeren Frieden beitragen. Eine realistische Integrationspolitik, die Kulturautonomie und den Gebrauch „eigener“ Sprachen für Minderheiten möglich macht ist mittlerweile zu einem Hauptanliegen der EU geworden (vgl. Blumenwitz 1996: 159).
Eine Möglichkeit, Sprachenschutz in politische Prozesse einzubinden, ist die Formulierung und Ratifizierung von verbindlichen Verträgen, die die ratifizierenden Staaten zu Schutzmaßnahmen zugunsten „kleiner“ Sprachen verpflichten.
Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, die 1992 zur Zeichnung aufgelegt wurde, gilt als eine der wichtigsten und am meisten Erfolg versprechenden sprachpolitischen Maßnahmen, die das Vertragswerk der EU bietet. Ob dem Anspruch, zum Schutz bedrohter Sprachen zu gereichen, genüge getan werden kann, soll im Folgenden herausgearbeitet werden.
Um diese Frage zu beantworten werden in den ersten drei Kapiteln die notwendigen theoretischen Grundlagen skizziert um im Anschluss ausführlich darzustellen ob eine zufrieden stellende Umsetzung durch Ausschöpfung der gegebenen Möglichkeiten gewährleistet werden kann. Auf mögliche Modelle, Ziele und Grenzen von Sprachplanung sowie die Betrachtung des Rechts auf Gebrauch der Muttersprache als allgemeingültiges Menschenrecht im Sinne der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (VN) wird in Kapitel 1 eingegangen.
Da die einschlägige Literatur bisher keine einheitliche Definition des Begriffes „Minderheitensprachen“ bietet, wird in Kapitel 2 die aus diesem Mangel resultierende Problematik verdeutlicht und eine Definition für den umstrittenen Begriff „Minderheit“ vorgeschlagen. Weiterhin werden der Zusammenhang zwischen Sprache, Nation und Identität sowie Grundzüge europäischer Bemühungen um den Schutz von Minderheiten dargelegt. Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen bietet ein Beispiel für ein umfassendes sprachplanerisches Vertragswerk; ihre Struktur und die damit in Zusammenhang stehenden Vor- und Nachteile werden in Kapitel 3 erläutert. Weiterhin ist Kapitel 3 mit dem Ausschluss von Dialekten und Migrantensprachen welche per definitionem keine Berücksichtigung durch die Charta finden sollen, befasst.
Ein erster Schritt der Umsetzung eines solchen Vertragswerks ist die Auswahl der Sprachen, die in einem Staat besonderen Schutz erfahren sollen.
In Kapitel 4 werden daher die fünf in Deutschland geschützten Sprachen - Dänisch, Friesisch, Sorbisch, Romanes und Niederdeutsch - ausführlich charakterisiert, typologisch eingeordnet und darüber hinaus wird untersucht, warum diese Sprachen Anspruch auf Anerkennung als Minderheitensprachen haben. Eine Bewertung der Charta unter sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten verlangt darüber hinaus eine Analyse des sprachplanerischen Wertes der Schutzmaßnahmen in den einzelnen Domänen die durch die Charta betroffen sind. Diese erfolgt zu Anfang von Kapitel 5. Weiterführend werden konkrete Umsetzungen der Bundesrepublik Deutschland aufgezeigt. Da sich für die Sprache Romanes in der Umsetzung der Charta Schwierigkeiten durch Vorbehalte von Seiten der Sprecher ergeben, wird die Umsetzung in diesem Fall gesondert betrachtet. Weiterhin werden ergänzend Stellungnahmen von Repräsentanten der einzelnen Regional- oder Minderheitensprache berücksichtigt.
Abschließend soll die Frage geklärt werden, ob die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen die notwendigen Voraussetzungen bietet, um den Erhalt bedrohter Sprachen zu ermöglichen.
2.0 Sprachpolitik
Vor der Betrachtung einer konkreten sprachpolitischen Maßnahme ist es sinnvoll den Begriff „Sprachpolitik“ zu bestimmen und die Tätigkeitsfelder, Ziele und Möglichkeiten der Sprachpolitik zu umreißen. Sprachpolitik ist zu verstehen als ein Teilgebiet der Soziolinguistik, die wiederum für sich genommen eine Disziplin der angewandten Sprachwissenschaft darstellt. Gegenstand der Soziolinguistik ist die soziale Bedeutung eines Sprachsystems und dessen Gebrauch (vgl. Dittmar 1997: 20f). Daher sind weniger die sprachinternen Faktoren relevante Forschungsgegenstände, sondern Ziel ist, Erklärungen oder Lösungen für Probleme zu finden, die sich für eine Sprache in Kontexten ergeben, die durch externe Faktoren bestimmt werden (vgl. Bußmann 2002: 640f).
So versteht sich Sprachpolitik als Gegenstand interdisziplinärer Forschungen an der sich So]ziologie Ethnologie Geschichte und Politikwissenschaft und allen voran natürlich die Linguistik beteiligen (vgl. Bochmann 1993: 3).
Der gesellschaftswissenschaftliche Eingriff in die sprachlichen Belange einer Gesellschaft umfasst verschiedene Aspekte, z.B. Sprachgesetzgebung, Normenfestschreibung Entlehnungs- und Fremdwörterpolitik sowie Muttersprachen- und Fremdsprachenerziehung (vgl. Bochmann 1993: 3). Nicht eingegangen wird hier auf die Unterscheidung zwischen Sprachpolitik und Sprachenpolitik die in dieser Differenzierung der Begrifflichkeit ohnehin ein Phänomen zu sein scheint, das nur in der deutschen Sprache existiert und die für den vorliegenden Kontext nicht von Bedeutung ist (vgl. Witt 2001: 23). Die dieser Arbeit zu Grunde gelegte Definition lässt sich zudem auf beide Ausdrücke anwenden (Stark 1996 zitiert nach Witt 2001:26):
(1) Sprach[…]politik ist bewusste und planmäßige Einflussnahme von Regierungen oder gesellschaftlichen Machtgruppen auf die Entwicklung und die Stellung von Sprachen innerhalb und außerhalb des eigenen Territoriums […].
Die Grundlagen und Erkenntnisse, die für eine erfolgreiche Sprachpolitik notwendig sind, liefern Daten aus der Sprachplanung. Die beiden Begriffe Sprachplanung und Sprachpolitik werden häufig synonym verwendet, wobei sich erstere eher auf den Prozess der Planung bezieht, letztere dagegen eher zielorientiert zu verstehen ist (vgl. Cooper 1989:29).
Eine Theorie der Sprachpolitik erleichtert es, Zusammenhänge zwischen den einzelnen sprachpolitischen Erscheinungsformen her- und darzustellen. Als Beispiele seien hier die Behandlung von Minderheitensprachen, sprachliche Aspekte von Medienpolitik oder auch das Verhalten der Gesellschaft zur Standardnorm genannt (vgl. Bochmann 1993: 5). Vor allem in multilingualen Situationen innerhalb eingegrenzter Staatsgebiete ergeben sich sprachbedingte Probleme, die eine Entscheidung für eine Sprache in Politik, Bildung und Gesellschaft notwendig machen. Daraus resultiert eine Benachteiligung anderer auf dem Staatsgebiet genutzter Sprachen. Aufgabe der Sprachplanung ist die Identifikation solcher Probleme und der Teile der Gesellschaft, für die dieses Problem besteht sowie die Suche nach der bestmöglichen Lösung. Gleichfalls gehören aber Modernisierung und Standardisierung von Lexikon, Grammatik und Aussprache zu den Aufgaben von Sprachplanern. Der Begriff der Sprachplanung sollte jedoch nicht auf linguistische Phänomene beschränkt werden sondern auch die soziopolitische Motivation berücksichtigen hängen doch die sprachlichen Probleme zumeist mit sozialen Belangen zusammen (vgl. Rubin 1984: 4f).
Als explizit sprachpolitische Ziele können Veränderungen auf drei verschiedenen Ebenen genannt werden: Auf gesellschaftlicher Ebene können durch gezielte Maßnahmen die sprachliche Kompetenz die Performanz und das Prestige einer Sprache beeinflusst werden. Auf der sprachlichen Ebene sind die Schaffung und Ausarbeitung einer referentiellen Sprachform und die Schaffung von Materialen zur Vermittlung dieser Sprachform primäre Ziele. Auf institutioneller Ebene wird der Status einer Sprache manifestiert (vgl. Czernilofsky 2001: 171f). Gerade im Fall von Minderheitensprachen ist Sprachpolitik ein sensibles Feld. Nicht nur dass Sprachpolitik ebenso wie andere Bereiche der Kulturpolitik immer eine Entscheidung der politischen Mehrheit darstellt (vgl. Arnold et al. 2003: 17); auch ist objektives Datenmaterial ebenso selten wie eine wertfreie Einigung darauf, welche Gruppen als Minderheiten zu betrachten sind. Entsprechend sind Konflikte unumgänglich. Die Aufgabe von Sprachplanern erweitert sich somit um die Notwendigkeit, solche Konflikte vorauszusehen und nach Möglichkeit zu vermeiden (vgl. Nelde 2000: 442).
2.1 Sprache als Menschenrecht
Der Menschenrechtsschutz im Allgemeinen ist einer der dynamischsten Prozesse in den friedenssichernden Bestrebungen der Staaten. Noch in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts war der Nationalstaat die höchste wünschenswerte Instanz. Die Gräuel der beiden Weltkriege haben jedoch überdeutlich gezeigt, dass ausschließlich nationale Bemühungen um die Wahrung der Menschenrechte vor allem in Bezug auf Minderheiten bei ungünstiger politischer Konstellation kläglich versagen. Es wird vielmehr ein internationales Gremium benötigt, das die Sicherung der Rechte in seinen Mitgliedstaaten überwacht (vgl. Riedel 2004: 11). Ein solches stellen die VN dar, die sich unter anderem den Schutz von Minderheiten zur Aufgabe gemacht haben Die Akzeptanz von Minderheitensprachen als schützeswertes Recht war schon lange vor den nach dem Zweiten Weltkrieg in internationalen Verträgen festgelegten Menschenrechten immer wieder ein politisch brisantes Thema. Nach den territorialen Gebietsverschiebungen in der Folge des Ersten Weltkrieges gab es vor allem von Seiten der deutschen Delegation Forderungen nach einer Aufnahme von Schutzregelungen für Minderheiten in die Satzung des neu entstandenen Völkerbundes. Diese sollten ein soziales Eigenleben mit besonderem Augenmerk auf Sprache sichern. Durch die Ablehnung von Seiten der Siegermächte fand diese Forderung jedoch keinen Eingang in die Satzung des Völkerbundes(vgl. Oxenknecht 1988: 27). Die massiven Verletzungen der Menschenrechte im Zuge des Zweiten Weltkrieges schürten zwar die Auffassung, dass eine rechtlich verbindliche Festlegung dieser Rechte notwendig sei die Minderheiten jedoch wurden als Teil der Gesamtbevölkerung nicht mehr in besonderer Weise hervorgehoben. 1966 fand der Minderheitenschutz schließlich Eingang in das Vertragswesen der VN. In Art. 27 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte (IPbpR) wird explizit den Minderheiten das Recht auf Ausübung ihres kulturellen Lebens zugesprochen, das auch beinhaltet, sich der eigenen Sprache zu bedienen (BpB 2004: 77).
Häufig werden Minderheitenrechte als eine eigene Kategorie von Rechten angesehen und nicht als in den allgemeinen Menschenrechten implizit betrachtet. Es ist fraglich, ob die Regelungsbereiche der Menschenrechte die Rechte der Minderheiten in vollem Umfang umfassen da sich die Gewährung von Menschenrechten gegenüber den Mehrheiten sehr viel einfacher gestaltet und somit vielfach im alltäglichen Leben als selbstverständlich betrachtet wird (vgl. Oxenknecht 1988: 69).
In der „Charta von Paris über ein neues Europa“ wird dies neben diversen Erwähnungen der Rechte und Schutzbedürftigkeit von nationalen Minderheiten, explizit ausgedrückt (BpB 2004: 453):
(2) Ferner erkennen wir an daß die Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten als Teil der allgemein anerkannten Menschenrechte uneingeschränkt geachtet werden müssen.
Die sprachlichen Rechte von Minderheiten sind heute in internationalen oder europäischen Verträgen verankert, die teilweise bindenden Charakter haben (z.B. die Menschenrechtskonvention). Andere der vertraglichen Dokumente der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und anderer Organisationen erzeugen immerhin eine politische und moralische Verpflichtung (de Varennes 2001: 16).
Wichtig für die Bewertung der Forderung nach der Anerkennung sprachlicher Rechte als universelle Menschenrechte ist die Unterscheidung zwischen der individuellen bzw. privaten Ebene sowie der gemeinschaftlichen bzw. öffentlichen Ebene des Sprachgebrauchs.
Während alle Dokumente, die den Schutz von Minderheiten garantieren sollen, den Gebrauch der eigenen Sprache auf privater Ebene erlauben und eine Reglementierung in diesem Bereich kaum nötig erscheint, da der Sprachgebrauch im privaten Rahmen ohnehin automatisch geschieht, stellt der Schutz von Minderheitensprachen auf öffentlicher Ebene ein weit größeres Problemfeld dar. Ebenfalls von großer Bedeutung ist die Unterscheidung zwischen Gruppenschutz und Individualschutz - während letzterer sich durch die allgemeinen Bestimmungen abdecken lässt (konkret: Gebrauch der Sprache im privaten Bereich) und damit eher eine Passivität des Staates voraussetzt verlangt Gruppenschutz aktive Teilnahme des Staates an der Umsetzung. Er impliziert die Möglichkeit des Aufbaus eines eigenen Bildungswesens oder Mitspracherechte und Repräsentation bei politischen Angelegenheiten - Rechte die unmöglich ohne staatliche Förderung in Anspruch genommen werden können (vgl. Phillipson et al. 1995: 2).
In Bezug auf sprachplanerische Maßnahmen ist daher die Anerkennung von Sprache als universelles Recht des Menschen von großer Bedeutung (Skutnabb-Kangas 2000: xii):
(3) Linguistic human rights are necessary (but not sufficient)
prerequisite for the maintenance of linguistic diversity. Violations of linguistic human rights, especially in education, lead to a reduction of linguistic and cultural diversity on our planet.
Die Kontroverse um die Anerkennung von Sprache als einem der höchsten schützenswerten Rechte der Menschheit macht deutlich, wie notwendig eine umsichtige Behandlung von Sprache in politischen Prozessen ist. Linguistik und Politik können sich zur Bewahrung der weltweiten kulturellen Vielfalt in idealer Weise z.B. durch Sprachplanungsprozesse ergänzen.
2.2 Sprachplanung
Unter Sprachplanung wird ein absichtlich herbeigeführter Sprachwandel verstanden. Sie beginnt mit der Identifikation eines sprachlich bedingten Problems und den gesellschaftlichen Bereichen, die es betrifft (vgl. Rubin 1984: 4). Wesentlich für eine erfolgreiche Sprachpolitik ist es, im Vorfeld zu bedenken, ob die zu lösenden Schwierigkeiten tatsächlich Probleme der Sprache sind, oder aber ob die sprachliche Ausgangssituation eher als symptomatisch für soziale und kulturelle Probleme zu bewerten ist.
Der Begriff der Sprachplanung geht zurück auf Einar Haugen, der 1966 ein Modell mit vier Stadien der Sprachplanung entwickelte (vgl. Haugen 1966: 18-25):
- „Selection of norm“, geschieht durch das Auswählen einer neuen oder die Modifizierung einer alten Form.
- „Codification of form“, beinhaltet die Festlegung von Orthographie, Grammatik, etc.
- „Elaboration of function“ bedeutet eine Ausweitung der sprachlichen Möglichkeiten durch z.B. Innovation von wissenschaftlichen Ausdrücken.
- „Acceptance by the community“, geschieht durch die Umsetzung der Maßnahmen, beispielsweise durch Gebrauch der neuen Normen in Publikationen.
Dieses Modell ist noch immer weitgehend anerkannt jedoch wurde, erstmalig von Heinz Kloss, eine gewisse Modifizierung vorgenommen und die folgende Unterscheidung von so genannter Status- und Korpusplanung eingeführt:
Ebenso wie sich Sprachen im Laufe der Zeit verändern, ändern sich auch deren Funktionen für die Gesellschaft. Die Anerkennung einer Sprache als offizielle Sprache eines Staates ist der augenscheinlichste Akt von Statusplanung. Als sich beispielsweise Irland 1937 eine von der britischen Krone unabhängige Verfassung gab, wurde das irische Gälisch zur ersten Amtssprac he. Damit erfuhr die indigene Sprache eine enorme Aufwertung. Auch wenn man den Sinn einer solchen Statusveränderung in Frage stellen kann, da in Irland die im Alltag hauptsächlich gebrauchte Sprache nach wie vor Englisch ist, so darf man nicht den Aspekt vernachlässigen, dass die eigene Sprache durchaus als Symbol der Unabhängigkeit und als Ausdruck der eigenen Nation verstanden werden darf. Einer Sprache kann in einem solchen Fall ein starker symbolischer Charakter zugeschrieben werden (vgl. Cooper 1989: 99-101). Einer der am weitesten reichenden statusplanerischen Eingriffe, der auch zur Veränderung der sprachlichen Wirklichkeit führte war die Anerkennung des Französischen in Quebec/Kanada als offizielle Sprache. Obwohl die Frankophonen unter der kanadischen Bevölkerung bei Weitem die Minderheit einnehmen, sind in der Provinz Quebec doch etwa 80% der Bevölkerung französischsprachig. Bis zur Mitte der 1970er Jahre waren nahezu alle wirtschaftlich hohen Positionen dennoch mit anglophonen Personen besetzt. Durch die Anerkennung des Französischen als regionale offizielle Sprache konnten Programme ins Leben gerufen werden, die den Gebrauch des Französischen auch auf wirtschaftlicher Ebene vorantriebenn und somit einen massiven Einfluss auf den Status der Sprache ausübten (vgl. Cooper 1989: 118).
Auf nationaler Ebene kann aber auch eine auf den ersten Blick weniger umfassende Maßnahme wie die Entscheidung, eine Sprache als Schulfach einzuführen, zum Bereich der Statusplanung gezählt werden (vgl. Cooper 1989: 112). Vor allem in Bezug auf Minderheitensprachen ist dieser Zugewinn an Prestige von enormer Wichtigkeit.
Bei den Faktoren der Statusbestimmung oder Statusveränderung in einer Gesellschaft greifen immer politische Entscheidungen rechtliche Bedingungen sowie soziale Vorurteile ineinander. Den Status einer Sprache durch einen bloßen Verwaltungsakt zu verändern, ist unmöglich, solange keine Akzeptanz seitens der Bevölkerung vorhanden ist (vgl. Coulmas 1985: 81).
Korpusplanung hingegen beschäftigt sich mit konkreten Veränderungen der Sprache wie Modifikationen des Lexikons Standardisierung von sprachlichen Elementen oder Kodifizierung von Morphologie und Rechtschreibung (vgl. Clyne 1997: 1). Normen, vor allem neue Normen, werden im Gegensatz zu den natürlich gewachsenen Konventionen zu einem bestimmten Zeitpunkt gesetzt und können nur bestehen, wenn sie von der Sprechergemeinschaft anerkannt werden (vgl. Coulmas 1985: 86). Ein Beispiel für einen korpusplanerischen Eingriff ist die deutsche Rechtschreibreform die sich über Jahre hinzog und mehrere Nachbesserungen erforderte. Der Zustand, der bei Haugen mit „acceptance by the community“ bezeichnet wurde, ist oftmals nur schwer zu erreichen - so stellten einige große deutsche Tageszeitungen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung erst 2007, 11 Jahre nach Beginn der Reform, eher widerwillig auf die neue Rechtschreibung um (vgl. D´Inka 2006).
Um die sprachplanerischen Maßnahmen umzusetzen, wurde das Modell später um eine weitere Dimension erweitert: die Akquisitionsplanung. Dieser Begriff bezeichnet die Maßnahmen, die ergriffen werden, um das jeweilige Ziel des angestrengten Sprachplanungsprozesses zu erreichen. Die Akquisitionsplanung soll Anreize und Möglichkeiten schaffen, sich aktiv am Gebrauch der Sprache zu beteiligen, z.B. durch gezielte Medienpräsenz oder einer Schwerpunktlegung auf Jugend- und auch Erwachsenenbildung in der entsprechenden Sprache. Als Beispiel für eine Region, in der solche Maßnahmen sehr erfolgreich umgesetzt wurden, gelten die Gaeltacht, jene Gebiete Irlands, in denen tatsächlich vorwiegend Gälisch gesprochen wird (vgl. Cooper 1989: 159).
Paulston schlägt zur differenzierten Betrachtung eine Unterscheidung zwischen „language cultivation“ und „language planning“ vor (vgl. Paulston 1983: 55). Dazu haben sich verschiedene Kriterien herausgebildet. Zum einen ist es notwendig die handelnden Instanzen des Sprachplanungsprozesses zu betrachten. Bezüglich der „language cultivation“ sind dies in erster Linie Sprachspezialisten, z.B. Linguisten oder Philologen. Entscheidungen bezüglich des „language planning“ fallen immer von staatlicher Seite, zumindest muss eine Autorisierung von Seiten der Regierung stattgefunden haben. Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist, ob die „eigene“ oder eine „fremde“ Sprache betroffen ist. „Language cultivation“ betrifft in den meisten Fällen die offizielle Landessprache, politische Entscheidungen fallen zumeist bezüglich Zweitsprachen. Man kann argumentieren, dass dieses Kriterium nicht stichhaltig ist. Gerade bei groß angelegten sprachplanerischen Maßnahmen wie der Verschriftlichung einer Sprache müssen aufgrund der Ausgangssituation häufig Sprachspezialisten einer anderen Muttersprache hinzugezogen werden. Ist eine Sprache noch nicht verschriftlicht, muss davon ausgegangen werden, dass deren Sprecher auf die Hilfe von Sprechern anderer Sprachen angewiesen sind, um ein Schriftsystem zu entwickeln und zu etablieren. Dennoch muss man davon ausgehen, dass am Anfang dieses Prozesses stets eine politische Entscheidung steht (vgl. Paulston 1983: 57-59).
Bei einem solchen Beispiel wird deutlich, dass die Trennung von „language cultivation“ und „language planning“ bei weitem nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Vielmehr sind beide Bereiche relativ eng miteinander verwoben, wie das Modell eines sprachplanerischen Prozesses von Paulston zeigt (Paulston 1983: 60):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Sprachplanungsprozess nach Paulston 1983: 60.
(1) bezeichnet die Entscheidung, dass ein Lehrbuch oder Leitfaden zur Sprache notwendig ist, (2) das Beauftragen eines Ausschusses einen solchen vorzubereiten, (3) das Beschließen von Richtlinien und Taktiken für die Erstellung eines solchen. Im Folgenden (4) wird der Leitfaden ausgearbeitet und dann (5) den politischen Entscheidungsträgern präsentiert. Diese müssen dann (6) die Norm im Idealfall wie präsentiert annehmen, damit (7) eine Empfehlung an die umsetzenden Gremien wie Ministerien o.ä. gegeben werden kann, die Umsetzung durchzuführen.
2.3 Möglichkeiten und Grenzen von Sprachplanung
Wie erfolgreich Sprachplanung sein kann, ist umstritten. Viele Linguisten, die sich mit Sprachwandel befassen, sehen Sprachplanung nicht einmal als einen den Sprachwandel beeinflussenden Faktor an. Zudem gibt es viele Stimmen, die Sprachplanung schlicht für überflüssig halten. Nach ihrer Ansicht sind Sprachen natürlich gewachsene, sich selbst regelnde Systeme, die sich ohne Planung den Kommunikationsbedürfnissen der Sprechergemeinschaften anpassen (vgl. Coulmas 1985: 80-84).
Diese Auffassungen vernachlässigen allerdings jene Situationen, in denen Sprachplanung durchaus erfolgreich und sinnvoll eingesetzt werden kann. Ein Beispiel sind jene sprachplanerischen Bemühungen, die Sprachen in Entwicklungsländern zu einer Standardisierung verhelfen die in der Konsequenz Möglichkeiten auf dem Weltmarkt eröffnet, und dadurch aktiv Teil von Entwicklungshilfe sein können. Daneben besitzen auch Maßnahmen wie die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen die auf den ersten Blick keine vergleichbar nennenswerten Veränderungen bewirken, das Potenzial, eine umfassende Förderung und Bewahrung der kulturellen Vielfalt Europas zu ermöglichen. Sprachliche Homogenisierungsversuche hingegen schaffen in aller Regel Kontroversen. Werden „ethnisch definierte Sprachgrenzen als objektive Kategorie“ (Seewann 2003: 5) begriffen, können sich nur noch schwer lösbare Konflikte entwickeln. Eine Unterdrückung sprachlicher Minderheiten, die deren Entwicklungsmöglichkeiten in der Gesellschaft einschränken, ruft Widerstand seitens der Unterdrückten hervor. Über kurz oder lang wird sich ein solches Vorgehen destabilisierend auf den Staat auswirken, so geschehen beispielsweise auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien. Sprachplanerische Maßnahmen die ethnischen oder sprachlichen Minderheiten einen Platz im System zusichern, haben also neben der ohne Zweifel erstrebenswerten Bewahrung des Kulturgutes „Sprache“ auch den positiven Nebeneffekt der Friedenssicherung (vgl. Heintze 1998: 16).
Grundsätzlich sind sprachplanerische Maßnahmen, so sie durchdacht sind und eine klare Vorstellung dessen verfolgen, was erstrebenswert ist, in einer zunehmend interdependenten Welt ein adäquates Mittel zur Sicherung kultureller Vielfalt. Wie das Beispiel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Kapitel 1.2 jedoch zeigt, sind sprachplanerischen Bemühungen natürliche Grenzen gesetzt. Einige Wissenschaftler halten Sprachplanung gar für unmöglich da Sprachen keine Objekte seien die man nach Bedarf verändern kann, sondern dem Volk gehörten, das durch den Gebrauch der Sprache entscheidet, was dazu gehören soll und was nicht. Zumeist würden von einer Sprachgemeinschaft nur jene Veränderungen angenommen, die sie selbst produziert hat (vgl. Coulmas 1985: 79).
3.0 Sprachplanung auf Europäischer Ebene
Rund 450 Millionen Sprecher sind auf dem Gebiet der Europäischen Union beheimatet. Die Sprachenkarte ist komplex - geformt durch einschneidende Ereignisse in der Geschichte kulturelle Unterschiede geographische Faktoren und die Mobilität der Einwohner. 23 Sprachen sind als Amtssprachen der EU anerkannt1, etwa 60 weitere indigene und nicht indigene Minderheitensprachen werden auf ihrem Gebiet gesprochen (vgl. Europäische Kommission 2006: 3).
Im Zusammenhang mit dem Erstarken der Regionen treten auch Minderheiten deutlicher und selbstbewusster auf, die für den Erhalt und die Förderung ihrer kulturellen Rechte eintreten (Bär 2004: 39). Seit mehr als zwei Jahrzehnten fordern die regionalen Verwaltungen und Vertreter autonomer Gemeinschaften mehr Mitspracherecht und die Einbeziehung in konkrete Entscheidungsprozesse auf der Ebene der EU. Sie begründen ihren Anspruch mit der weit höheren Bürgernähe (Schmuck 2006: 136). In Deutschland sind die Bundesländer, die den föderalen Aufbau des Staates manifestieren, weiterhin über den Bundesrat an Entscheidungen der EU beteiligt: seit 1993 ist die Bundesregierung verpflichtet, die Zustimmung des Bundesrates einzuholen, ehe in Fällen von geforderter Einstimmigkeit im Entscheidungsprozess der EU die Stimme abgegeben werden kann (Emmanouilidis 2006: 99).
Wie auch im Fall der Sprachpolitik erfordert die Diskussion um Minderheitenrechte und Minderheitensprachen eine vorangehende Definition des Begriffes „Minderheit“ über die keineswegs Einigkeit herrscht. Um das Potenzial eines Vertrages, wie ihn die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen darstellt, einschätzen zu können, bedarf es weiterhin der Kenntnis einiger Gesichtspunkte der Politik der Europäischen Union und des Europarates.
3.1 Definitionsproblematik „Minderheit“
Es gibt keine international anerkannte völkerrechtlich verbindliche Definition des Begriffes „Minderheit“. Vielmehr herrscht nicht einmal Einigkeit über den Begriff selbst, da er häufig als Herabsetzung empfunden wird. In diesem Fall wird der Begriff „Volksgruppe“ vorgezogen, der gleichzeitig einen besonderen territorialen Bezug herstellen soll (vgl. Blumenwitz 1996: 163). Fraglich ist allerdings inwiefern dies für sprachliche oder kulturelle Minderheiten überhaupt erstrebenswert ist. Auch über die Erweiterung der „nationalen Minderheit“ herrscht Uneinigkeit: Einige Autoren bezeichnen als nationale Minderheiten jene Gruppen, die sich durch Grenzverschiebungen bilden und die dadurch zu Staatsbürgern von Staaten mit anderer kultureller und sprachlicher Bevölkerungsmehrheit werden (Blumenwitz 1996: 162). Andere verwenden den Begriff für Gruppen, die sich grundsätzlich durch die Staatsangehörigkeit des Staates, in dem sie leben, auszeichnen. Dadurch automatisch ausgeschlossen sind Asylbewerber oder Ausländer, die weiterhin die Staatsangehörigkeit ihrer Heimat behalten (vgl. Haselhuber 1998: 121).
Die Frage der Staatsangehörigkeit ist eines der am stärksten kontrovers diskutierten Probleme in diesem Zusammenhang. Während zu Zeiten des Völkerbundes einheitlich die Meinung vorherrschte dass die Staatsangehörigkeit beim Minderheitenschutz keine Rolle spielen solle, geht das heutige Völkerrecht vielmehr davon aus dass der Begriff der Minderheit auf „eigene“ Staatsbürger beschränkt werden sollte (vgl. Blumenwitz 1996: 160). Jedoch ist bezüglich allgemeiner Rechte wie der ungestörten Ausübung der Religionsfreiheit oder des privaten Gebrauchs der eigenen Sprache, also Feldern, „die vom Staat lediglich Verzicht auf Aktionen Distanz verlangen, [ist] ein breiterer Minderheitenbegriff akzeptabel und aus Effektivitätsgründen vorzuziehen“ (Klein 1996: 212). Wird ein Staat dagegen verpflichtet, aktiv Fördermaßnahmen zu ergreifen - hierzu gehören beispielsweise Schulunterricht oder das Ermöglichen von Medienpräsenz in einer Minderheitensprache -„würde [es] schnell die Grenze vernünftiger, dem Staat zumutbarer Belastung überschreiten, wollte man von ihm die Verpflichtung erwarten, in einer Zeit großer Mobilität und Migration die Sprachen aller Sprachgruppen […] der „Nationalsprache gleichzustellen […]“ (Klein 1996: 212f).
Eine für alle Kontexte gültige Begriffsbestimmung ist also nicht unbedingt sinnvoll, denn Staaten sind eher bereit, Verpflichtungen zu übernehmen, wenn deren Rahmen überschaubar bleibt. Eine kontextabhängige Begriffsbestimmung ist also weniger negativ einzuschätzen, als es auf den ersten Blick scheint.
Die Definition einer Minderheit sollte nach zwei Grundvoraussetzungen erfolgen. Zum einen ist es notwendig, dass sich die Angehörigen der Minderheit ihres Andersseins bewusst sind und es als erstrebenswert betrachten, dies zu bewahren. Die Identifikation mit den Besonderheiten der Gruppe ist notwendig, da anderenfalls zwangsläufig eine Assimilierung durch die Mehrheitsbevölkerung stattfindet (Oxenknecht 1988: 102).
Weiterhin gibt es durchgehend anerkannte Kriterien nach denen eine Bevölkerungsgruppe als Minderheit anerkannt werden kann. Es handelt sich um die Religion und die Ethnie. Letzteres umfasst Abstammung, Geschichte und Kultur (und damit auch die Sprache) und ist somit ein relativ weit gefasstes Kriterium.
Die vermutlich am weitesten anerkannte Definition liefert ein Spezialberichterstatter der VN. Nach Francesco Capotorti handelt es sich bei Minderheiten um (zitiert nach Blumenwitz 1996: 169):
(4) […] eine der übrigen Bevölkerung eines Staates zahlenmäßig unterlegene Gruppe, die keine herrschende Stellung einnimmt, deren Angehörige - Bürger dieses Staates - in ethnischer, religiöser oder sprachlicher Hinsicht Merkmale aufweisen, die sich von der übrigen Bevölkerung unterscheiden, und die zumindest implizit ein Gefühl der Solidarität bezeigen, das auf die Bewahrung der eigenen Kultur, der eigenen Traditionen, der eigenen Religion oder der eigenen Sprache gerichtet ist.
Für den vorliegenden Kontext interessant ist vor allem der Begriff der „sprachlichen Minderheit“. In Umfragen zu Minderheitensprachen und Dialekten konnte nachgewiesen werden, dass seit dem 19. Jahrhundert eine zunehmende Tendenz dahingehend zu verzeichnen ist dass Eltern versuchen ihren Kindern bewusst und unter Bruch der Traditionen diejenige Varietät einer Sprache beizubringen die ihnen ihr soziales Fortkommen am besten sichert - in den meisten Fällen ist dies die Standardsprache (vgl. Bochmann 1993: 22). Um den Verlust sprachlicher Vielfalt zu verhindern, bedarf es also einer Ermutigung zum Gebrauch der eigenen Sprache.
Zwar werden in diversen internationalen Vereinbarungen Rechte determiniert, „sich der eigenen Sprache zu bedienen“ (z.B. Art. 27 IPbpR), jedoch gibt es keine Festlegung was „Sprache“ bedeutet. Da in der Betrachtung der Geschichte Europas augenscheinlich wurde dass ein Zwang zu einer vorgeschriebenen Nationalsprache zu massiven Benachteiligungen von sprachlichen Minderheiten führte sollte gerade dieses Recht festgeschrieben werden.
Im sprachpolitischen Rahmen wird zumeist von der weitesten Auslegung des Sprachbegriffs ausgegangen. Das heißt dass zwar neben den Hochsprachen auch Dialekte mit eingeschlossen sind. Dies bedeutet jedoch nicht im Umkehrschluss, dass alle Sprecher von Dialekten auch gleichzeitig Minderheiten angehören (vgl. Oxenknecht 1988: 117).
Die Abgrenzung wird in Kapitel 3 behandelt werden, da im vorliegenden Fall eben diese Auslegung nicht gültig ist, sondern Dialekte von vorneherein ausgeschlossen werden.
Eine mögliche Definition für „sprachliche Minderheit“ lautet wie folgt (Blumenwitz 1996: 162): (5) Die sprachliche Minderheit ist dadurch gekennzeichnet, daß sie sich schriftlich und/oder mündlich, öffentlich oder privat einer Sprache bedient die nicht Nationalsprache ist und in ihrem Wohngebiet nicht die gewöhnliche Sprache darstellt.
Von dieser Begriffsbestimmung wird im weiteren Verlauf der Arbeit ausgegangen.
Im sprachlichen Bereich können innerhalb der EU die meisten Maßnahmen des Minderheitenschutzes verzeichnet werden. Eine mögliche Erklärung bietet die Tatsache, dass Sprache als Bereich der Kultur gewertet und deren Rechte zu schützen demzufolge als kulturelle Aufgabe angesehen wird. Die Union verfügt im Bereich der Kulturpolitik über „ergänzende Befugnisse“, d.h. es besteht die Möglichkeit zum Ergreifen von Maßnahmen, wo die entsprechenden Mitgliedstaaten keine oder unzureichende Regelungen getroffen haben (vgl. Vizi 2003: 53).
3.2 Das „Sprachenproblem“ der EU
Bereits das Jahr 2001 wurde von der Europäischen Union und dem Europarat zum „Jahr der Europäischen Sprachen“ erklärt. Ziel dieser Deklaration war das Bemühen die sprachliche und kulturelle Vielgestaltigkeit Europas stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. Um zur aktiven Teilnahme einzuladen, wurden beispielsweise aus diesem Grund ins Leben gerufene Projekte an Universitäten mit EUFördermitteln unterstützt (Uni Bielefeld, im Internet).
Die vielen Sprachen führen zu einem dreiteiligen Gesamtkomplex, der häufig als das „Sprachenproblem der EU“ bezeichnet wird. Erstens besteht ein enger Zusammenhang zwischen Sprache, Nation und Identität. Dies führt dazu dass zweitens eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Amtssprachen das Handeln im Staatengebilde erschwert. Drittens bestehen darüber hinaus sprachliche Minderheiten auf ihre Anerkennung. Die drei Elemente werden im Folgenden ausführlicher betrachtet.
Sprache ist immer auch ein Ausdruck von Nationalität. Die Auseinandersetzung mit der sprachlichen Vielgestaltigkeit Europas führt zwangsläufig zu einer Auseinandersetzung mit dem Begriff „Nation“. Der Homogenitätsdruck, der durch eine nationale Selbstdefinition entsteht, ist einer der wesentlichen Faktoren der Gefährdung eben dieser Vielfalt (vgl. Wirrer 2003: 27).
Europa war vor der durch die Französische Revolution ausgelösten Nationalismuswelle ein politischer und sprachlicher „Flickenteppich“. Das Konzept der „Nation“ sollte jedoch für die Sprachen Europas eine entscheidende Rolle spielen. Frankreich gab als Vorreiter die vielen auf französischem Gebiet gesprochenen Sprachen zugunsten einer einheitlichen Nationalsprache, die verbindlich für alle Bereiche des neuen Staates gelten sollte, auf. Dieses Modell etablierte sich auch in den anderen europäischen Staaten, die vom revolutionären Gedanken erfasst ebenfalls Nationalstaaten nach französischem Vorbild errichten wollten (vgl. Ehlich 2002: 41).
Deutschland hatte hier eine bemerkenswerte Sonderstellung inne, da seine sprachliche Einheit hier lange vor der politischen Einheit vorhanden war. Dies ist in der historischen Entwicklung des deutschen Staates begründet. Im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation war es noch üblich, sprachliche Vielfalt als logische Konsequenz aus dem feudalen System der Fürsten- und Herzogtümer hinzunehmen und zu akzeptieren (vgl. Siguan 2001: 38). Nach dem Niedergang dieses Reiches partizipierten immer noch gut 30 (statt der vorherigen 300!) autonome politische Einheiten am 1815 gegründeten Deutschen Bund. Zwar waren sie alle unterschiedlich politisch organisiert was den Einigungsprozess erheblich erschwerte. Was die einzelnen Gebiete trotz verschiedener Varietäten jedoch einte, war die deutsche Sprache. Technische Innovationen wie der Buchdruck ebneten den Weg für die kontinuierliche Entwicklung einer einheitlichen deutschen Hochsprache. Dass in Deutschland die sprachliche Einheit vor der nationalen Einheit vorhanden war führte dazu dass die gemeinsame Sprache als selbstverständlich betrachtet wurde und bis heute kein Eintrag bezüglich der Nationalsprache im Grundgesetz zu finden ist (vgl. Ehlich 2002: 47).
Trotz der Entwicklung hin zu Nationalstaaten als deren Ideal eine einheitliche Sprache galt gelang diese Einigung in kaum einem europäischen Staat. Vielmehr lassen sich im Wesentlichen fünf Typen von Sprachkonstellationen unterscheiden (vgl. Siguan 2001: 56f):
- Einsprachigkeit: Zu Vertretern einer Politik mit dem Ziel der Einsprachigkeit zählen sowohl faktisch nahezu einsprachige Länder wie Portugal, als auch Länder wie Frankreich, in denen es zwar sprachliche Minderheiten gibt, diese aber von Seiten der Regierung negiert oder einfach missachtet werden.
- Schut z und/oder Toleranz: Zu Vertretern einer auf Schutz und/oder Toleranz ausgerichteten Politik zählen jene Staaten die ihre Minderheiten zwar akzeptieren, ihren Sprachen jedoch keine Rechte neben der Nationalsprache einräumen. In diese Kategorie gehören die Niederlande mit ihrer Politik gegenüber dem Friesischen.
- Sprachliche Autonomie: Ein Beispiel für sprachliche Autonomie ist Spanien - die vier Minderheitensprachen Katalanisch, Valenzianisch, Galizisch und Baskisch haben in den gesprochenen Gebieten neben dem Kastilischen offiziellen Amtssprachenstatus.
- Sprachlicher Föderalismus: Hierzu zählen Staaten die ihren unterschiedlichen Sprachgebieten Rechnung tragen indem sie mehrere Sprachen als Nationalsprachen akzeptieren, die auf dem jeweiligen Territorium gesprochen werden. Dies trifft beispielsweise auf Belgien zu, das neben einigen Minderheitensprachen Deutsch, Flämisch und Französisch als offizielle Sprachen zugelassen hat.
- Institutionalisierte Mehrsprachigkeit: Das Ziel der institutionalisierten Mehrsprachigkeit verfolgen jene Staaten, die zwei oder mehr Sprachen als Nationalsprache zulassen, die nicht regional unterschieden werden. Als Beispiel hierfür kann Finnland angeführt werden, wo neben Finnisch auch Schwedisch den Status einer offiziellen Landessprache hat.
Aus diesen Betrachtungen ergibt sich, dass in kaum einem Staat wirkliche sprachliche Homogenität herrscht. Abgesehen von den Minderheitensprachen, deren große Anzahl den Rahmen der kulturellen Vielfalt noch viel weiter steckt, muss daher zunächst die Frage beantwortet werden, wie innerhalb der EU mit den vielen Amtssprachen umzugehen ist.
Grundsätzlich verfolgt die EU das Prinzip des „integralen Multilingualismus“, nach dem jede Amtssprache eines Mitgliedstaates auch gleichzeitig Amtssprache der EU ist (vgl. Konrad 2003: 157). Generell stellt sich die Frage, ob eine einheitliche Sprache oder die Beibehaltung von bisher 23 Amtssprachen gewünscht ist. Für und gegen beide Möglichkeiten lassen sich Argumente anführen:
In den 1960er Jahren wurde im Rahmen der „Common European Second Language“-Bewegung, allerdings nicht auf EU-Ebene, überlegt, „Europa linguistisch zu vereinheitlichen“ (Oksaar 1998: 123). Der Wunsch nach einer Gemeinschaftssprache die eine Kommunikation zwischen allen Bürgern Europas ohne Sprachbarrieren ermöglicht und so für regen Austausch in den Bereichen der Wirtschaft, Politik und Kultur (nimmt man das Kulturgut „Sprache“ hiervon einmal aus) sorgen kann, scheint im ersten Moment verlockend.
In einem bi- oder multilingualen Nationalstaat könnte man zugunsten einer einheitlichen Sprache argumentieren man ernenne jene Sprache zur Nationalsprache, die von der zahlenmäßig größten Bevölkerungsgruppe gesprochen wird. Zwar wären dann die Sprecher anderer Sprachen benachteiligt und gezwungen, die Gemeinschaftssprache zu erlernen, um keine sozialen Nachteile hinnehmen zu müssen (vgl. Hagège 1996: 13). Man könnte diesen Schritt allerdings mit dem demokratischen Mehrheitsprinzip rechtfertigen. In einem Staatengebilde wie der EU jedoch stehen sich gleichberechtigte Nationalsprachen gegenüber, die jede für sich Teil der nationalen Identitäten sind und starke Fürsprecher haben.
Durch das Motto „In Vielfalt geeint“ erhebt die EU den Anspruch, trotz der vielen Unterschiede eine Einheit darstellen zu können. Bei 23 Amtssprachen lassen sich über 500 mögliche Kombinationen von Kommunikations- partnern errechnen. Eine reibungslose Kommunikation durch Dolmetscher zu sichern, ist nicht nur vom zeitlichen und finanziellen Aufwand her ineffektiv. In jeder Sprache gibt es zudem Begriffe, die nicht übersetzbar sind, sondern deren Bedeutung man nur umschreiben kann. Allerdings gehen dabei semantische Nuancen verloren, oder es kommen welche hinzu. Noch problematischer wird es, wenn durch die Unmöglichkeit wörtlicher Übersetzungen Ungenauigkeiten entstehen, die die Aussage von Texten - besonders schwerwiegend ist dies bei Gesetzestexten! - verändern (vgl. Oksaar 1998: 121).
Gerade bei einer so unüberschaubaren Anzahl an Sprachen ist es nahezu unmöglich, für jede Kombination Dolmetscher zu finden, die in der Lage sind, solche Nuancen auszugleichen. Die aktuell gegebene Situation ist jedenfalls wenig arbeitsfördernd (vgl. Oksaar 1998: 123).
Eine Lösung für dieses viel diskutierte Problem lässt sich vermutlich nur finden, wenn man die Kommunikation auf politischer Ebene von der Einsprachigkeit als kulturellem Ziel trennt. Ohne Zweifel wäre es sinnvoll, Politik auf europäischer Ebene zur Vermeidung von Übersetzungsfehlern, unnötig zeitraubenden bürokratischen Vorgängen und übermäßigen finanziellen Belastungen auf eine oder wenige Sprachen zu beschränken. Anbieten würden sich Französisch als interne Verwaltungssprache der EU, das in Handel, Wissenschaft und Technik vorherrschende Englisch oder vielleicht die zahlenmäßig unter der europäischen Bevölkerung am stärksten vertretene deutsche Sprache (vgl. Konrad 2003: 165).
Auf relativ verlorenem Posten stehen die Befürworter einer neutralen Plansprache wie dem Esperanto. Zwar kann eine solche Sprache als Kommuniktionsinstrument dienen, „unabhängig von den theoretischen Diskussionen über ihre Legitimität oder ihre kulturelle Substanzlosigkeit“ (Hagège 1996: 27). Auch böte es den Vorteil, dass keine der Amtssprachen bevorzugt würde. Zur Umsetzung von Beschlüssen in den nationalen Einzelstaaten müssten jedoch Rückübersetzungen stattfinden. Schon zwischen natürlichen Sprachen entstehen Schwierigkeiten durch semantische Unterschiede und Bedeutungsbereiche, bei einer Plansprache ist dies verstärkt zu erwarten (vgl. Hagège 1996: 27).
Ein weiteres Problem ergibt sich für Wortschöpfungen. Bedenkt man die langwierigen Debatten, die um eine Benennung der gemeinsamen Währung entbrannten, ist unschwer vorstellbar, zu welchen Auseinandersetzungen und bürokratischem Aufwand Neuschöpfungen führen würden (vgl. Ross 2003: 82).
Sowohl auf politischer als auch auf gesellschaftlicher Ebene stellt das europäische Sprachengeflecht die Union also vor Schwierigkeiten. Um eine effiziente Arbeitsweise zu gewährleisten, ist in jedem Fall eine Reform notwendig. Erst nach einer diesbezüglichen Einigung ist es dann möglich, die ausgewählte(n) Sprache(n) entsprechend in die Bildungssysteme der einzelnen Mitgliedstaaten einzubinden und so zu einer allgemeinen Kommunikationsform auf europäischer Ebene zu machen. Hinzu kommt das zunehmend selbstbewusste Auftreten der Minderheiten, die die Argumentation der Bedeutung der sprachlichen Identität auch für sich gesichert wissen wollen.
Neben den in irgendeiner Form anerkannten offiziellen Sprachen existieren Minderheitensprachen, die mit oder ohne Minderheitensprachenstatus auf europäischem Gebiet gesprochen werden. Indem Bezugsgruppen geschaffen werden und die Möglichkeit gegeben wird, Information zu transportieren, erweist sich eine Sprache stets als identitätsstiftendes Merkmal - bei Mehrheiten- wie Minderheitensprachen. Sie kann dazu dienen sich abzugrenzen oder Nähe auszudrücken. Dies zeigte sich z.B. bei der Verschriftlichung des Nordfriesischen in Schleswig-Holstein. Die Kontroverse drehte sich um die Großschreibung: eine Gruppierung wollte sie annehmen um eine gewisse Verbindung mit dem Deutschen herzustellen wohingegen die andere sie aus Gründen der deutlichen Abgrenzung ablehnte (vgl. Witt 2001: 9).
In erster Linie ist Sprache ein Kommunikationsmittel. Die symbolische Bedeutung, die Sprache als Merkmal der kulturellen Identität zukommt, ist jedoch ohne Zweifel von großer Bedeutung (vgl. Witt 2001: 9). Die angestrebte Erhaltung der kulturellen Vielfalt Europas verlangt gerade deswegen bezüglich der Minderheiten sprachplanerische Instrumente. Um ein solches möglichst wirkungsvoll zu gestalten, muss man sich darüber im Klaren sein, dass auch Minderheitensprachen verschiedene konstitutive Merkmale aufweisen. Wie auch bei der Betrachtung der offiziellen Sprachen müssen Differenzierungen vorgenommen werden (vgl. Wirrer 2003: 33f).
So existieren (vgl. ebd.)
- autochthone sprachliche Minderheiten innerhalb eines Nationalstaates, wie die Westfriesen in den Niederlanden,
- autochthone sprachliche Minderheiten mit durch Grenzen aufgeteiltem, aber geographisch zusammenhängendem Territorium, wie die Saami in Norwegen, Schweden, Finnland und Russland, - autochthone sprachliche Minderheiten, deren Wohngebiet durch Grenzziehung an ihre ursprüngliche Heimat angrenzt wie die Deutschen in Dänemark, bzw. die Dänen in Deutschland,
- allochthone sprachliche Minderheiten die z.B. durch Arbeitsmigration entstanden, wie die Türken in Deutschland.
Die jeweiligen Unterschiede zwischen den Minderheitensprachen verlangen eine auf die einzelnen Sprachen zugeschnittene Sprachpolitik, was den Schutz zusätzlich erschwert. EU und Europarat brachten Anfang der 1980er Jahre ein sprachpolitisches Instrument auf den Weg, in das darüber hinaus auch Regionalsprachen, auf deren Definition in Kapitel 3 eingegangen wird, Eingang finden sollten. Das Ergebnis dieses Prozesses liegt in Form der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen vor.
Trotz aller Schwierigkeiten wurde vom Europarat 1992 die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen verabschiedet, die 1998 als zweites international verbindliches Dokument zum Minderheitenschutz nach dem „Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten“ ratifiziert wurde. Durch den Aufbau dieses Dokuments wurde eine Möglichkeit geschaffen, auf die unterschiedlichen Ausgangssituationen der einzelnen Sprachen einzugehen.
4.0 Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
Seit vielen Jahren schon arbeiten verschiedene Organe der EU daran, die Situation von Regional- oder Minderheitensprachen zu verbessern. Zwar wird in Art. 14 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 bereits das Prinzip des Diskriminierungsverbotes festgelegt. Allerdings handelt es sich hierbei „nur“ um die Rechte einzelner Individuen und nicht um den positiven Schutz von Minderheiten als Gruppen und deren Sprachen wie die Beratende Versammlung 1957 in der Resolution Nummer 136 feststellte. Der Parlamentarische Ausschuss forderte daher 1961 in der Empfehlung 185 ein eigenes Schutzdokument zusätzlich zur Konvention. Mit diesem sollte sichergestellt werden, dass Sprecher von Minderheitensprachen die Möglichkeit haben ihre Sprache uneingeschränkt zu nutzen und z.B. Schulen zu gründen (CoE 1992, im Internet).
1981 entschied die Ständige Konferenz der Gemeinden und Regionen Europas (KGRE) auf Empfehlung des Parlamentarischen Ausschusses und des Europäischen Parlaments, ein solches Dokument vorzubereiten, da man sich über die Notwendigkeit einer eigenen Charta für Regional- und Minderheitensprachen einig war. Drei Jahre später fand im Zuge dessen eine ausführlich angelegte Erhebung statt. Über 250 Personen, die rund 40 Sprachen repräsentierten, wurden dazu angehört, wie sie die Situation ihrer Muttersprachen einschätzten. Weitere vier Jahre später präsentierte die KGRE das Ergebnis, auf dessen Basis ein vom Rat der Europäischen Union (Ministerrat) gegründetes Komitee ein verbindliches Dokument ausarbeitete. Die genaue Zusammensetzung dieser sog. „Ad hoc“- Gruppe ist nicht veröffentlicht worden. Auf Nachfrage im Vertragsbüro des Europarates ist jedoch zu erfahren, dass sich diese Gruppe aus Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammensetzte. Vertreter aus den Bereichen der Justiz, Medien, Kultur, Bildung und selbstverständlich auch der Sprachwissenschaft und Sprachpolitik waren an der Ausarbeitung beteiligt. Einige Mitglieder des Komitees waren selbst Sprecher einer Regional- oder Minderheitensprache (vgl. Klinge 2008). Am 25. Juni 1992 wurde die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen vom Europarat angenommen und im darauf folgenden November zur Zeichnung aufgelegt (CoE 1992, im Internet). Am 1.März 1998 trat sie in Kraft.
Das Hauptanliegen der Charta ist die Bewahrung kulturellen Erbes, daher wird der Begriff „Sprache“ auch in erster Linie mit Blick auf die kulturelle Funktion betrachtet. Soziopolitische oder ethnische Aspekte werden vernachlässigt (CoE 1992, im Internet).
Unter Regional- oder Minderheitensprache wird im Sinne der Charta jede Sprache verstanden, die sich deutlich von der Mehrheitssprache abgrenzt. Örtliche Varianten oder Dialekte sind nach dieser Definition somit nicht eingeschlossen. Auf die besondere Rolle von Dialekten und auch den Migrantensprachen wird in 3.3 gesondert eingegangen.
Die Problematik der Definition von Minderheiten und Minderheitensprachen wurde bereits behandelt. Einer begrifflichen Klärung bedarf jedoch noch der Ausdruck der „Regionalsprachen“. Hierbei handelt es sich nach Wirrer (Wirrer 2003: 36) um (6) [Eine] territorial gebundene Sprache, die gegenüber der jeweiligen Staatssprache ein Mindestmaß an typologischer Verschiedenheit aufweist und deren Sprecher sich gegenüber der Mehrheitsbevölkerung als ethnisch nicht verschieden definieren. Entscheidend ist, dass mit einem Dokument wie der Charta nicht nur die Bedrohung der Sprachen erkannt und ihre Vielfalt als schützenswertes Gut angesehen wird sondern „dass darüber hinaus eine Brücke zu den Menschenrechten und Grundfreiheiten geschlagen wird“ (Wirrer 2003: 39). Jedoch weist die Charta einige Mängel auf. Um diese verstehen und bewerten zu können, bedarf es einer genauen Betrachtung der Struktur der Charta. Darauf aufbauend kann dann eine Untersuchung der Vor- und Nachteile vorgenommen werden.
4.1 Die Struktur der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
Im Gegensatz zu anderen Konventionen wie z.B. der Allgemeinen Menschenrechtskonvention zielt die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen nicht darauf ab, individuelle oder allgemein gültige Rechte für die Sprecher von Regional- oder Minderheitensprachen festzulegen. Vielmehr werden Maßnahmen und Verpflichtungen aufgeführt, die von den Unterzeichnerstaaten in die eigenen Gesetzgebungen implementiert werden sollen. Das Ziel ist der Schutz der Sprachen selbst, nicht der Schutz der Sprecher als Individuen (vgl. Ruiz Vieytez 2004: 28).
Die Charta weist eine sehr flexible Struktur auf: Den Mitgliedstaaten wird bezüglich der Intensität des Schutzes und der Förderung der entsprechenden Sprachen ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt (vgl. Blumenwitz et al. 2000: 23). Darüber hinaus ist jeder Staat frei in der Wahl der zu schützenden Sprachen sowie der Rechte, die den Sprechern dieser Sprachen gewährt werden sollen (vgl. Bär 2004: 32).
In der Charta enthalten ist ein 98 Maßnahmen umfassender „Katalog“, aus dem die Staaten für jede zu schützende Sprache mindestens 35 auswählen müssen. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Ausgangssituationen der einzelnen Sprachen bzgl. Sprecheranzahl, Status, etc. in den unterschiedlichen Staaten sehr unterschiedlich sind (CoE 1992, im Internet).
Die nachfolgende Abbildung gibt einen Gesamtüberblick über die Struktur der Charta:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Die Struktur der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, Ruiz Vieytez 2004: 29.
Die Charta ist in fünf Teile gegliedert:
(I) Allgemeine Bestimmungen
(II) Ziele und Grundsätze
(III) Maßnahmen zur Förderung der Sprachen im öffentlichen Bereich
(IV) Anwendung
(V) Schlussbestimmungen.
Teil I der Charta besteht aus den Art. 1-6. Der Geltungsbereich der Charta, d.h. Definitionen, die bei der Bestimmung der zu schützenden Sprachen helfen, wird in Art. 1 festgelegt.
Art. 2 erläutert die Unterscheidung zwischen den beiden Hauptteilen der Charta: Teil II (Art.7) verpflichtet die Staaten grundsätzlich, die Ziele und Grundsätze der Charta auf alle geschützten Sprachen anzuwenden, Teil III (Art. 8-14) enthält die konkreten Vorschläge für Maßnahmen (vgl. CoE 1992, im Internet).
In Art. 3 werden die Staaten verpflichtet bei der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde verbindlich mitzuteilen auf welche Sprachen die Charta angewandt werden soll (vgl. Blumenwitz et al. 2000: 23). Art. 4 und 5 legen fest, dass bereits bestehende Schutzbestimmungen oder Maßnahmen, die Staaten anwenden, nicht von der Umsetzung der Charta betroffen sind.
In Art. 6 wird noch einmal eindringlich darauf hingewiesen, dass sich die Regierungen und teilnehmenden Organisationen über die Obligationen, die sich aus der Charta ergeben, im Klaren sein müssen, damit diese ihre volle Effektivität entfalten kann (vgl. CoE 1992, im Internet).
In Teil II der Charta werden die Maßnahmen bezeichnet, die grundsätzlich auf alle als Regional- oder Minderheitensprachen anerkannten Sprachen angewendet werden müssen. In erster Linie bedeutet dies die Festlegung des Sprachgebietes und das Zugestehen genereller Förderungsmöglichkeiten. Diese grundlegenden Maßnahmen sind vor allem für jene Sprachen interessant, die eine so geringe Sprecherzahl haben, dass eine konkrete Förderung nach Teil III gar nicht umsetzbar wäre (vgl. Ruiz Vieytez 2004: 32).
Teil III schlägt für die Bereiche Bildung Justiz Verwaltung und Dienstleistungen Medien kulturelle Tätigkeiten und Einrichtungen, wirtschaftliches und soziales Leben sowie den grenzüberschreitenden Austausch konkrete Maßnahmen vor. Zu jedem einzelnen Bereich sind verschiedene und frei wählbare Intensitätsstufen vorgegeben (vgl. Charta, Anhang 1: 5-13).
In Teil IV (Art. 15-17) wird festgelegt, dass die Unterzeichnerstaaten regelmäßig Berichte vorzulegen haben, in denen sie Rechenschaft über ihre Arbeit ablegen. Diese Rechenschaftsberichte werden von einem unabhängigen Sachverständigenausschuss auf ihre Richtigkeit überprüft (vgl. Charta, Anhang 1: 13f).
Die Schlussbestimmungen, in denen Verfahrensfragen,
Beitrittsmöglichkeiten, Rücktritt und Kündigungen geregelt werden, sind in Teil V (Art. 18-23) enthalten (vgl. Charta, Anhang 1: 14-16).
[...]
1 Amtssprachen der EU sind: Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Irisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Ungarisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Finnisch und Schwedisch (vgl. Europäische Kommission, im Internet).
- Arbeit zitieren
- Juliane Engberding (Autor:in), 2008, Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen und ihre Umsetzung in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165240
Kostenlos Autor werden




















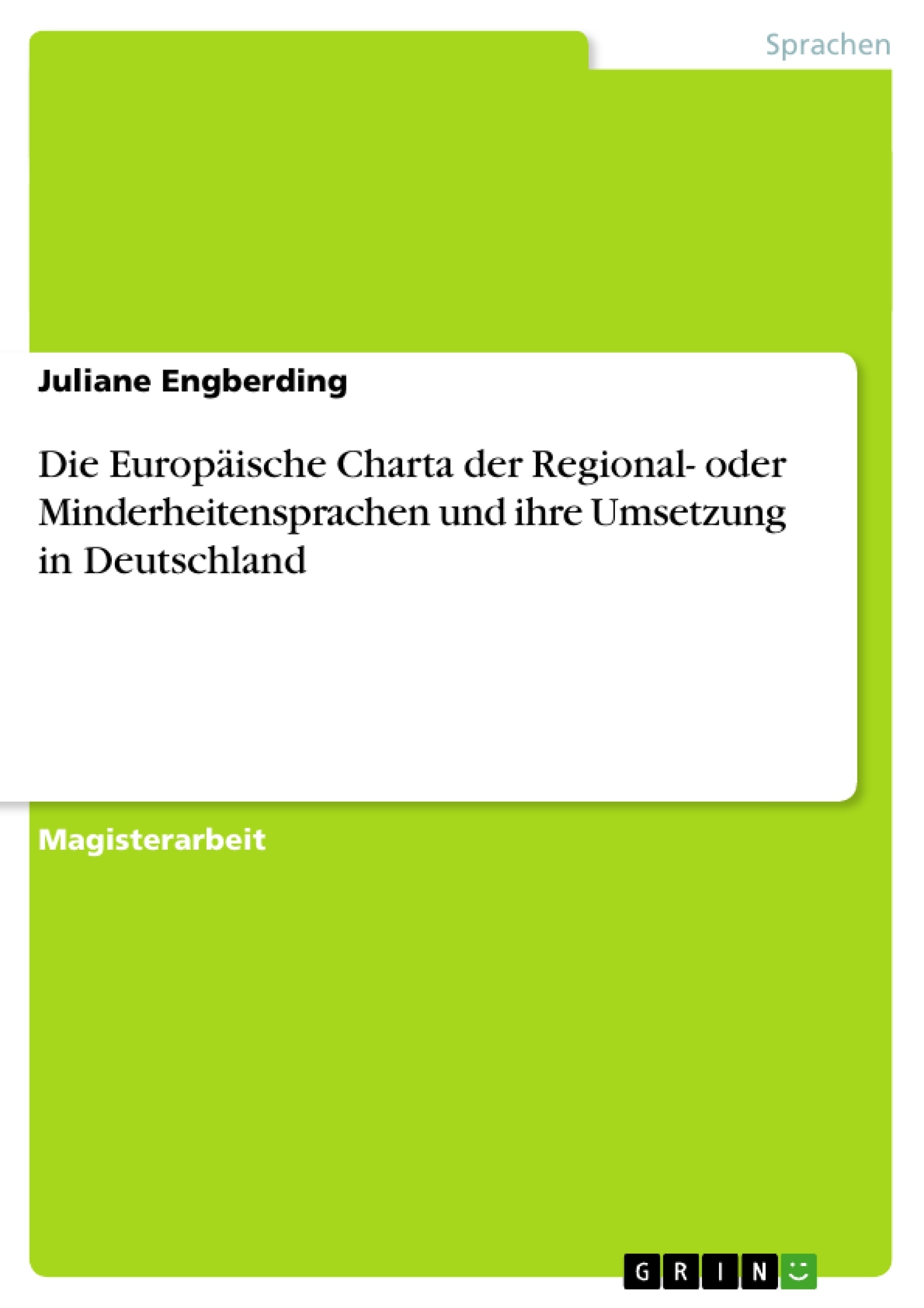

Kommentare