Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Der Einsatz des Hundes in der Therapie mit Kindern
2.1 Tiergestützte Therapie - eine Einleitung
2.2 Die Mensch-Tier-Beziehung unter besonderer Beachtung des Hundes
2.2.1 Die besondere Verbindung zwischen Mensch und Hund
2.2.2 Die Mensch-Hund-Kommunikation
2.3 Die Mensch-Tier-Beziehungen im therapeutischen Kontext
2.3.1 Bio-psycho-soziale Wirkungen von Tieren auf Menschen
2.3.2 Einflüsse von Tieren auf die sozioemotionale Entwicklung von Kindern
2.3.3 Der Hund als Co-Therapeut
2.3.4 Wirkungsbereiche hundgestützter Therapie
2.3.5 Rahmenbedingungen
3 Soziale Interaktion bei autistischen Kindern
3.1 Autismus - eine tiefgreifende Entwicklungsstörung
3.1.1 Klassifikation und Symptomatik
3.1.2 Diagnostik
3.1.3 Ätiologie
3.1.4 Verlauf und Prognose
3.2 Besonderheiten in der sozialen Interaktion autistischer Kinder
3.2.1 Beeinträchtigung des sozialen Verständnisses und der Vorstellungsfähigkeit
3.2.2 Beeinträchtigung der sozialen Kommunikation
3.2.3 Beeinträchtigung der sozialen Beziehungen
3.3 Hundgestützte Therapie bei autistischen Kindern
3.4 Forschungsberichte
4 Mögliche Auswirkungen hundgestützter Therapie auf die soziale Interaktionsfähigkeit autistischer Kinder.
5 Anhang
5.1 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Die heilsame Wirkung von Tieren auf Menschen ist bereits seit hunderten von Jahren bekannt. Das Thema tiergestützte Therapie rückt jedoch erst seit einigen Jahren zunehmend in das Interesse der Wissenschaft. So beschäftigen sich derweil unterschiedlichste Disziplinen mit der Erforschung dieses neuen Wissenschaftszweiges. Verhaltensforschung, Psychologie, Soziologie, Pädagogik, Human- und Veterinärmedizin, Gehirnforschung, Biologie und Philosophie sind unter anderem daran beteiligt, die Wirkungen von Tieren auf Menschen wissenschaftlich zu untersuchen und belegen.
Auch das Thema Autismus ist weiterhin aktuell, da die Ätiologie bislang nicht eindeutig erforscht ist und infolge dessen keine einheitliche Methode zur optimalen Behandlung seiner Symptome entwickelt werden konnte. Aus diesem Grund bedeuten jegliche Maßnahmen, die autismustypische Symptome verringern und die sozialen Fähigkeiten autistischer Menschen verbessern können, eine Chance für autistische Kinder, am sozialen Leben teilhaben zu können, sich nicht selbst zu isolieren oder von anderen ausgegrenzt zu werden. Somit stellt die tiergestützte Therapie eine heilpädagogische Möglichkeit dar, autistische Kinder ganzheitlich zu fördern und zu integrieren.
Die zentrale Frage, die dieser Arbeit zugrunde liegt, lautet demnach: Hat hundgestützte Therapie Auswirkungen auf die soziale Interaktionsfähigkeit autistischer Kinder, und lassen sich gegebenenfalls diese Effekte nachhaltig auf die zwischenmenschliche Interaktion übertragen?
Die vorliegende Arbeit gibt zunächst einen Überblick über die theoretischen Grundlagen tiergestützter Therapie sowie über die wesentlichen Theorien zur Mensch-Tier-Beziehung. Darauf aufbauend wird tiergestützte Therapie und speziell die Wirkung von Hunden im therapeutischen Kontext beleuchtet. Das dritte Kapitel soll einen Überblick über das Störungsbild Autismus vermitteln und die damit verbundenen Beeinträchtigungen genauer erörtern. Im Anschluss daran werden einzelne Studien Aufschluss über die therapeutischen Wirkungen von Hunden auf autistische Kinder geben.
Basierend auf den in Kapitel zwei und drei behandelten theoretischen Grundlagen und Forschungsberichten werden im vierten Kapitel die Relevanz hundgestützter Therapie für die soziale Interaktionsfähigkeit autistischer Kinder ergründet und diskutiert sowie mögliche Wirkungen und Grenzen aufgezeigt. Abschließend wird die tiergestützte Therapie autistischer Kinder kritisch reflektiert und der Bezug zur heilpädagogischen Arbeit verdeutlicht.
2 Der Einsatz des Hundes in der Therapie mit Kindern
Dieses Kapitel gibt eine Übersicht über die Einsatzmöglichkeiten des Hundes in der Therapie und zeigt die positiven Wirkungen, die Hunde auf Menschen haben können, auf. Einleitend werden wichtige Begriffe zur tiergestützten Therapie definiert und nachfolgend ihre Entstehungsgeschichte dargestellt. Im Anschluss daran werden verschiedene Erklärungsansätze der Mensch-Tier-Beziehung als Basis tiergestützter Therapie vorgestellt, die spezielle Beziehung zwischen Mensch und Hund historisch und inhaltlich aufgearbeitet und die Bedeutung der Kommunikation in diesem Zusammenhang erläutert. Daran anschließend wird die Mensch-Tier-Beziehung im therapeutischen Kontext betrachtet. Weiterführend werden die positiven Effekte von Tieren auf Menschen sowie die positiven Einflüsse von Hunden auf die sozioemotionale Entwicklung von Kindern thematisiert. Abschließend werden die Bedeutung des Hundes in der Therapie ausgearbeitet und die spezifischen Wirkungsbereiche, auf die mit Hilfe eines Hundes in der Therapie Einfluss genommen werden kann, und die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen dargelegt.
2.1 Tiergestützte Therapie - Eine Einleitung
Therapie im Allgemeinen wird definiert als „Behandlung von Krankheiten, Heilverfahren‘ (Pschyrembel 1998, 1562).
„Unter tiergestützter Therapie versteht man alle Maßnahmen, bei denen durch den gezielten Einsatz eines Tieres positive Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten von Menschen erzielt werden sollen. Das gilt für körperliche wie für seelische Erkrankungen“ (Verein Tiere als Therapie 2009). Im Wesentlichen werden zwei Formen unterschieden:
Animal-Assisted Activities (AAA) sind unterstützende Maßnahmen zur Motivationssteigerung, Erziehung und Genesung mit Hilfe eines Tieres, um die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Das Tier sollte bestimmte Wesenszüge aufweisen, die es für den Einsatz qualifizieren. Die Aktivitäten müssen nicht von speziell ausgebildeten Personen durchgeführt werden und sind in Zeit und Dauer flexibel. Bei AAA erfolgt keine Zielsetzung; Aktivitäten und Effekte müssen weder dokumentiert noch ausgewertet werden. Unter AAA fallen Tierbesuchsprogramme, bei denen ehrenamtliche Personen mit ihren Tieren Institutionen besuchen. Die Zielgruppe der AAA sind Menschen aller Altersklassen. Tiergestützte Aktivität (TA) ist die deutsche Bezeichnung (Frömming 2006, 29).
Animal-Assisted Therapy (AAT) ist eine zielgerichtete Maßnahme zur Förderung und Verbesserung sozialer, sprachlicher und motorischer Fähigkeiten. Das Tier ist hierbei ein zentraler Bestandteil des Therapieprozesses und muss bestimmte Merkmale aufweisen sowie für den therapeutischen Einsatz ausgebildet sein. Der Behandlung muss eine Diagnose zugrunde liegen, und sie darf ausschließlich von qualifizierten Fachkräften, wie beispielsweise Ärzten, Psychotherapeuten und Physiotherapeuten durchgeführt oder zumindest angeleitet werden. AAT folgt einem auf Klienten und Diagnose abgestimmten Therapieplan, der auch Zeit und Dauer des Therapieprozesses bestimmt. Dokumentation und Evaluation des Therapieverlaufs sind hierbei unerlässlich. Die AAT eignet sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich aufgrund einer seelischen oder körperlichen Störung oder Erkrankung einer Therapie unterziehen. Tiergestützte Therapie (TT) lautet der deutsche Begriff für AAT (Vernooij/Schneider 2008, 31ff).
Eine weitere Form der tiergestützten Intervention ist die tiergestützte Pädagogik (TP). Die TP eignet sich für Kinder und Jugendliche mit Auffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich (Vernooij/Schneider 2008, 38ff). Lernfortschritte sollen mit der Unterstützung eines ausgebildeten Tieres erzielt werden. Jegliche Aktivitäten werden von pädagogisch ausgebildeten Lehrkräften durchgeführt, die sich an einem speziell ausgearbeiteten Lehrplan und -ziel orientieren. Zeit und Dauer der TP werden vorab festgelegt, sie erfolgt zumeist über einen längeren Zeitraum.
Die einzelnen Sitzungen und Lernfortschritte müssen unter Berücksichtigung der angestrebten Ziele dokumentiert werden.
Geschichtlich können die Anfänge der TT in das achte Jahrhundert eingeordnet werden. Schon damals wurden in Belgien Tiere therapeutisch eingesetzt. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ist der Einsatz von Tieren im York Retreat, einer Einrichtung für Geisteskranke in England, bekannt. Im deutschen Bethel entstand im 19. Jahrhundert ein Epileptiker-Zentrum, das Tieren eine heilende Wirkung zusprach und sie als wesentlichen Bestandteil bei der Arbeit mit Menschen integrierte. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Tiere erstmalig in einem New Yorker Krankenhaus eingesetzt, um Kriegsveteranen bei der Genesung und Aufarbeitung von Traumata zu helfen. Der Psychologe Boris Levinson war der Erste, der Haustiere in der Psychotherapie mit Kindern einsetzte und gilt damit als Begründer der TT. Er erkannte bei einer zufälligen Begegnung eines gestörten Kindes mit seinem Hund die Wirkung von Tieren als „Katalysator für menschliche Interaktion“ (Levinson zit. nach McCulloch 1983, 26), da sich ihm das Kind in Anwesenheit des Hundes erstmalig öffnete und für Gespräche zugänglich wurde (McCulloch 1983, 26). Durch Levinsons zahlreiche Veröffentlichungen wurde das Interesse an diesem neuen Wissenschaftszweig geweckt, und Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen begannen, auf dem Gebiet zu forschen. Ende der 70er Jahre wurde in den Vereinigten Staaten eine Gesellschaft zur weiteren Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung gegründet, die heute in fast allen westlichen Staaten durch Unterorganisationen vertreten ist. Des Weiteren entstanden zahlreiche Tierbesuchsdienste mit speziell dafür ausgebildeten Therapie-Tieren, Streichelzoos für Großstadtkinder wurden eingerichtet, Behinderten-Begleithunde ausgebildet und Tiere an einsame und kranke Menschen vermittelt. Die Entwicklung in Deutschland auf diesem Gebiet beschränkte sich zunächst auf das therapeutische Reiten; erst in den 80er Jahren wurden erste weitergehende Studien und Experimente durchgeführt (Greiffenhagen 2007, 14ff). Die 1977 in den USA gegründete Stiftung „The Delta Society“ ist bis heute führend sowohl in der wissenschaftlichen Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung wie auch in der praktischen Umsetzung tiergestützter Einsätze. Die europäische Forschung ist vertreten durch Vereine wie das „Institut für interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung“ (IEMT) und den „Forschungskreis für Heimtiere in der Gesellschaft“ (Vernooij/Schneider 2008, 27).
2.2 Die Mensch-Tier-Beziehung unter besonderer Beachtung des Hundes
Die Beziehung zwischen Mensch und Tier besteht seit Anbeginn der Menschheit und war im Laufe der Evolution einem stetigen Wandel unterzogen. So war das Tier seit jeher als Nahrungsquelle, Kleiderlieferant, Nutz-, Last- und Arbeitstier oder als religiös verehrtes Wesen Bestandteil der menschlichen Gesellschaft (Frömming 2006, 4). Seit dem 19. Jahrhundert erweiterte sich die Bedeutung des Tieres für den Menschen auf die des Statussymbols, Forschungs- und Sammelobjekts sowie auch auf die des Freundes und Begleiters (Otterstedt 2003b, 25). Die heutige Beziehung zwischen Mensch und Tier stellt sich paradox dar: Auf der einen Seite wächst die Entfremdung vom Tier, was sich in der Ausrottung von Tierarten oder der Massentierhaltung widerspiegelt, auf der anderen Seite steigt das Bedürfnis, mit Tieren enge partnerschaftliche Beziehungen einzugehen, was sich zum Beispiel in der Zunahme von Tierhotels und -friedhöfen und aufwendiger Tierchirurgie zeigt (Greiffenhagen 2007, 16). Die Entwicklung des Menschen ist seit jeher unmittelbar mit seinem Lebensumfeld, welches die Begegnung und den Umgang mit Tieren als wesentlichen Bestandteil einschloss, verknüpft. Aus diesem Grund besteht ein ethologisch bedingtes, tief in dem Menschen verwurzeltes Interesse an der Tier- und Pflanzenwelt (Prothmann 2008, 21f).
Auf dieser durch lange gemeinsame Evolution entstandenen Verbundenheit basiert ein wesentlicher Erklärungsansatz für die Mensch-Tier-Beziehung, die Biophilie-Hypothese von Wilson (1984) und Kellert (1997), welche besagt, dass der Mensch eine biologisch fundierte Affinität zu Leben und Natur hat (Beetz 2004, 4). Die Verbundenheit kann auf Verwandtschaft, Neugier oder auf die angstvolle Beachtung anderen Lebens zurückgeführt werden sowie auf Ausnutzung oder Gemeinsamkeit im Sinne von Bindung beruhen. Durch sie kann ästhetisches Empfinden, das Verspüren von Empathie und geistige Nähe entstehen (Olbrich 2003a, 70). Biophilie schließt sowohl Aversion als auch Attraktion ein und beruht auf größtenteils unbewussten Prozessen (Beetz 2004, 4).
Eine ergänzende Theorie für die Beziehung zwischen Mensch und Tier stützt sich auf die Erkenntnisse der Bindungstheorie John Bowlbys, die besagt, dass die frühen Bindungserfahrungen entscheidende Auswirkungen auf die sozioemotionale Entwicklung von Kindern haben und prägend für das emotionale und soziale Verhalten im Erwachsenenalter sind. Die Übertragung dieser Theorie auf die Mensch-Tier-Beziehung basiert auf der These, dass Tiere für den Menschen Bindungsobjekte darstellen und positive Bindungserfahrungen mit einem Tier auf die Sozialbeziehungen mit Menschen projiziert werden können. Demzufolge besteht die Möglichkeit, die Bindungserfahrungen von Kindern mit Hilfe von Tieren positiv zu beeinflussen (Vernooij/Schneider 2008, 10f).
Ein weiterer Erklärungsansatz für die Mensch-Tier-Beziehung ist das Konzept der Spiegelneurone. Spiegelneurone sind Nervenzellen, die nur durch Beobachtung einer Situation die gleichen Prozesse im Gehirn auslösen wie bei der aktiven Durchführung. Dies deutet laut Beetz darauf hin, dass Spiegelneurone dem Individuum ermöglichen, fremde Aktionen und Absichten nachzuvollziehen und Gefühle anderer zu deuten und zu empfinden. Insofern bilden Spiegelneurone die Grundlage für das soziale Zusammenleben und gegenseitige Verstehen. Spiegelneurone werden ausschließlich aktiviert, wenn die Handlung von einem Lebewesen ausgeführt wird. Die Aktivierung geschieht automatisch und kann nicht bewusst gesteuert oder hervorgerufen werden. Auf die Mensch-Tier- Beziehung übertragen, könnten die beobachteten Effekte der Beruhigung oder der Verbesserung der Stimmung bei Menschen durch die Anwesenheit von Tieren mit dem Konzept der Spiegelneurone erklärt werden, wobei dies aber noch nicht hinreichend erforscht ist. Für die tiergestützte Therapie könnte dies eine Möglichkeit bedeuten, die Empathiefähigkeit bestimmter Menschen zu fördern (Beetz, 2006).
2.2.1 Die besondere Verbindung zwischen Mensch und Hund
Der genetische Ursprung des Hundes liegt nach neusten Erkenntnissen bei bis vor 100 000 Jahren. Der Hund hat im Vergleich zu anderen Haustieren für den Menschen einen besonderen Stellenwert. Er war das erste Tier, welches der Mensch domestizierte und welches durch die lange gemeinsame Entwicklungsgeschichte ein einzigartiges Gespür und Verständnis für menschliche Gestik und Mimik entwickeln konnte. Kein anderes Haustier ist in so viele Lebensbereiche des Menschen integriert (Prothmann 2008, 24). In den unterschiedlichsten Aufgabenfeldern bewährt sich der Hund als treuer Begleiter des Menschen. So fungiert er in erster Linie als Dialogpartner im Haushalt, wird aber auch für seine Fähigkeiten als Wachhund geschätzt sowie für seinen Einsatz im Rettungswesen oder als Signal- und Begleithund (Frömming 2006, 34). Die hohe Anpassungsfähigkeit des Hundes ermöglichte es dem Menschen, ihn nach eigenen Vorstellungen und Wünschen in Verhalten und Aussehen zu züchten. So entwickelten sich verschiedene Rassen wie Jagd-, Hüte-, Spür- und Wachhunde sowie Polizei- oder Rettungshunde. Die damit verbundene Problematik spiegelt sich in der Überzüchtung oder in den Kampfhunddebatten der letzten Jahre wider (Prothmann 2008, 24).
Die enge Verbundenheit zwischen Mensch und Hund gründet sich auf dem Phänomen der Du-Evidenz[1], welches besagt, dass Menschen mit sozialen Tieren eine Beziehung eingehen können, die der ähnelt, die Menschen oder Tiere untereinander entwickeln. Greiffenhagen betont, dass hierbei ausschließlich das subjektive Empfinden, dass es sich bei einer Beziehung um eine Partnerschaft handelt, ausschlaggebend ist (Greiffenhagen 2007, 22f). Die subjektive Einstellung zu dem anderen und die authentischen Gefühle für sein Gegenüber sind von zentraler Bedeutung für die Entwicklung von Du-Evidenz, die hauptsächlich auf der sozioemotionalen Ebene wirkt und vermutlich die Fähigkeit ermöglicht, Empathie und Mitgefühl für ein anderes Lebewesen zu empfinden. Je mehr Übereinstimmungen in Körpersprache, Empfindungen und speziellen Bedürfnissen eine gemeinsame Basis bilden, desto eher kann das Gegenüber als „Du“ angesehen und eine Beziehung mit ihm eingegangen werden. Menschen gehen in erster Linie untereinander und mit sozial lebenden Tieren eine solche Du-Beziehung ein. Dies trifft vor allem auf Pferde und Hunde zu, da diese ähnliche soziale und emotionale Grundbedürfnisse empfinden, in Körpersprache und Ausdrucksformen dem Menschen gleichen und somit für den Menschen verstehbar sind. Das demnach häufig resultierende Phänomen der Anthropomorphisierung, das heißt der Vermenschlichung der Tiere, bietet hilfreiche Möglichkeiten für die tiergestützte Therapie, da vielfältige Identifikationsmöglichkeiten mit dem Tier positiv genutzt werden können (Vernooij/Schneider 2008, 8ff). Die Du- Evidenz lässt das Tier zum Kameraden werden, ihm werden personale Eigenschaften zugeschrieben und es erhält Individualität durch einen eigenen Namen. Mit der Namensgebung wird das Tier zum Subjekt und zu einem Familienmitglied mit eigenen Bedürfnissen und Rechten. Die Entwicklung des Tierschutzes unterstreicht die neue Stellung des Tieres als Rechtsperson. Laut Greiffenhagen ist die Du-Evidenz eine Grundvoraussetzung der nonverbalen Kommunikation zwischen Mensch und Tier und ferner dafür, dass Tiere pädagogisch und therapeutisch wirksam sein können (Greiffenhagen 2007, 23f).
2.2.2 Die Mensch-Hund-Kommunikation
Kommunikation als wichtigste Form von Interaktion beschreibt soziale Situationen, in denen ein verbaler oder nonverbaler Mitteilungsaustausch zwischen Menschen stattfindet (Bundschuh/Heimlich/Krawitz 2002, 167). Kommunikation vollzieht sich durch eine Informationsübertragung von einem Sender auf einen Empfänger. Der zentrale Prozess bei der Kommunikation besteht in der Umwandlung von Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen in Worte, Symbole oder Zeichen, die vom Gegenüber aufgenommen und verstanden werden (Vernooij/Schneider 2008, 16). Im weiteren Sinne handelt es sich um die wechselseitige Form der Informationsübertragung, die komplexe interaktive Verhaltensweisen ermöglicht und das Verhalten des anderen durch das Aussenden von Signalen beeinflusst (Feddersen-Petersen 2004, 15). Nach Watzlawick lassen sich zwei Formen der Kommunikation unterscheiden: die digitale Kommunikation, die sich in Sprache und Schrift äußert, und die analoge Kommunikation, die hauptsächlich sprachfrei verläuft und auf taktiler Interaktion basiert (Watzlawick/Beavin/Jackson 2007, 61ff). Zur analogen nonverbalen Kommunikation zählen Blickkontakt, Mimik, Körperhaltung und Körperbewegung, Berührung, räumliche Distanz zum Interaktionspartner, vokale nonverbale Zeichen wie Stimmhöhe, Stimmführung, Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit und die Kommunikation über Äußeres wie Kleidung oder Statussymbole (Frindte 2001 zit. nach Prothmann 2008, 35). Die Kommunikation stellt in der therapeutischen Arbeit mit Tieren einen zentralen Aspekt dar. Hierbei geht es nicht um die Sprache als Kommunikationsform, sondern um die Verständigung durch die nonverbale Kommunikation (Frömming 2006, 20). Der französische Philosoph Michel de Montaigne, der als Vordenker und Vater der modernen Tierpsychologie gilt, verweist auf die Möglichkeit der nonverbalen Kommunikation und der damit verbundenen sozialen Beziehung zwischen Mensch und Tier (Otterstedt 2003b, 23). Die Fähigkeit des Menschen, nonverbales Verhalten zu deuten, entwickelt sich bereits während der ersten Lebensjahre. Für Kinder, besonders für vorsprachliche Kinder, ist die nonverbale Kommunikation und die Körpersprache essentiell wichtig (Prothmann 2008, 35). Die Kommunikation zwischen dem Baby und seiner Umwelt ist geprägt von emotionalen Inhalten und erfolgt auf analoger Ebene (Olbrich 2003b, 189). Im Gegensatz zur verbalen Kommunikation kann die nonverbale Kommunikation kaum willentlich beeinflusst werden. Sie ist unbegrenzter und weniger präzise. Durch sie werden Beziehungen reguliert und Positionen deutlich gemacht. Sie bedarf gegenüber der digitalen Kommunikation keines Transformationsprozesses in Zeichen oder Symbole. Bei einer Diskrepanz zwischen Gesagtem und körpersprachlich Mitgeteiltem reagieren sowohl Kinder als auch Hunde primär auf die nonverbal übermittelte Information (Prothmann 2008, 37f). Insbesondere Kindern und Tieren wird eine sensible Intuition zugeschrieben, zwischen Authentizität und Falschheit menschlicher Haltungen unterscheiden zu können. Folglich lässt sich eher aufgrund einer Geste auf die Haltung eines Menschen zu seinem Gegenüber schließen als aufgrund von Beteuerungen durch Worte (Watzlawick/Beavin/Jackson 2007, 64).
Dies bedeutet, dass die analoge Kommunikation Stimmigkeit in einer Person voraussetzt (Olbrich 2001). Um diese intrapersonelle Ausgeglichenheit zu erlangen, müssen laut Beetz die verschiedenen Persönlichkeitsebenen miteinander in Verbindung stehen. Beetz betont in ihren Ausführungen, dass neben rationalem Denken und Kontrolle über die Umwelt ein tiefes Empfinden von Empathie und Akzeptanz eine wesentliche Voraussetzung für die menschliche Entwicklung bilden (Beetz 2004, 5).
Die Stimmigkeit und die daraus resultierende Authentizität einer Person lässt sich mit Rothackers Schichtenlehre der Persönlichkeit theoretisch unterlegen. Rothacker unterscheidet drei Hauptschichten der Persönlichkeit. Die älteste bezeichnet er als Vitalschicht. Hier finden die Prozesse statt, die zur Aufrechterhaltung des vegetativen Nervensystems dienen. Ihr werden die Funktionen der animalischen Tiefenperson zugeordnet. Die zweite Hauptschicht nennt er die Emotionale oder Es-Schicht. In ihr sind Triebe, Instinkte, Emotionen, Stimmungen und Affekte verankert. Die oberste Schicht, die Personschicht, lokalisiert das Bewusstsein und Erinnerungen. In dieser Schicht befindet sich das Ich einer Person, sie besitzt Organisationsund Kontrollfunktionen. Wichtig an Rothackers Theorie ist nach Olbrich, dass die Regulationen auf den unteren beiden Schichten unbewusst ablaufen, und die jeweils höheren Schichten in ihrer Funktionsfähigkeit von den tieferen Schichten abhängig sind, nicht jedoch umgekehrt. Dies bedeutet, dass die bewussten Regulationen des Ich nur bei funktionsfähigen Vital- und Es-Schichten funktionieren können. Umgekehrt sind die unteren Schichten nicht abhängig davon, ob die oberste Schicht störungsfrei funktioniert (Olbrich 2001). Dies ist insofern bedeutsam für die Kommunikation und darauf aufbauend für die Mensch-Tier-Beziehung, als menschliche Interaktion und Kommunikation nicht nur von den bewusst gelenkten Regulationen der Personschicht bestimmt wird. Soziale Interaktionen, sowohl zwischenmenschlich als auch artübergreifend, sind demzufolge auch von den Tiefenschichten mitbestimmt. Somit wird die analoge Kommunikation und Interaktion mit Tieren hauptsächlich von der Es-Schicht gesteuert (Beetz 2004, 5f), welche das gefühlsbestimmte Kommunizieren und Empfinden beinhaltet. Demnach berühren Tiere den Menschen auf tieferen Ebenen und fördern ganzheitliches Empfinden und die ganzheitliche Nutzung aller psychischen Vorgänge auf allen Schichten innerhalb einer Person (Olbrich 2001).
Mensch und Hund verfügen über unterschiedlich ausgerichtete Kommunikationssysteme. So kommuniziert der Hund ausschließlich über den körpersprachlich nonverbalen Weg. Aufgrund dessen ist seine Botschaft grundsätzlich eindeutig. Fühlt sich der Hund beispielsweise von einem Kind bedrängt, wird er aufstehen und weggehen (Prothmann 2008, 36). Der Hund ist, bezogen auf seine Sinnesorgane, wesentlich leistungsfähiger als der Mensch. Mit seinen etwa 200 Millionen Riechzellen kann er, im Gegensatz zum Menschen mit durchschnittlich zehn Millionen Riechzellen, deutlich mehr Informationen allein über den Geruchssinn aufnehmen (Feddersen- Petersen 2004, 21f). Sein Gehör verfügt über ein breiteres Frequenzspektrum, vor allem im Hochtonbereich, und seine Sehkraft in der Dunkelheit ist der des Menschen überlegen (ebd. 2004, 16f). Während sich der Hund primär über den Geruchssinn, erst an zweiter Stelle über den visuellen Kanal und zuletzt akustisch orientiert, rezipiert der Mensch in erster Linie visuell und akustisch. Auch beim Senden von Informationen sind Mensch und Hund sehr divergent. Der Hund sendet zuerst visuelle Signale, beispielsweise durch Körperhaltung und Mimik, gefolgt von Geruchsinformationen und zuletzt akustischen Signalen, während der Mensch sich bevorzugt akustisch und visuell mitteilt (Prothmann 2005, 10f). Geruchsinformationen werden vom Menschen unwillkürlich und zumeist unbewusst gesendet, die vom Hund jedoch wahrgenommen werden, wie beispielsweise Angst. Demgegenüber kann der Mensch die vom Hund gesendeten Geruchssignale nicht aufnehmen. Der differenzierte Geruchssinn des Hundes könnte eine Erklärung dafür sein, warum Hunde epileptische Anfälle im Vorhinein erspüren oder Störungen des Blutzuckerspiegels bei Diabetikern anzeigen können (Prothmann 2008, 39). Aufgrund der langen Koevolution von Mensch und Hund scheint sich ein Kommunikationskonsens zwischen beiden Arten entwickelt zu haben. So muss der Mensch im Dialog mit dem Hund auf die analoge Kommunikation zurückgreifen, und der Hund hat in besonderer Weise gelernt, menschliche Signale zu verstehen (Frömming 2006, 20f). Hunde sind beispielsweise in der Lage, einem Fingerzeig, Blick oder Drehbewegungen des Kopfes zu folgen; dies weist darauf hin, dass Hunde ein adaptives Verhalten zur Erkennung und Nutzung menschlicher zielgerichteter Gesten entwickelt haben müssen (Prothmann 2008, 39f). Wenngleich Hunde fähig sind, bestimmte Worte mit Aufforderungen oder anderem Inhalt zu verknüpfen, fehlt ihnen dennoch ein Wortverständnis (Feddersen-Petersen 2004, 16). Im Vergleich zu anderen Tierarten kann der Hund besser auf menschliche Signale reagieren als beispielsweise der Affe. Diese gemeinsamen kommunikativen Fähigkeiten begründen sich in dem engen Zusammenleben von Mensch und Hund, welches zur Folge hatte, dass Hunde menschliche Gestik und Mimik besser interpretieren können als Primaten, die ihren Lebensraum nicht mit Menschen teilten (Prothmann 2005, 12).
2.3 Die Mensch-Tier-Beziehung im therapeutischen Kontext
Die verschiedenen Erklärungsansätze zur Mensch-Tier-Beziehung verdeutlichen, dass durch Tiere die Tiefenschichten einer Person angesprochen werden und somit wohltuende therapeutische Effekte ausgelöst werden können. So können Tiere laut Olbrich ein Gleichgewicht zwischen dem in der heutigen Gesellschaft überbetonten rationalen, wissenschaftlichen und technologisch kontrollierten Denken und einem tieferen Empfinden und Empathie herstellen (Olbrich 2001). Den Zugang hierzu bietet die analoge Kommunikation. Da Tiere, wie bereits beschrieben, fast ausschließlich auf die analogen Anteile der Kommunikation reagieren, fordern sie von dem Menschen eine gute Abstimmung zwischen analoger und digitaler Kommunikation. Dies verhilft dem Menschen dazu, sich selbst als authentisch, ehrlich und wahr zu erfahren und eine bessere Übereinstimmung zwischen Sachaspekt und Beziehungsaspekt zu erlangen (Frömming 2006, 21). Im Sinne von Rogers wird durch eine feinere Abstimmung zwischen innerem Erleben, Bewusstsein und Kommunikation Authentizität entwickelt, was therapeutisch wertvoll ist (Rogers 1973, 177). Die Interaktion mit Tieren bedarf überwiegend einer intuitiven Einschätzung des Gegenüber, wodurch Empathie gefördert wird. Dies konnte durch Studien belegt werden, welche zeigten, dass Kinder, die mit Tieren aufwachsen, wesentlich mehr Empathie zeigen (Beetz 2003, 81). Der therapeutische Wert von Tieren, insbesondere von Hunden, wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass sie dem Menschen vorbehaltlos begegnen, kritik- und urteilsfrei ihre Zuneigung zeigen und Sicherheit vermitteln. Laut Prothmann ruft die kindlichbedürftige Abhängigkeit, die Hunde dem Menschen vermitteln, im Menschen ein natürliches Bedürfnis hervor, sie zu schützen und zu versorgen. Infolgedessen kann ein Gefühl der Wertschätzung sich selbst und anderen gegenüber entwickelt werden. Insbesondere in psychiatrischen Einrichtungen gilt dieser Prozess als wertvolle Unterstützung des Therapieprozesses. Untersuchungen bei Patienten mit sexuellen Missbrauchserfahrungen in der Kindheit ergaben , dass Tiere die negativen Erfahrungen mildern konnten. In weiteren Studien konnte nachgewiesen werden, dass Tiere bei Kindern mit somatischen Störungen und chronischen Krankheiten eine stressreduzierende Wirkung bei Krankenhausaufenthalten oder schmerzhaften medizinischen Eingriffen ausübten. Ferner konnten zahlreichen Erfahrungsberichten zufolge bedeutsame Verhaltensänderungen und eine Verbesserung sozialer Interaktionen bei unterschiedlichen Personen in Anwesenheit von Tieren beobachtet werden (Prothmann 2005, 12ff). Eine weitere Studie kam zu dem Ergebnis, dass tiergestützte Therapie die Befindlichkeit von Kindern und Jugendlichen deutlich verbessern kann. So kam es im Verlauf der Therapie zu einem signifikanten Anstieg der Vitalität[2], Vigilanz[3] und Extraversion[4], wie auch zu einem ausgewogenen intrapsychischen Gleichgewicht. Diese Effekte ließen sich bei der Kontrollgruppe ohne Tierkontakt nicht nachweisen (Prothmann/Schaumberg/ Ettrich 2004). Die Ergebnisse einer Studie von Filiatre, Millot und Montagner zeigten, dass die gemeinsame Interaktion von Kind und Hund die emotionale Entwicklung und Beziehungsfähigkeit von Kindern positiv beeinflusst und der Hund eine aktive Rolle in der Regulierung von Interaktionen mit dem Kind spielt. Demzufolge fördert der Hund die Entwicklung eines sozial wirksameren und besser strukturierten Verhaltensrepertoires (Filiatre/Millot/Montagner 1983, 57). Die sozialen, psychischen und somatischen Effekte positiver Mensch-Tier-Beziehungen stützen die Vermutung einer primär über die Tiefenschichten der Person bedingten Verbundenheit zwischen den Spezies. Die therapeutische Wirkung von Tieren basiert auf einer sozial-psycho-somatischen Integration, die durch Tiere ausgelöst wird. Taktile Kontakte mit Tieren, emotionale und kognitive Prozesse, soziale Interaktion und Kommunikation spielen hierbei eine Rolle. Die evolutionär bedingte Verbundenheit, Empathie sowie bewusste und unbewusste Prozesse ermöglichen artübergreifende Interaktion und Kommunikation. In der tiergestützten Therapie wird eine Integration dieser Prozesse intrapersonell sowie interpersonell methodisch und theoretisch gefördert (Olbrich 2008).
2.3.1 Bio-psycho-soziale Wirkungen von Tieren auf Menschen
Der Umgang mit Tieren fördert den Menschen auf vielfältige Weise. So können körperliche, mentale und soziale Kompetenzen durch den Kontakt mit Tieren gestärkt werden (Otterstedt 2003a, 65). Eine Studie über den Wert von Hunden für Menschen ergab, dass die psychosozialen Wirkungen, die Hunde auf ihre Halter ausüben, sehr hoch einzuschätzen sind. Im Rahmen der Untersuchung zeigte sich, dass Hunde ein Gefühl der Sicherheit, Wärme und Zuneigung vermitteln. Sie haben die Fähigkeit soziale Bedürfnisse zu befriedigen, wie zum Beispiel Kontakt zu anderen Menschen herzustellen, oder einen Kontakt zur Natur, der zu Bewegung und Aktivität motiviert (Norling 1983, 25). In verschiedenen epidemiologischen Studien wurde festgestellt, dass Tiere das Gesundheitsverhalten ihrer Besitzer positiv beeinflussen und Haustierbesitzer gesünder sind als Menschen, die ohne Tier leben. Allein durch die Anwesenheit eines ruhigen Tieres senken sich Blutdruck und Herzfrequenz und es kommt zu einer Muskelentspannung (Greiffenhagen 2007, 33). Eine Untersuchung von Katcher und Beck begründet dieses Phänomen der physiologischen Entspannung durch die Anwesenheit von Tieren mit einem ethologisch bedingten Gefühl von Sicherheit und Vertrauen, welches ein ruhig liegendes Tier auslöst (Katcher/Beck 1983, 132). Des Weiteren vermindert Tierkontakt die Ausschüttung von Stresshormonen und fördert Aktivität und Mobilität (NESTMANN 2005). Studien, die sich mit den physiologischen Tiereffekten bei Kindern beschäftigten, ergaben, dass sich die Anwesenheit von Tieren auf Kinder im Umgang mit stressreichen Situationen als hilfreich erweist. So konnten, wie bereits erwähnt, signifikante Unterschiede bei einer schmerzhaften medizinischen Untersuchung in Bezug auf Blutdruck und Herzfrequenz sowie auf stressbedingtes Verhalten wie Weinen und das Äußern von Ängsten festgestellt werden. Wenn ein Hund bei einer Behandlung zugegen war, kam es zu einer Senkung des Blutdrucks und der Herzfrequenz, die Kinder weinten nicht und reagierten weniger schmerzempfindlich. Zudem waren Kinder während der Behandlung in Anwesenheit eines Hundes kooperativer (PROTHMANN 2008, 26f).
[...]
[1] Evidenz wird definiert als Deutlichkeit; vollständige, überwiegende Gewissheit (Duden
Das Fremdwörterbuch 1990, 234).
[2] Vitalität wird definiert als Lebenskraft und Lebendigkeit (Duden Das Fremdwörterbuch 1990,816).
[3] Vigilanz meint Wachsamkeit; Wachheit des Bewusstseins (Duden Das Fremdwörterbuch 1990, 813).
[4] Extraversion beschreibt die seelische Einstellung, die durch Konzentration der Interessen auf äußere Objekte charakterisiert ist (Duden Das Fremdwörterbuch 1990, 242).
- Arbeit zitieren
- Karin Rustemeyer (Autor:in), 2009, Die Auswirkungen hundgestützter Therapie auf die soziale Interaktionsfähigkeit autistischer Kinder, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160330
Kostenlos Autor werden

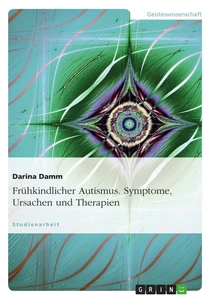
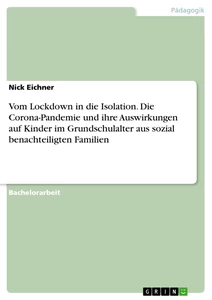
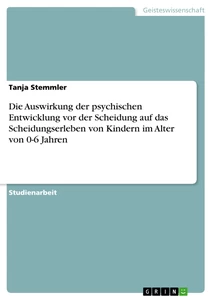









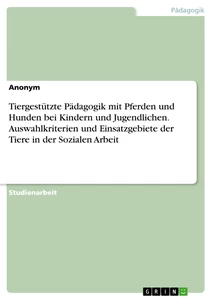








Kommentare