Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Haupttext
Vorrede zur Analytik der Begriffe
Die reinen Verstandesbegriffe
Metaphysische Deduktion der Kategorien
Literaturverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 11 Seiten
- Arbeit zitieren
- Simon Fischer (Autor:in), 2013, Die reinen Verstandesbegriffe in "Die Kritik der reinen Vernunft" von Immanuel Kant, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496616
Kostenlos Autor werden
✕
Leseprobe aus
11
Seiten

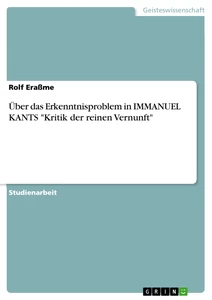
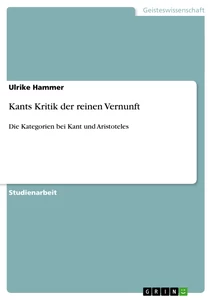

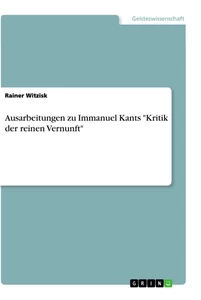
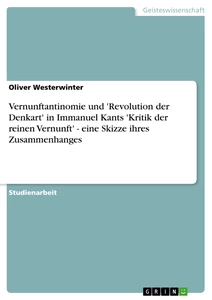
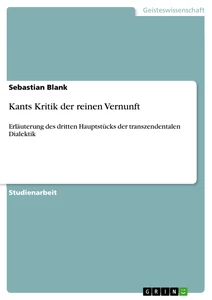
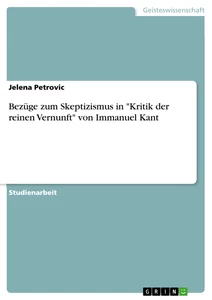
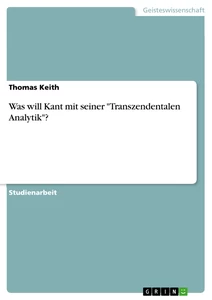
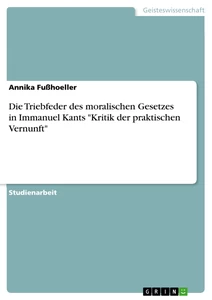

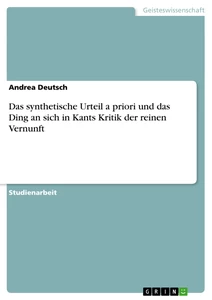

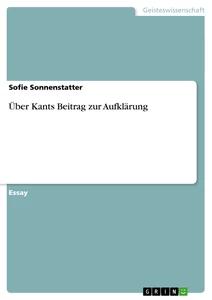
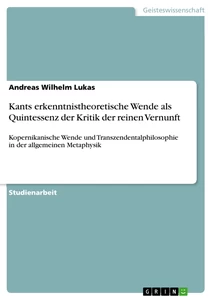
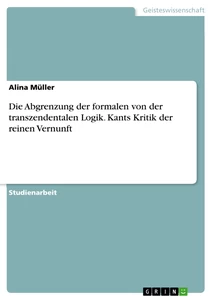
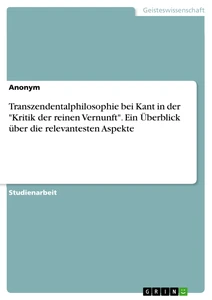

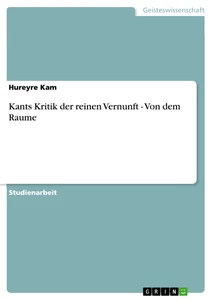
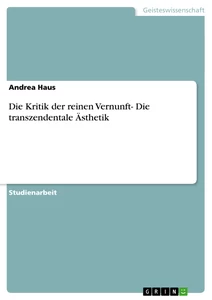
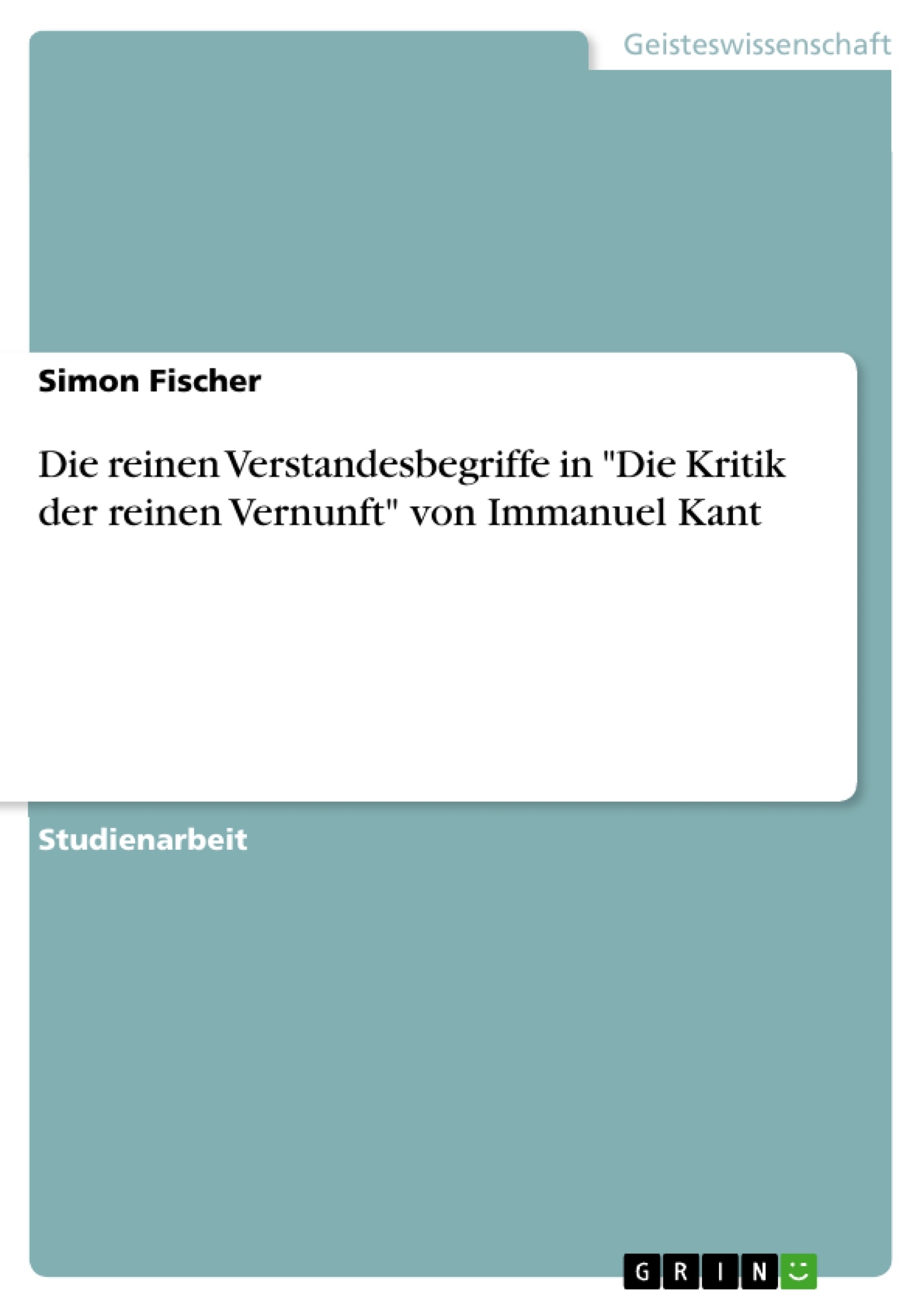

Kommentare