Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG
2 DIE BEGRIFFE LEISTUNG UND LEISTEN
3 DIE PÄDAGOGISCHE BEDEUTUNG VON LEISTUNG UND LEISTEN IMSPORT–UND BEWEGUNGSUNTERRICHT
4 LEISTUNGSMESSUNG UND-BEWERTUNG IM SPORTUNTERRICHT
4.1 Der Begriff: Leistungsmessung
4.2 Der Begriff: Leistungsbewertung
4.3 Das Dilemma der Leistungsbewertung
5 KONSEQUENZEN UND PERSPEKTIVEN DER LEISTUNGSBEWERTUNG
5.1 Förderung von Selbstbewertungen
5.2 Klärung der Leistungsanforderungen
5.3 Den Stellenwert der Benotung relativieren
5.4 Offenlegung der Leistungsbewertungen
5.5 Mit Schüler-Schülerbewertungen erarbeiten
5.6 Verbesserung der Leistungsmessung als Grundlage für Leistungsbewertungen
5.7 Die Bedeutungen des Sich-Bewegens vermitteln
5.8 Gütemaßstäbe und Prüfungsbedingungen zusammen mit den Schülern erarbeiten
6 ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT
LITERATURVERZEICHNIS
- Arbeit zitieren
- Bastian Kohl (Autor:in), 2013, Leistung und Leistungsbewertung im Schulsport. Konsequenzen für die Gestaltung des Sportunterrichts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/498214
Kostenlos Autor werden
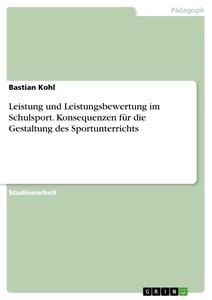




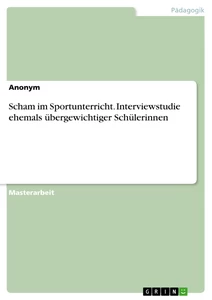
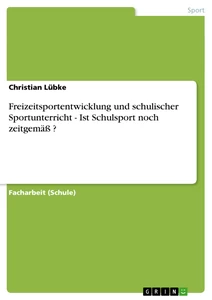
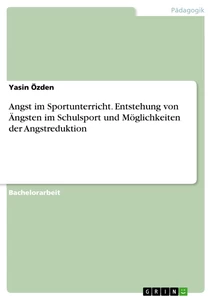
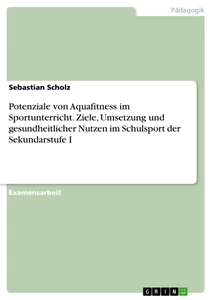


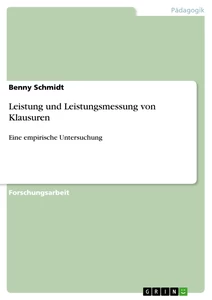
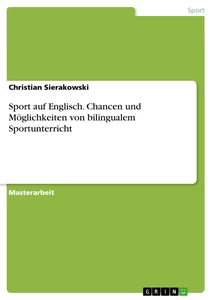
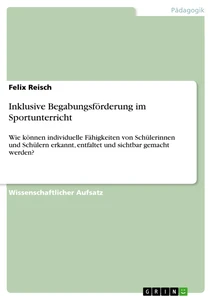

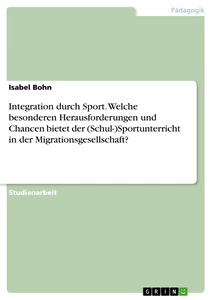
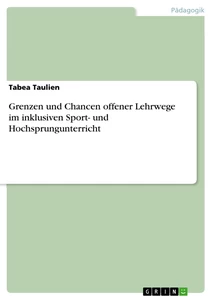
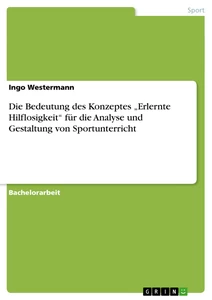

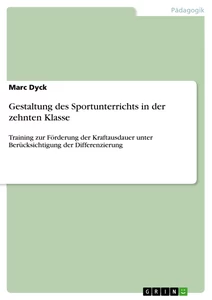
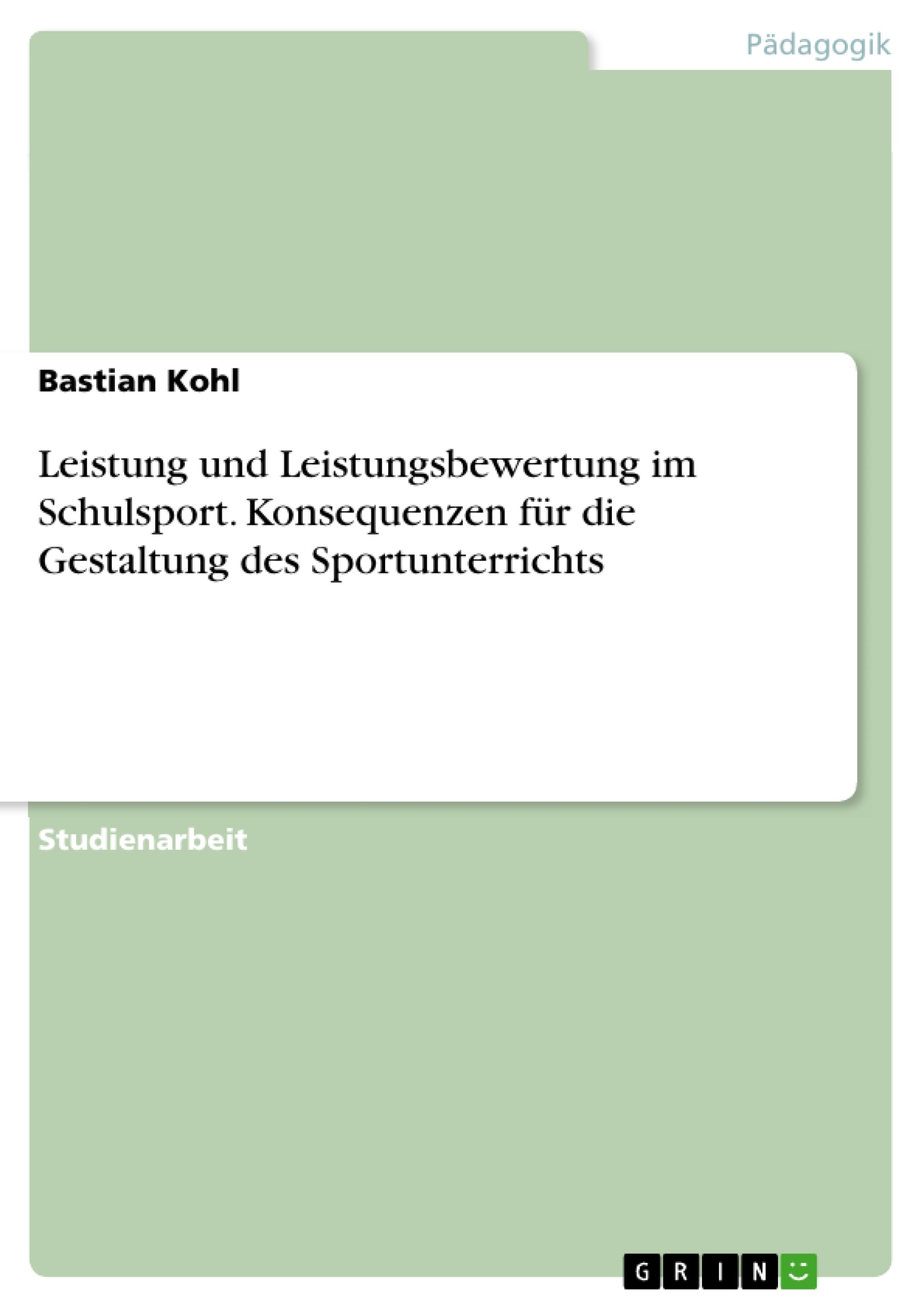

Kommentare