Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffsbestimmungen und Problemanalyse
2.1 Bestimmung zentraler Begriffe
2.2 Bedeutung des Lesens für gehörlose Menschen
2.3 Schwierigkeiten gehörloser Menschen mit dem Lesen
2.4 Mögliche Gründe für die Probleme gehörloser Menschen
beim Lesenlernen
3 Entwicklung des Lesens
3.1 Die Leseentwicklung bei hörenden Kindern
3.1.1 Das Sechsstufenmodell von Frith
3.1.2 Das Entwicklungsmodell der Schriftsprache
von K.-B. Günther
3.1.3 Die Leseentwicklung nach Brügelmann und Brinkmann
3.1.4 Entwicklungsmodell des Lesen- und Schreibenlernens
nach Valtin
3.2 Besonderheiten Leseentwicklung bei gehörlosen Kindern
3.2.1 Anwendbarkeit der Stufenmodelle der regelhaften
Leseentwicklung auf gehörlose Kinder
3.2.2 Stufenmodelle der Schriftsprachentwicklung bei
gehörlosen Kindern nach K.-B. Günther
3.2.3 Stufenmodell des Schriftspracherwerbs bei gehörlosen
Kindern nach van Uden
3.3 Zusammenfassende Kritik der Modelle
4 Didaktische Ansätze zum Lesenlernen
4.1 Darstellung und Kritik von Fibelkonzepten
4.2 Lesenlernen ohne Fibel auch mit gehörlosen Kindern?
4.3 Gebärdensprachorientierte Konzepte
4.3.1 Lesenlernen im bilingualen Unterricht
4.3.2 Lesenlernen mit der GebärdenSchrift
4.4 Lesenlernen auf oralem Weg
5 Materialien zum Erstlesen
5.1 Didaktische Spiele und andere Materialien
5.2 Computerlernprogramme
5.3 Darstellung aktueller Erstlesefibeln
6 Fazit
Literatur
1 Einleitung
Der Erwerb des Lesens bei gehörlosen Kindern erscheint sehr rätselhaft. Während den meisten gehörlosen Kindern das Lesenlernen relativ schwerfällt, erreichen einige gehörlose Kinder scheinbar mühelos ein altersgemäßes Leseniveau. So berichtet die gehörlose Autorin Dorothea Böhme in ihrer Lesebiographie, wie sie bereits ein Jahr vor ihrer Einschulung lesen lernte, indem sie sich in den Klassenraum der Schulanfänger schlich und den Unterricht von der hintersten Bank aus verfolgte (Böhme 2003).
Da das Lesen gerade für Gehörlose u.a. von zentraler Bedeutung zur Kompensation der durch ihre Hörbehinderung bedingten Sprachbarrieren ist, soll hier versucht werden zu ergründen, warum einige gehörlose Kinder so leicht lesen lernen, während ihre Klassenkameraden trotz großer Anstrengungen scheitern. Vermutlich haben gehörlose Kinder ein viel größeres Potential das Lesen zu erlernen als bisher angenommen wurde. Aber wie erlernen gehörlose Kinder überhaupt das Lesen ohne Lautsprache und wie kann davon ausgehend das Lesen angebahnt werden?
Zur Beantwortung dieser Fragen werden im ersten Teil der Arbeit zunächst die Gründe für Lernschwierigkeiten beschrieben und analysiert. Nach einer Betrachtung der Unterschiede hörender und gehörloser Kinder wird untersucht, welche Hilfen sich eignen, um den Kindern zur jeweils höheren Leseentwicklungsstufe zu verhelfen.
Außerdem wird im zweiten Teil der Arbeit die Eignung der - ausgehend von den Entwicklungsmodellen der Schriftsprache - entwickelten didaktischen Konzepte zum Lesenlernen vor allem hinsichtlich der spezifischen Lernvoraussetzungen gehörloser Schüler untersucht. Dabei soll vor allem auf die Kontroversen zwischen Fibelanhängern und –gegnern und den Anhängern von oralen und bilingualen Leselernkonzepten eingegangen werden.
Ausgehend von den gewonnenen Kenntnissen über spezifische Leseschwierigkeiten und den Verlauf der Leseentwicklung werden im dritten Teil die für diese Konzepte entwickelten Fibeln, Spiele und Lernprogramme dargestellt und beurteilt. Im abschließenden Fazit wird noch einmal über die gewonnenen Erkenntnisse für die Erstlesedidaktik reflektiert.
2 Begriffsbestimmungen und Problemanalyse
2.1 Bestimmung zentraler Begriffe
An dieser Stelle soll die Bedeutung der für diese Arbeit zentralen Begriffe wie Lesen, Schrift und Sprachbewusstheit sowie einige mit diesen Begriffen in Zusammenhang stehender Fachtermini, die in dieser Arbeit wiederholt benutzt werden, erläutert werden.
Doch warum soll ein so eindeutiges Wort wie Lesen überhaupt erklärt werden? Generell wird schließlich davon ausgegangen, dass jedem klar ist, was „Lesen“ bedeutet. Der Begriff ist jedoch komplexer als er auf den ersten Blick erscheint. So gibt es mittlerweile eine unzählige Anzahl von Definitionen des Lesens. Die jeweilige Definition ist zudem für viele Pädagogen der Ausgangspunkt für die Entwicklung der jeweiligen Leselernmethode gewesen. So steht für die Anhänger der ganzheitlichen Leselernmethode das Verstehen der Schriftsprache im Mittelpunkt, während die Anhänger der synthetischen Methode die Lesetechnik hervorheben. Bei einer analytischen Leselernmethode sollen einzelne Buchstaben aus Ganzwörtern spontan erkannt werden, während bei der synthetischen Methode einzelne Buchstaben sukzessiv zu ihrer Klanggestalt verschmolzen werden. Heute ist es üblich, im schulischen Rahmen beide Dimensionen des Lesens im Sinne einer Methodenintegration als gleichwertig zu berücksichtigen. Die Forderung nach einer Leselernmethode, die sowohl analytische als auch synthetische Elemente hervorhebt, wird seit den 80er Jahren in den Richtlinien gefordert (Ministerium für Schule 1985). Auch Schenk glaubt, dass es problematisch ist, einen der beiden Aspekte des Lesens zu vernachlässigen. Für sie bedeutet Lesen zum einen „ die Technik des Umsetzens von Schriftzeichen in Bedeutung aufgrund erworbener Kenntnisse und Fertigkeiten...“ (Schenk 2002, 14) und zum anderen „ die Sinnerfassung eines sprachlichen Inhalts, der durch Schriftzeichen fixiert ist...“ (Schenk 2002, 14).
Sinnerfassung (Verstehen) Technik (Grundfähigkeit)
der Sprachinhalte des Entschlüsseln von Schrift
↓ ↓
Analytische Methoden Synthetische Methoden
ganzheitliche Verfahren einzelheitliche Verfahren
↓ ↓
Lesen ist Sinnerfassung (Sinngestaltung)
in Schrift verschlüsselter Sprachinhalte
↓
Analytisch-synthetische Methoden
methodenintegrierende Verfahren
Abb.1: Betrachtungsweisen des Lesens (aus Scheerer-Neumann 2002, 15)
Reichen, der sich mit keinem der gängigen Fibelkonzepte anfreunden kann, glaubt, dass sich sinnentnehmendes Lesen nur über das leise Lesen anbahnen kann. Für ihn ist das „Lesen kein lautes Vorlesen, sondern ein innergedanklicher Vorgang, ein geistiger ,Selbstläufer’, bei dem man durch Hinblicken auf einen Text den Sinn desselben ohne ein besonderes, willentlich gesteuertes Zutun versteht“ (ebd, 20). Ein solches Lesen ist nur möglich, wenn der Leser „über einen entsprechenden Wortschatz, gründliche Vorkenntnisse und ausreichende Intelligenz “ (Reichen 2001, 16) verfügt, um den Text wirklich erfassen zu können. Daher definiert Reichen Vorlesen nicht als Lesen, da hierbei nicht überprüft wird, ob das Gelesene wirklich verstanden wird oder lediglich Buchstaben in Laute umgewandelt werden. Außerdem wird durch das Vorlesen das natürliche Lesetempo reduziert: Es geschieht nicht mühelos und selbstgesteuert. Daher betrachtet der Autor das Vorlesen sogar als störend für den Erstleseunterricht und empfiehlt, es hierbei gar nicht einzusetzen.
Löwe fordert jedoch gerade das laute Lesen, da sich so die Laute mit dem Schriftbild verbinden sollen. Wie Günther hebt er zu Beginn des Lesenlernens den technischen Aspekt hervor, bei dem schriftliche Zeichen in Laute umgewandelt und anschließend zu einem Wortklang vereinigt werden (Günther, Herbert 1997, 37).
„Über die Graphem-Phonem-Korrespondenzen werden die richtigen Laute zu den einzelnen Buchstaben ausgewählt, die dann zum Wortganzen synthetisiert werden können.“ (Günther, Herbert 1997, 37)
Poppendieker definiert Lesen in einem weiteren Sinne, indem sie die Interpretation von Texten in den Vordergrund stellt. Das Entziffern der Bedeutung von einzelnen Wörtern ist für sie noch kein Lesen.
„Lesen ist ein aktiver Prozeß. Die Lesenden bringen bei jedem Lesen Vorwissen und Erwartungen mit an einen Text heran. Sie ergänzen in Gedanken nicht Erwähntes, d.h. sie lesen zwischen den Zeilen.“ (Poppendieker 1991, 129)
Somit ist „Lesen“ mehr als es auf den ersten Blick erscheint. Es ist ein selbstgesteuerter, aktiver, scheinbar müheloser Prozess, bei dem visuelle Elemente als Zeichen interpretiert werden. Außerdem heißt Lesen, schriftliche Informationen nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu verstehen.
Lesen ist aber auch mit einem kommunikativen Aspekt verbunden. Durch das Entschlüsseln der Schrift lesen wir Informationen, die ein anderer geschrieben hat. Daher wird Schrift von einigen Autoren (u.a. Günther, K.-B.) als eigenes Sprachsystem mit eigener Struktur und Funktion bezeichnet (Günther, Klaus-B. 1995). Popppendieker meint ebenfalls, dass es sich bei der geschriebenen Sprache keinesfalls um eine Verschriftlichung der Lautsprache, sondern um einen anderen „Code der deutschen Sprache als bei der gesprochenen Sprache“ (Poppendieker 1991, 128) handelt.
Dass die Schrift keine bloße Verschriftlichung der Lautsprache ist, zeigt sich auch darin, dass sie aus formkonstanten visuellen Bestandteilen wie Graphemen und Morphemen zusammengesetzt ist. Die Morpheme sind die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten der Sprache, die Grapheme dagegen die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten der Schriftsprache. Ein Morphem besteht aus mindestens einem Phonem, das ihre Bedeutung unterscheidet. Morpheme sind entweder Lexeme, d.h. auf ihren Stamm reduzierte Wörter ohne semantischen Inhalt oder grammatische Einheiten (z.B. Tempus- oder Pluralendungen) (Pétursson u. Neppert 1996). Morpheme sind nicht mit Silben zu verwechseln, die einen Vokal enthalten müssen. So gliedert sich das Wort „gesagt“ z.B. in zwei Silben (ge-sagt), aber in drei Morpheme (ge#sag#t).
Viele Rechtschreibfehler lassen sich vermeiden, wenn die Kinder gelernt haben, Morpheme zuanalysieren. Bei dem Wort „Häuser“, sind beispielsweise viele Schreibanfänger unsicher, ob es mit <eu> oder <äu> geschrieben werden muss. Dazu muss das Kind entweder die richtige Schreibweise auswendig lernen, was nur begrenzt möglich ist, oder die richtige Schreibweise ganz einfach über das „morphemische Prinzip“ herleiten. Dazu muss im Grunde nur die Bedeutung des Wortes erkannt werden und die Fähigkeit vorhanden sein, Pluralformen in Singularformen umzuformen. Außerdem sollte das Kind wissen, dass die Wörter sogenannten Wortfamilien angehören und ihre Verwandtschaft durch ähnliche Schreibweisen zeigen. Da die Endung „er“ für eine Pluralform spricht, wird durch die Bildung des Singulars „Haus“ von dem Wortstamm „Häus“ die richtige Schreibweise offensichtlich. Dieses morphemische Prinzip steht dem phonemischen Prinzip gegenüber, dessen Kern die Graphem-Phonem-Korrespondenzregel (GPK) bildet. Die Grapheme sind als kleinste bedeutungsunterscheidende Einheiten der schriftlichen Sprache als Entsprechungen der Phoneme zu betrachten (Péturson 1996). Mit der Graphem-Phonem-Korrespondenzregel (GPK) bzw. Phonem-Graphem-Korrepondenzregel (PGK) ist gemeint, dass ein Graphem mindestens durch ein Phonem bzw. ein Phonem mindestens durch ein Graphem repräsentiert werden wird (vgl. Linke 1996).
Die GPG bildet den Mittelpunkt der „alphabetischen“ Strategie, (Günther 1995, 106), wobei der Erstleser jedes Wort in seine bedeutungsunterscheidenden, lautlichen Bestandteile (Phoneme) zerlegt, die den Lauten entsprechenden Grapheme (bedeutungsunterscheidende schriftliche Zeichen, Buchstaben oder Buchstabenkombinationen) herausfindet und diese Buchstabenfolge aufschreibt. Leider ist eine derartige lautgetreue Schreibweise häufig orthographisch falsch, da die Zuordnung von Buchstaben (Graphemen) zu Lauten (Phonemen) in der deutschen Sprache nicht immer eindeutig ist. Ein Phonem wird je nach Wort unterschiedlichen Graphemen zugeordnet und ein Graphem durch unterschiedliche Phoneme realisiert. Außerdem gibt es mehr als doppelt so viele Phoneme als Grapheme. Die Phoneme werden wie Phone durch die Zeichen des Internationalen Phonetischen Alphabets (IPA-Alphabet) (z.B. /ε/) und die Grapheme durch Buchstaben (z.B. <ä>) repräsentiert.
Nicht jedes Phon ist gleichzeitig auch ein Phonem. Die Phoneme können durch Minimalpaare, also Wörter, die sich nur durch ein Phonem unterscheiden (z.B. /haus/ und /maus/), als kleinste, bedeutungs-unterscheidende Einheit erkannt werden.
Der Terminus „ Sprachbewusstheit “ (Andresen 1985) oder „metalinguistische Bewusstheit“ bedeutet, dass ein Bewusstsein über die Sprache gebildet wurde. Diese Theorienbildung über die Sprache lässt sich in die vier Bereiche „Phonologische Bewusstheit“, Wortbewusstheit“, „Formbewusstheit“ und „Pragmatische Bewusstheit“ gliedern.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Formen metalinguistischer Bewusstheit
(nach Tunmer u. Bowey 1984, in der Übersetzung von Jansen und Marx, 1999, 8)
Das Adjektiv „phonologisch“ leitet sich von dem Nomen „Phonologie“ als den Teil der Linguistik, der sich mit der Funktion der Laute in einem Sprachsystem beschäftigt, ab.
„ Phonologische Bewusstheit bezeichnet die Bewusstheit für lautliche Elemente unterhalb der Wortebene. Das Kind kann lautliche Unterschiede, Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten zwischen den Wörtern oder Wortteilen und Wörtern erkennen und nutzen (z.B.) Reime erfinden.“ (Jansen u. Marx 1999, Hervorhebung nicht im Original)
„Der Begriff phonologische Bewusstheit nimmt explizit Bezug auf die psychologische Realität der linguistisch beschreibbaren lautlichen Phänomene.“ (Jansen u. Marx 1999, 8)
Nach Tunner und Bowey (dies. 1984) verfügt ein Kind über „Phonologische Bewusstheit“ (Jansen u. Marx 1999, 8), wenn es die lautlichen Bestandteile von Wörtern, also Phoneme, Silben und Phonemkombinationen bewusst wahrnehmen, unterscheiden, ihre Ähnlichkeiten feststellen kann und diese auch zu seinem Vorteil zu nutzen versteht, indem es z.B. Gedichte erfindet.
Von „Wortbewusstheit“ wird gesprochen, wenn das Kind Wörter als einzelne Bestandteile voneinander abgrenzen und benennen (z.B. in dem gesprochenen Satz „Klara schwimmt gerne.“, die einzelnen Wörter aufzählen) kann. Es muss aber auch die gegenständliche Bedeutung von der schriftlichen Realisierung trennen (Tunner u. Bowey 1984; Sassenroth 2000). Günther (Günther, Hartmut 1995) zeigt auf, dass Kinder, die z.B. auf die Frage nach dem längeren Wort „die ,Kuh’ vor der ,Eidechse’ nennen, noch nicht über die Wortbewusstheit verfügen, da sie die Bedeutung nicht von ihrem Zeichenträger trennen können.
Die „Formbewusstheit“ bezeichnen Tunner und Bowey (dies., 1984) als die Fähigkeit, grammatische oder semantische Fehler herausfinden und berichtigen zu können.
Als höchste metalinguistische Bewusstseinstufe sehen die Autoren (ebd.) die „ Pragmatische Bewusstheit “. Die Kinder können in Gesprächssituationen Zusammenhänge und Widersprüche zwischen mehreren Aussagen identifizieren. Dies ist eine Grundkompetenz für das Textverständnis.
Die phonologischen Bewusstheit und die Wortbewusstheit sind vor allem für die frühen Stufen des Leserwerbs bedeutsam: So ist eine beginnende phonologische Bewusstheit eine Grundvoraussetzung für die Anwendung der alphabetischen Strategie (Sassenroth, 2000). Küspert sieht eine schlecht entwickelte phonologische Bewusstheit als Ursache für spätere Lese-Rechtschreibschwächen an (Küspert 1998).
Die Formbewusstheit und die pragmatische Bewusstheit spielen beim Schriftspracherwerb v.a. beim sinnentnehmenden Lesen auf höheren Erwerbsstufen eine Rolle. Dies ist jedoch bisher, nach Jansen und Marx 1999, aber noch nicht durch Untersuchungen mit deutschsprachigen Kindern belegt worden. Es wurde aber auch bei deutschen Kindern nachgewiesen, dass Fähigkeiten im Bereich der phonologischen Bewusstheit den Schriftspracherwerb zumindest erleichtern.
Doch wann kann davon ausgegangen werden, dass ein Kind eine gute phonologische Bewusstheit entwickelt hat? Welche Fähigkeiten sind dazu notwendig?
Morais, Alegria und Content stellen die Fähigkeiten anhand einer Art dreistufigem Modell dar. Zunächst erwirbt das Kind eine „ Bewusstheit für verbundene Lautfolgen“. Es erkennt die Heterogenität zwischen den gesprochenen Wörtern oder Sätze, was sich an seinen Reaktionen erkennen lässt. Es merkt zwar, dass sich beispielsweise das Minimalpaar /tasə/ und /masə/ unterscheidet, weiß aber noch nicht wodurch.
Die phonetische Bewusstheit bezeichnet die Fähigkeit lautliche Gemeinsamkeiten zwischen Wörtern festzustellen (z.B. Alliterationen (gleicher Anfangslaut), Assonanzen (gleicher Vokal), Endreime) und so auch Reime bilden zu können. Allerdings ist es den Kindern nicht möglich, die Wörter in ihre lautlichen Bestandteile zu zerlegen.
Dies gelingt den Kindern erst, wenn sie eine phonologische Bewusstheit aufgebaut haben. Auf diesem Bewusstseinsgrad können sie die Segmente der gesprochenen Sprache richtig erkennen und bezeichnen. Sobald sie erkennen, dass nicht alle Phone bedeutungsunterscheidend sind und sich daher systematisch auf die wichtigeren bedeutungsunterscheidenden Phoneme beschränken und sie auch richtig identifizieren (z.B. /tassə/ endet mit einem /ə/), sprechen Morais, Alegria u. Content (dies. 1987) von Phonembewusstheit.
„Ähnlich wie bei lautassoziativen Leistungen muß das Kind erkennen, daß das artikulierte /k/ im Wort (/ku:/, Anmerkung der Verfasserin) und das separat gesprochene /k/ phonetische und artikulatorische Gemeinsamkeiten aufweisen phonetische und artikulatorische Gemeinsamkeiten aufweisen, wobei gleichzeitig die vorhandenen wahrnehmungsmäßigen Unterschiede als irrelevant ignoriert werden müssen.“ (Jansen und Marx 1999, 9)
Phonembewusstheit bezeichnet, laut Jansen und Marx 1999, die Fähigkeit Lautklassen zu bilden und somit beispielsweise das Phonem /k/ auch aus anderen Wörtern als bedeutungsunterscheidendes Element zu erkennen und isoliert betrachten zu können. Zunehmend findet das Kind mehr und mehr Phoneme heraus bis es sich bei der Sprachverarbeitung auf die überschaubare Zahl der ca. 50 Phoneme der deutschen Sprache „anstatt auf die demgegenüber gestellten „etwa 120-150 Sprechlaute“ (Zitzlsperger 2002, 129) konzentriert. Das Kind optimiert also seine Sprachverarbeitung, indem es nicht mehr auf für die Sinnentnahme unbedeutende phonetische Unterschiede achtet, sondern sich auf ökonomische Art und Weise auf die wichtigeren bedeutungsunterscheidenden Elemente konzentriert. Breuer und Weuffen sehen das Ausmaß der rhythmischen Differenzierungsleistungen als Indikator für die spätere erfolgreiche Schriftsprachentwicklung an (Breuer und Weuffen 1997).
2.2 Bedeutung des Lesens für gehörlose Menschen
Für hörgeschädigte Kinder sollte der Erwerb einer guten Lesekompetenz eines der wichtigsten Ziele sein. Durch die Schriftsprache können Gehörlose mit Hörenden kommunizieren, ohne Angst haben zu müssen, dass es zu Missverständnissen kommt. Es ist nur natürlich, dass auch Gehörlose, die durch optimale Ausnutzung der Hörreste, guter Ablesekompetenz und verständlicher Sprechfähigkeit mit Hörenden kommunizieren können, nicht ständig um Wiederholungen bitten möchten. Wenn etwas nicht verstanden wird, kann in solchen Fällen einfach auf die Schrift zurückgegriffen werden.
„Man muss sehen, dass die Schrift für Gehörlose nicht nur den potentiellen Stellenwert, der für Normalhörende soviel berufen und beschrieben ist, besitzt - den des Werkzeugs für vielfältigste Kommunikation auf Distanz und über Zeiten hinweg - sondern auch Einsatzfunktion für direkte mündliche Kommunikation gewährleisten muß.“ (List 1990, 48f.)
Außerdem werden viele wichtige Informationen auf schriftlichen Wege mitgeteilt. Bei der Beantwortung von Briefen von offiziellen Stellen (Versicherungen, Hausverwaltung u.ä.) und der Prüfung von Rechnungen ist ein Analphabet ständig auf Hilfe angewiesen.
Hinzu kommt, dass das Lesen im Zeitalter des Computers zusätzlich an Bedeutung gewonnen hat. Die unterschiedlichsten Informationen sind jetzt frei zugänglich. Durch die Schrift ist jetzt auch unmittelbare Kommunikation möglich z.B. durch E-mails, Schreibtelefon, SMS und Fax. Ein gehörloses Kind könnte beispielsweise ohne Handy mit SMS-Funktion nicht zu Hause Bescheid sagen, wenn es früher oder später abgeholt werden möchte oder sich verirrt hat (Bull 2000)
Außerdem ermöglicht das Lesen erst den Zugang zu höherem Bildungserwerb und einem größeren, komplexeren Wortschatz. Außerdem ist die Schriftsprache auch bei der späteren Berufswahl von großer Wichtigkeit, da ungefähr 90% aller Arbeitsplätze den Umgang mit schriftlichem Material erfordern.
Außerdem kann, u.a. laut Wöhrmann und Günther, über die Schrift die Lautsprache erlernt werden. Das Erlernen der Schriftsprache setzt u.a. nach diesen beiden Autoren nicht die Lautsprache voraus (Wöhrmann 2002, Günther, K.-B. 1996).
2.3 Schwierigkeiten gehörloser Menschen mit dem Lesen
Gehörlose Kinder können die Lautsprache nicht auf natürlichen Weg erlernen. Gerade gehörlose Kinder hörender Eltern haben daher häufig erhebliche Kommunikationsprobleme. Da sich die hörenden Eltern nicht zutrauen, sich die Gebärdensprache anzueignen oder sie sogar ablehnen, werden die Kinder rein oral erzogen in der Hoffnung, dass sie die Lautsprache erlernen. Sie lernen dabei aber leider nur Schritt für Schritt einzelne Worte, deren Bedeutung sie oft nicht erfassen können. Ein natürlicher Aufbau der Sprachkompetenz durch Interaktionen und Kommunikation wird so nicht erreicht. Durch diese Spracharmut fällt es den Kindern schwer die Schrift als Bedeutungsträger zu erkennen. Sinnentnehmendes Lesen kann so nicht erreicht werden (Wöhrmann 2002, Günther, K.-B. 2001a).
Die gehörlosen Schüler haben zudem, laut Wudke, bei ihrer Einschulung im Durchschnitt einen lautsprachlichen Wortschatz von „ca. 150 aktiven/250 passiven Wörtern“ (Wudke 2001a, 34). Demgegenüber benutzen hörende Schulanfänger bereits ungefähr 3500 aktive und 18000 passive Wörter, aus denen sie kompetent bereits recht komplexe Aufforderungen, Fragen, Aussagesätze (Relativsätze, verschiedene Zeitformen) und sogar längere Erzählungen bilden können (Wudke 2001a).
Eine Untersuchung von Klaus-B. Günther und Schulte an 500 Jugendlichen, die in den 70er Jahren eine Schule für Hörgeschädigte besucht hatten, ergab zudem, dass ungefähr die Hälfte dieser Jugendlichen funktionelle Analphabeten sind (Günther, K.-B. und Schulte 1988). Wudke führt aus, dass sich unter den nur 5% gehörlosen Jugendlichen mit sehr guten Lesefähigkeiten „überpropotional die gehörlosen Kinder gehörloser Eltern...“ (Wudke 2001a, 34) befinden.
Bei diesen beunruhigen Zahlen sollte nicht vergessen werden, dass es nach Untersuchungen der OECD-Studie zur Lesefähigkeit von Erwachsenen in Deutschland insgesamt ca. vier Millionen funktionale Analphabeten gibt, also Menschen, die erhebliche Probleme beim Lesen und Schreiben haben. Ungefähr ein Drittel der Deutschen erreicht zudem nur die Stufen eins und zwei von sechs möglichen Leseleistungsstufen, wobei die dritte Stufe ein Mindestmaß an schriftsprachlichen Fähigkeiten voraussetzt (OECD 1997). Also lernen auch viele hörende deutsche Schüler nicht richtig schreiben und lesen.
Die schlechten Leseleistungen der gehörlosen Kinder hängen, laut Wöhrmann, daran, damit zusammen, dass gehörlose Kinder sich die Lautsprache sukzessiv erarbeiten müssen und nicht auf die scheinbar mühelose Weise hörender Kinder aktiv das lautsprachliche Gespräch bestimmen können.
Da erscheint es fast rätselhaft, wie es zumindest einigen gehörlosen Schülern gelingt, den schriftsprachlichen Vorsprung der hörenden Kinder bis zu ihrem Schulabschluss einzuholen. Interessant ist dabei, dass sie bis zu ihrem 13./14. Lebensjahr jedes Jahr weiter hinter ihren hörenden Altersgenossen zurückfallen, um dann um so schneller aufzuholen. Allerdings gelingt dies vielen gehörlosen Schülern auch bis dahin nicht. Generell ist aber tröstlich, dass „das Ausbildungsniveau hörgeschädigter Schulabgänger heute höher denn je ist.“ (Müller 2002)
2.4 Mögliche Gründe für die Probleme gehörloser Menschen beim Lesenlernen
Einigen gehörlosen Menschen gelingt der Erwerb der Schriftsprache scheinbar mühelos, wohingegen die meisten jedoch Probleme haben, die Schriftsprache ohne Lautsprache zu erfassen. Das hängt damit zusammen, dass sie durch die lückenhafte Wahrnehmung der Lautsprache über kein Phonembewusstsein verfügen. Andererseits ist auch ein geringes Sprachbewusstsein mitverantwortlich. Gerade oral geförderte Kinder können auf natürlichem Weg die Sprache nicht adäquat erwerben, da ihnen die Gebärdensprache verschlossen bleibt. Generell soll im folgenden Teil geprüft werden, ob bilingual geförderte Kinder beim Erwerb der Schriftsprache wirklich im Nachteil sind.
Herbert Günther betrachtet die deutsche Schrift lediglich als eine „Lautschrift“ (Günther, Herbert 1997, 36), durch die es ermöglicht wird, durch wenige Schriftzeichen fast jede Lautfolge niederzuschreiben. Somit ist das „geschriebene Wort ... ein Modell des gesprochenen Wortes“ (Günther, Herbert 1997, 36). Beim Lesen setzen die Lernenden die einzelnen Buchstaben in Laute um und verbinden sie zu einem „Wortklang...(Phonemsynthese)“ (ebd.), während sie beim Schreiben genau umgekehrt das gesprochene Wort in Einzellaute „segmentieren (Phonemanalyse)“ (ebd.).
Klaus-B. Günther und Wudke glauben im Gegensatz zu Herbert Günther nicht an die „Schrift als Modell der Lautsprache“ (Günther, Hartmut 1995, 15). Die Autoren betrachten die deutsche Schriftsprache als „relativ autonomes“ Schriftsystem. Damit ist gemeint, dass die Schrift nicht derart eng an die Lautsprache gebunden ist wie bisher angenommen wurde. Daher spielt die alphabetische Strategie für Klaus-B. Günther auch keine große Rolle. Auch bei hörenden Kindern werde sie bald abgelöst durch die visuell orientierte orthographische Strategie, die bei dem Entcodieren der Schrift Erfolg versprechender ist. Die deutsche Schriftsprache orientiert sich nämlich nicht nur phonologischen Regeln, sondern auch an orthographischen Regeln. Gerade die morphematischen Regeln der deutschen Sprache lassen sich besser visuell erschließen (Tag/Tag#e), da gerade die Auslautverhärtungen oft zu Schreibfehlern führen. Wortstämme und Wortfamilien sind häufiger visuell zu erkennen, während sie auditiv nicht auffallen (Haus/Häuser) (Wudke 2001a, Günther, K.-B. u.a. 2001a).
Außerdem wies K.-B. Günther bereits 1994 nach, dass die Verarbeitung und Wahrnehmung der alphabetischen Schrift die Möglichkeiten des Auges unterfordert. Informationen können visuell viel schneller verarbeitet werden als auditiv. Die Unterscheidung und Wahrnehmung der Buchstaben ist einfacher als die Entschlüsselung der Lautsprache (Günther, K.-B. 1994).
„Neben der Einfachheit der Buchstabenformen gibt es drei...Merkmale, die die Wahrnehmung und gedächtnismäßige Speicherung der schriftlichen Zeichenformen im Vergleich zur gesprochenen Sprache erleichtern: Materialisierung, Dauerhaftigkeit und unbeschränkt wiederholbare Abrufbarkeit.“ (Günther, 1994, 28/29, im Original Hervorhebung durch Fettdruck)
Die Sprachverarbeitung über das Auge fällt gehörlosen Kinder genauso leicht wie hörenden Kindern; oft sind gehörlose Kinder durch die Gebärdensprache (insbesondere gehörlose Kinder gehörloser Eltern) darin sogar viel geübter.
Die Schriftsprache ist also keine bloße Lautschrift, sondern ein funktional und strukturell autonomes System, das gehörlose Kinder nicht nur ohne Lautsprache, sondern in Einzelfällen sogar als Erstsprache erlernen können. So verweisen Steinberg und Harper auf einen 2;5 Jahre alten gehörlosen Jungen, der innerhalb von 15 Monaten ohne Lautsprache und Gebärdensprache 400 schriftsprachliche Wörter und 242 Phrasen lernte und so in der Lage war, einfache Texte zu erlesen (Steinberg und Harper 1983). Dies ist natürlich nicht die Regel, zeigt aber, dass solche Methoden auch möglich sind. Interessant ist allerdings, dass nach Wudke die gehörlosen Jugendlichen gehörloser Eltern unter den wenigen gehörlosen Schulabgängern, die über eine gute Lesekompetenz (ca. 5%) verfügen, proportional am häufigsten vertreten sind (Wudke 2001a). Offensichtlich fällt der Leseerwerb gehörlosen Schülern mit einer ausgeprägten Gebärdensprachkompetenz bzw., die schon früh und auf natürliche Weise die Gebärdensprache erlernen konnten, leichter.
Es darf nicht vergessen werden, dass die Gebärdensprache ein eigenständiges Sprachsystem ist, d.h. sie „verfügt über eine eigene Grammatik, eigene Idiome“ (Wudke 2001b, 36) (Redewendungen) und lautsprachlich orientierte, aber auch von der Lautsprache unabhängige Mundbilder, die eine bedeutungsunterscheidende Funktion haben (Wudke 2001b). Für Hörende ist das Erlernen der Gebärdensprache mit dem Erlernen einer Fremdsprache zu vergleichen. Daher können durch den Gebärdenspracherwerb metalinguistische Fähigkeiten entwickelt werden, die den Schriftspracherwerb erleichtern können. Die in Kap. 3.2 beschriebenen Unterschiede zwischen Laut-Gebärden- und Schriftsprache können, laut Wudke, als Chance gesehen werden, wobei auch das Kind als Entdecker fungieren kann (Wudke 2001a). Van Uden dagegen glaubt, dass adäquater Schriftspracherwerb nur mit Hilfe der Lautsprache möglich ist und die Gebärdensprache den Lernprozess behindern kann.
Der Autor führt aus, dass gehörlose Kinder, die fast ausschließlich die Gebärdensprache benutzen, nur den Lesestand neun-jähriger normalhörender Kinder erreichen, da sie das Gedächtnis für Wörter beeinträchtige und nur über beschränkte Ausdrucksfähigkeiten verfügen (van Uden 1980). Diese Ansicht kann heute als überholt betrachtet werden. K.-B. Günther und Prillwitz u.a. sehen die Gebärdensprache als komplexes Sprachsystem mit eigenen grammatischen Regeln, deren Erwerb auch aus kulturellen Gründen (Gehörlosengemeinschaft) gefördert werden sollte (Prillwitz 1985 u. Günther, K.-B. 1990). Kann die Gebärdensprache aber wirklich beim Erwerb der Schriftsprache die Rolle der Lautsprache übernehmen? Viele Autoren wie Löwe und Schmid-Giovaninni bestreiten das (Löwe 2001, Schmid-Giovannini 1996). Löwe hält das innere Sprechen, das eng mit einer guten Lautsprachkompetenz verknüpft ist, für eine Grundvoraussetzung für das sinnentnehmende Lesen (Löwe 2001).
„Für das guthörende Kind ist die verinnerlichte Lautsprache, auch inneres Sprechen genannt, nicht nur für Denkprozesse wichtig, sondern sie bildet auch die Grundlage von der aus Lesen und Schreiben entwickelt werden.“ (Löwe 2001, 270)
Davon ausgehend hält er es für sinnvoll, gehörlosen Kindern eine frühe Hör- und Sprecherziehung und damit einen Zugang zu dem inneren Recodieren zu ermöglichen. Diese Meinung stützt er, indem er auf eine breit angelegte Studie von Geers und Moog verweist, an der ca. 50% ausschließlich oral unterrichtete Jugendliche teilgenommen haben und herausgefunden wurde, dass fast ein Drittel dieser Jugendlichen eine altersgemäße Schriftsprachentwicklung aufwies. Damit zeigten sie bessere schriftsprachliche Fähigkeiten als bisher insgesamt bei den hörgeschädigten Jugendlichen in den USA festgestellt wurden, wo die gehörlosen Schüler in der Regel bilingual oder mit totaler Kommunikation unterrichtet werden (Löwe 2001, Geers und Moog 1989).
Laut einer Untersuchung nach Conrad liegt zudem das Lesealter gehörloser Jugendlicher, die das innere Recodieren beim Lesen anwenden, ungefähr anderthalb bis zweieinhalb Jahre über dem Lesealter gehörloser Jugendlicher, die sich die Texte rein visuell erschließen (Conrad 1979). Nach einer Untersuchung nach Lewis und nach Geers und Moog liegt das Lesealter aural geförderter sogar vier Jahre über dem von mit Total Communication geförderter Jugendlicher (Geers und Moog 1989).
Die Autoren dieser Studien ziehen aus den hier beschriebenen Beobachtungen den Schluss, dass die orale Methode der bilingualen Förderung überlegen ist. Löwe teilt diese Ansicht und erklärt die Probleme Gehörloser beim Schrifterwerb damit, dass Hörschäden zu spät entdeckt und die Früherziehung nicht konsequent und früh genug durchgeführt wird (Löwe 2001)
Diese Interpretation ist aber etwas vorschnell. So weist Günther darauf hin, dass in den Untersuchungen ebenfalls herausgefunden wurde, dass die aural geförderten Jugendlichen kein altersgemäßes Leseniveau erreichen, sondern ca. drei Jahre hinter ihren hörenden Altersgenossen zurückbleiben. Außerdem kritisiert Günther, dass keine Details über die Intelligenz oder andere individuellen Unterschiede zwischen den Jugendlichen berichtet werden. Günther glaubt daher, dass sich die Lesekompetenz der aural geförderten Gehörlosen vermutlich auch auf die besonders hohe Leistungsfähigkeit der ausgewählten Jugendlichen zurückzuführen ist. Zudem sind auch in Hamburg beim bilingualen Schulversuch gute Lesefertigkeiten bei gehörlosen Kindern durch bilinguale Erziehung erreicht worden. Die auditiv-verbale Methode ist also nicht die einzige erfolgversprechende Methode.
Es ist, laut Günther, ein Zufall, dass wir den Mund und das Ohr zur Kommunikation benutzen. Genauso gut hätten es die Hände und die Augen sein können. Vermutlich ist dies aber nicht eingetreten, da die Menschen die Hände meist zum Arbeiten gebrauchen mussten (Günther 1983).
Die Bedeutung der visuellen Hilfen wurde aber nicht nur für gehörlose Kinder erkannt. Selbst für hörende Kinder mit Lese-Rechschreibschwächen werden Gebärden benutzt, um den Schriftspracherwerb zu erleichtern (u.a. Burger 2002).
Insbesondere die gehörlosen Kinder hörender Eltern haben, laut Wöhrmann, oft bei der Einschulung erhebliche sprachliche Defizite. Durch frühe Hör- und Sprecherziehung lernen sie zwar einige Wörter zu sprechen, können sich aber über die Lautsprache nicht adäquat mit ihren Eltern verständigen. Sie haben durch die hörgerichtete Erziehung keine richtige Vorstellung von Kommunikation und Interaktion, da viele hörende Eltern immer noch glauben, die Gebärdensprache könnte dem Kind schaden und nicht glauben, dass sie selbst die Gebärdensprache erlernen könnten. Leider lernt das Kind bedingt durch seine rudimentäreren Lautsprachkenntnisse nicht, Fragen zu stellen und zu beantworten, Wünsche zu äußern o.ä. Es ist vollkommen hilflos, da es sich kaum mit anderen Menschen verständigen kann.
Die phonologische Bewusstheit und die Wortbewusstheit sind vor allem für die frühen Stufen des Leserwerbs bedeutsam: So ist eine beginnende phonologische Bewusstheit eine Grundvoraussetzung für die Anwendung der alphabetischen Strategie (Sassenroth, 2000). Herbert Günther geht sogar noch weiter:
„In der phonologischen bzw. phonematischen Bewusstheit für das Schreiben und Lesen liegt der Schlüssel und das Geheimnis für den Schriftspracherwerb. Die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für das Lesen und Schreiben ist heute international wie national unumstritten. Keine andere Leistung korreliert so hoch mit dem Schriftspracherwerb wie die Fähigkeit, die gesprochene Sprache in lautliche Elemente zu gliedern.“ (Günther, Herbert 1997)
Die Formbewusstheit und die pragmatische Bewusstheit spielen, laut Grimm (ders. 1995), beim Schriftspracherwerb v.a. beim sinnentnehmenden Lesen auf höheren Erwerbsstufen eine Rolle. Dies ist jedoch bisher, nach Jansen und Marx 1999, aber noch nicht durch Untersuchungen mit deutsprachigen Kindern belegt worden. Es wurde aber auch bei deutschen Kindern nachgewiesen, dass Fähigkeiten im Bereich der phonologischen Bewusstheit den Schriftspracherwerb zumindest erleichtern.
Die Meinung, dass Phonembewusstsein als unverzichtbare Voraussetzung für den Leseerwerb anzusehen ist (u.a. van Uden; Schmidt-Giovanini), wird von einigen Autoren (u.a. Günther 2001) bestritten. Allerdings ist sie für die Anwendung der alphabetischen Strategie, die Reichen (ders. 2001) als besten Weg zum Leseerwerb betrachtet unbedingt notwendig, da beim alphabetischen Lesen die zu erlesenden Buchstaben den entsprechenden Phonemen zugeordnet werden müssen. Interessant ist dabei, dass einige Lautunterschiede durch die Einteilung der Laute in Phoneme gar nicht mehr gehört werden und manche Phoneme sogar zu Phonemgruppen zusammengefasst werden.
Die Phoneme /e:/ und /ε:/ werden oft nicht unterschieden. Das /ε:/ wird auch in Wörtern, in denen es mit dem Buchstaben „e“ verschriftet wird, als das Phonem /e:/ bezeichnet. Kinder orientieren sich in ihrer Leseentwicklung damit zunehmend an den Buchstabenbezeichnungen und analysieren die Phoneme schließlich nicht mehr, womit sie bessere Erfolge erzielen (Jansen u. Marx 1999).
Die Alternative, das Erkennen von Wörtern anhand ihres Wortbildes, kommt dagegen, laut Jansen und Marx bei hörenden deutschsprachigen Kindern mit einer normalen Leseentwicklung im Schulalter nur kurz oder nicht vor (u.a Jansen und Marx 1999, Wimmer 1990).
Die logographemische Strategie ist bei gehörlosen Kindern allerdings auch im Schulalter über einen längeren Zeitraum anzutreffen (Günther, K.-B. u.a. 2001a). Van Uden schlägt daher einen intensiven frühen Artikulationsunterricht vor, durch den die Kinder diese Strategie trotzdem anwenden sollen (van Uden 1976). Günther glaubt dagegen, dass gerade gehörlose Kinder bessere Erfolge erzielen, wenn sie die logographemische Strategie, die durch spezielle Übungen (vgl. Kap. 2) verfeinert werden kann, anwenden, Dieser Weg ist leichter für gehörlose Kinder und nicht negativ zu bewerten, da die deutsche Schriftsprache kein eindeutiges Modell der Lautsprache ist. Die Phonembewusstheit bildet schließlich auch nur einen Aspekt der Sprachbewusstheit insgesamt. Metalinguistische Fähigkeiten können auch über die Gebärdensprache entwickelt werden.
Der Schrift-, Laut- und Gebärdensprache liegen ähnliche Verstehensprozesse zu Grunde. So ist das Lesen und das Verstehen von Gebärden über das Auge mit dem Zuhören bei der lautsprachlichen Kommunikation vergleichbar, da in allen Fällen Sprachverarbeitungsprozesse zu Grunde liegen. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass es sich bei der Deutschen Schriftsprache um ein alphabetisches und nicht um ein logographisches Schriftsystem wie das Chinesische handelt (Günther, K.-B. 2001a).
„Aber auch die alphabetischen Schriftsysteme weisen – wie nicht zuletzt die Erwerbsprobleme nichtbehinderter Kinder zeigen – z.T. erhebliche Inkonsistenzen zwischen der phonologischen und der graphologischen Ebene auf.“ (Günther 2001a, 68)
Außerdem sollte nicht ignoriert werden, dass auch die Gebärdensprache und die Lautsprache viele Gemeinsamkeiten gegenüber der Schriftsprache aufweisen.
Tabelle 1: Einige physische und funktionelle Aspekte von Laut-, Gebärden- und Schriftsprache (aus: Strömquist 1994, 346)
Lautsprache Gebärdensprache Schriftsprache
Dauerhaftigkeit des
Signals - - -
Graphen, visuell - - +
Sprechapparat, auditiv + - -
Hände und Gesicht, visuell + + -
simultane Multidimensionalität + + -
On-Line Interaktion + + -
Die Gebärdensprache und die Lautsprache unterscheiden sich, laut Strömquist, in vielen Aspekten von der Schriftsprache (vgl. Tabelle 1). So ist ein Text dauerhaft, besteht aus graphischen Zeichen, weist selten „simultane Multidimensionalität“ (Strömquist 1994, 345), gleichzeitige Verwendung mehrerer Ausdrucksebenen, z.B. Mimik und Raum bei der Gebärdensprache oder Intonation bei der Lautsprache, auf und setzt keine „On-Line-Interaktion“ (ebd.) voraus. Mit dem Terminus „On-Line-Interaktion“ meint Strömquist, dass „Sender und Adressat gleichzeitig anwesend“ (ders. ebd.) sein müssen, damit eine Unterhaltung überhaupt stattfinden kann. Dies ist bei der Gebärdensprache und der Lautsprache in der Regel notwendig (Ausnahmen sind Video- oder Tonaufnahmen), während die Schriftsprache normalerweise verfasst wird, wenn oder gerade weil der Empfänger gerade nicht anwesend ist. Beim Sprechen und Gebärden wird daher ein sofortiges Feedback und somit eine ständige Anpassung an den Empfänger der Botschaft möglich.
Wie Strömquist folgerichtig ausführt, sind Gebärdensprache und Lautsprache im Gegensatz zur Schriftsprache nur von sehr kurzer Dauer, abgesehen natürlich von Videoaufnahmen, während Geschriebenes sogar über Jahrhunderte erhalten bleiben kann. Eine Ausnahme bilden e-mails und das Chatten, wobei die Informationen oft bald nach Erhalt wieder gelöscht werden. Dennoch sind diese Informationen immer noch dauerhafter als gebärdete oder lautsprachliche Informationen, da sie zumindest wortwörtlich gespeichert werden könnten.
Zum Aspekt der Multidimensionalität lässt sich festhalten, dass Schriftsprache zumindest manchmal multidimensional sein kann. Durch Fettdruck, Kursivdruck oder typographische Zeichen können ebenfalls einige Informationen, die über den wörtlichen Sinn hinausgehen, vermittelt werden. So werden in E-mails häufig die Interpunktionszeichen Doppelpunkt und Klammer benutzt, um ein lachendes bzw. trauriges Gesicht darzustellen. Damit drückt der Sender aus, ob er die vorangegangene Nachricht positiv oder negativ bewertet (Strömquist 1994).
Derartige Ausdruckmittel wie Gestik, Mimik und Prosodie werden beim Gebrauch von Gebärdensprache und Lautsprache aber noch in weit höherem Maße benutzt und können den Sinn sogar vollkommen verändern (z.B. Ironie) (Strömquist 1994). Gehörlosen fällt es auch oft schwer, solche versteckten Ausdrucksebenen wie Aufforderungs- oder Fragecharakter von lautsprachlichen Äußerungen oder Sarkasmus zu verstehen, da sie die lautsprachliche Prosodie nicht von den Lippen ablesen bzw. durch ihre Hörreste erschließen können. Umgekehrt ist das Erfassen der ausgeprägten Mimik bei der Gebärdensprache für Hörende nicht immer leicht.
Die Schriftsprache wird als einziges Schriftsystem durch visuell wahrnehmbare Graphen ausgedrückt. Die Lautsprache wird dagegen durch den Sprechapparat ausgedrückt, auditiv wahrgenommen und durch nicht-sprachliche Kommunikationsmittel wie Gesten und Mimik unterstützt. Die Gebärdensprache wird dagegen visuell wahrgenommen und durch Gebärden und Mimik repräsentiert.
Nach der Tabelle von Strömquist gibt es bezüglich der physischen und funktionalen Aspekte der Laut- und Gebärdensprache einen wesentlichen Unterschied im Bereich des Sprechapparates, während die Schriftsprache in diesem Bereich mit der Gebärdensprache übereinstimmt und davon abgesehen keine Gemeinsamkeiten mit den beiden anderen Sprachsystemen aufweist. Der Sprecher erhält, laut Strömquist, eine auditive Rückkopplung, wobei seine Stimme für ihn fast genauso klingt wie für seinen Gesprächspartner. Die gebärdende bekommt genau wie die schreibende Person stattdessen eine visuelle Rückkopplung, indem sie sich ihre Hände bzw. das Geschriebene ansieht. Bei der Gebärdensprache wird diese Rückkopplung allerdings erschwert, da der Gebärdende sich seine Hände aus einer anderen Perspektive als sein Gegenüber anschaut und zudem seine Mimik, die bei der Gebärdensprache nicht selten bedeutungsunterscheidend ist, nicht überprüfen kann (Strömquist 1994). In dieser Hinsicht ist es schwieriger, gebärdensprachliche als lautsprachliche Informationen zu verarbeiten, da sich der Adressat in die Perspektive des Gebärdenden hineinversetzen muss. Dies setzt z.B. beim Versuch, gebärdensprachliche Wegbeschreibungen (v.a. rechts und links) zu verstehen, ein großes Maß an räumlicher Vorstellungskraft voraus, da der Sender diese Mitteilungen aus seiner Perspektive darstellt. In dieser Hinsicht ist die Verarbeitung direkter lautsprachlicher Informationen leichter als die Verarbeitung visueller Informationen. Außerdem bemerkt die gebärdende Person nicht so schnell, wenn sie sich sozusagen vergebärdet. Dies liegt daran, dass die visuelle Rückkopplung aus den oben genannten Gründen nicht so vollständig ist und auch nicht leicht fällt wie bei lautsprachlicher Kommunikation. Schließlich sollte der Gebärdende auch zwischendurch seinen Gesprächspartner anschauen, anstatt nur auf seine Hände, um dessen Reaktionen auf das Berichtete erkennen zu können.
Die Gebärdensprache und die Lautsprache haben also mehr miteinander gemeinsam als die Schriftsprache mit einem der anderen Systeme. Interessant ist aber auch, dass der Sprachfluss von Laut-Gebärden und Schriftsprache sehr unterschiedlich ist. So muss ein Schreibanfänger zum Schreiben eines Wortes sehr viel mehr Zeit und Mühe investieren als zum Gebärden oder Sprechen desselben Wortes. An diesen Umstand muss er sich erst einmal gewöhnen.
Informationen durch die Gebärdensprache mitzuteilen nimmt ungefähr die gleiche Zeit in Anspruch wie wenn dieselben Inhalte lautsprachlich mitgeteilt werden. Erstaunlich ist dabei, dass nach einer Studie Klima und Bellugi von 1979 in derselben Zeit ungefähr doppelt so viele Wörter gesprochen als gebärdet werden können (Klima und Bellugi 1979). Dies wird durch die nach u.a. Strömquist in der Gebärdensprache umfassender genutzten Ausdrucksebenen wie Gebärdenraum (viele Präpositionen werden überflüssig) und Mimik kompensiert (Strömquist 1994)
Außerdem beschränkt sich die Gebärdensprache auf die für die Bedeutung wichtigsten Begriffe und enthält, laut Wudke, nicht soviel Redundanz wie die Lautsprache und die Schriftsprache (Wudke 2001a). Strömquist zeigt anhand seiner Untersuchung auf, dass bei einem schriftlichen Text nicht nur länger gebraucht wird, um ein Wort zu schreiben, sondern auch noch viel mehr Zeit für Denkpausen als bei Gebärdensprache oder Lautsprache benötigt wird.
„Die Pausenquote beim Schreiben lag bei 61,2% d.h. mehr als doppelt so hoch als beim Sprechen (27,8%) und mehr als viermal so hoch wie beim Gebärden (14,6%).“ (Strömquist 1994, 348)
Zudem sind diese Pausen viel länger (7 bis 34 Sekunden gegenüber durchschnittlich 2 Sekunden bei der Lautsprache). Der Sprecher oder die gebärdende Person darf auch keine zu langen Pausen machen, da der Adressat sonst bald das Interesse verlieren würde. Der Schreibende kann sich mehr Zeit lassen und seinen Text genau planen, da er davon ausgeht, dass dieser erst später, und zwar insgesamt, gelesen wird.
Laut Günther wird die Gebärdensprache zudem auf ähnliche Weise wie Laut- und Schriftsprachen hauptsächlich in der linken Hemisphäre des Gehirns (Günther, K.-B. 1996) verarbeitet. Auch der Gebärdenerwerb verläuft ähnlich wie der Lautspracherwerb. Wesentliche Unterschiede bestehen jedoch darin, dass beispielsweise „die ersten Ein-Gebärden Äußerungen ... etwa ein halbes Jahr früher“ (Günther, K.-B. 1990, 300) auftreten als die damit vergleichbaren „Ein-Wort-Sätze bei gehörlosen Kleinkindern.“ (ebd.) Dies hängt mit der früheren Entwicklung der visuellen Wahrnehmung gegenüber der auditiven Wahrnehmung zusammen. Andererseits ist das Erlernen der Syntax und Morphologie der Gebärdensprache zeitintensiver. Somit treten Zwei-Gebärden-Äußerungen auch etwas später auf als Zwei-Wortsätze beim hörenden Kind (Günther 1990). Es lässt sich also erkennen, dass die Gebärdensprache ebenso komplex ist wie die Lautsprache und der Schriftsprache bezüglich des Wahrnehmungskanals sehr ähnelt.
Für den Erstleseunterricht ergibt sich aus diesen Ausführungen die Konsequenz, dass diese Unterschiede für die Kinder nicht ohne weiteres einzusehen sind. Da Lesen und Schreiben besonders zu Beginn soviel Zeit in Anspruch nimmt, sollte, laut Reichen und Günther, nicht so sehr auf Schönschrift geachtet werden, eine alternative Möglichkeit wie z.B. Buchstabenstempel zur Verfügung gestellt und mit Druckschrift statt Schreibschrift begonnen werden. Auf diese Weise geht die Schreib- und Lesemotivation nicht so leicht verloren. Wichtiger als Schönschrift und gut artikuliertes Vorlesen ist es, den Kindern den kommunikativen Charakter der Schrift z.B. durch das Schreiben von Briefen und Botschaften offen zu legen (u.a. Reichen 2001; Günther, K.B. u.a. 2001a). Die Einsicht in den kommunikativen Charakter der Schrift durch das Schreiben und Lesen von Botschaften hält Reichen für das sinnentnehmende Lesen für unerlässlich (Reichen 2001).
So bildet das Freie Schreiben eine Voraussetzung für das sinnentnehmende Lesen. Außerdem sollte der Lehrende den Schülern die Chancen vergegenwärtigen, die sich ergeben, wenn man das, was man zu sagen hat, detailliert planen kann und so Missverständnissen vorbeugen kann. Es sollte aber auch verständlich sein, dass nonverbale Ausdrucksmittel bei der Schrift durch genauere Erklärungen kompensiert werden müssen.
[...]
- Arbeit zitieren
- Katrin Merten (Autor:in), 2003, Erstlesen mit gehörlosen Kindern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139727
Kostenlos Autor werden




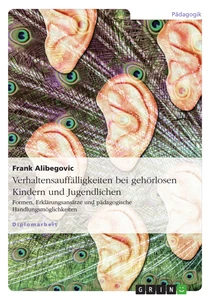











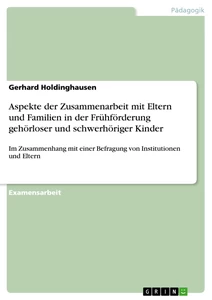





Kommentare