Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Phänomen Serienmord: Allgemeines und Definition
3. Multifaktorielle Entwicklung zum Serienmörder
3.1 Sozialisation
3.2 Bindung und Beziehung
3.2.1 Bindungsphasen
3.2.2 Bindungsmuster
3.2.3 Bindungsstörungen
3.3 Identitäts- und Sexualitätsentwicklung
3.4 Paraphilien
3.4.1 Sodomie
3.4.2 Pädosexualität
3.4.3 Sadismus
3.5 Serienmord und Antisoziale Persönlichkeitsstörung
3.5.1 Die antisoziale Persönlichkeitsstörung
3.5.2 Die antisoziale Persönlichkeitsstörung und Straftäter
4. Serienmörder
4.1 Situations- und Persönlichkeitstäter
4.2 Tatmotivierende risikorelevante Problembereiche
4.3 Zur kriminogenen Dynamik von Hoch-Risiko-Phantasien
4.4 Implizite Theorien und ihre tatmotivierende Bedeutung
4.5 Psychische Verlaufsphasen zu sexualpathologischen Tötungsdelikten
5. Fallbeispiel Frank Schmökel
5.1 Kurzbiographie und kriminogene Dynamik
5.2 Persönlichkeitsanalyse
6. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis/Quellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
„Immer verunsichert das Eintreten eines Serienmörders viele Mitbürger, schränkt sie in ihrem Verhalten ein, stört die Geborgenheit der engsten Umwelt und verleitet zu radikalen Forderungen an Politik und Polizei. Das macht die Beschäftigung mit den Serientätern so notwendig und rechtfertigt jeden Aufwand, unerkannte Serientäter als solche zu entlarven, sie aufzuspüren und dingfest zu machen“ (Hamacher 2002, S. 8).
Hans-Werner Hamacher erläutert soziologisch, warum das Phänomen Serienmord einer expliziten Aufschlüsselung bedarf, was Motive und Auslöser für das Begehen serieller Straftaten angeht. Die Befassung mit der tiefgreifenden Komplexität tatmotivierender und tatauslösender Faktoren, soll somit Ziel dieser Arbeit sein.
Zu Beginn wird zunächst eine allgemeine Definition von Serienmord gegeben, während im Anschluss daran, der Fokus auf der multifaktoriellen Entwicklung zum Serienmörder[1] liegt. Im Rahmen dieser theoretischen Hintergründe, soll insbesondere die Sozialisation der zukünftigen Täter, ihre Bindungsbeziehungen und ihre Identitätsentwicklung näher betrachtet werden, um den Fragen nach den Auslösern für eine sexualpathologische Entwicklung nachzugehen.
Die Komplexität des Phänomens Serienmord wird weiterführend anhand von risikosteigernden Fehlentwicklungen im Kindes- und Jugendalter erklärt, zu denen oftmals Paraphilien wie Pädophilie, Sadismus, Sodomie und - als höchste Steigerung - der Sexualmord zählen. Es wird versucht, mit Hilfe gängiger Forschungsliteratur ein Täterprofil zu erstellen und sich mit den psychischen Innenwelten der Täter zu befassen, um eine möglichst umfangreiche sexualpathologische Topographie zu konstituieren. Pädophile, sadistische und anderweitig pervers-pathologische Vorlieben werden oftmals von Persönlichkeitsstörungen begleitet, unter denen die antisoziale Persönlichkeitsstörung die häufigste Komorbidität darstellt. Auf deren Ätiologie wird im Zusammenhang mit Serientätern im Anschluss kurz eingegangen.
In einem nächsten Schritt, nachdem sämtliche Motive und Auslöser zu einem Täterprofil des Phänomens Serienmord geführt haben, werdem die psychischen Innenwelten der Täter aus pädagogischer und psychologischer Distanz heraus betrachtet. Hierzu zählt vorerst die Unterscheidung zwischen sogenannten Situations- und Persönlichkeitstätern. Im Anschluss daran, werden die psychischen Verlaufsphasen der Täter detailliert dargestellt und im Zusammenhang mit den höchst problematischen Hoch-Risiko-Phantasien und den risikorelevanten Problembereichen erläutert.
Anhand von Frank Schmökel wird das theoretisch nachvollzogene Konstrukt Serienmord auf das Fallbeispiel von Frank Schmökel übertragen. Schmökel wurde wegen mehrfacher Vergewaltigung und einem begangenen Mord verurteilt, floh sechsmal innerhalb von sechs Jahren aus dem Maßregelvollzug und ist seit dem Jahre 2000 endgültig inhaftiert. Auf den ersten Blick ist Schmökel nicht als Serienmörder zu identifizieren, da er „nur“ einen einzigen Mord verübte. Welche Gründe jedoch dafür sprechen, Schmökel eindeutig als Serientäter mit sexualpathologischem Hintergrund zu definieren, wird in der Persönlichkeitsanalyse herausgestellt.
2. Phänomen Serienmord: Allgemeines und Definition
Das Phänomen Serienmord erregt immer wieder großes Aufsehen in der Gesellschaft - doch warum? Diese Reaktion ist eigentlich erstaunlich, da die Existenz von Serientätern bei Weitem nicht neu ist (vgl. Hamacher 2002, S. 7). Vielmehr ist es so, dass „Serienmord auf der ganzen Welt in vielen verschiedenen Formen auftritt und von den verschiedensten Menschen begangen wird“ (Couter 2000, S. 8), sodass es als ein globales und soziales Menetekel gilt (vgl. Harbort 2001, S. 20). Im Zeitraum von Anfang 1995 bis Mitte 2000, wurden weltweit über 229 Serienmörder registriert und verübten insgesamt 2836 Morde (vgl. Foerster 2013b, S. 3). Den größten Anteil dieser Statistik machen die in den USA verübten Tötungsdelikte aus, doch auch in Deutschland (exklusive der damaligen DDR) waren zwischen 1945 und 2000, 421 serielle Tötungsdelikte bekannt (vgl. ebd.). Die Wahl der ausschließlich männlichen Form Serienmörder, gründet sich aus der Statistik, dass für die in Deutschland begangenen Morde 67 Männer und lediglich acht Frauen verantwortlich gemacht werden konnten. Das generische Maskulinum schließt die unterlegene Anzahl weiblicher Serientäter obgleich mit ein. Darüber hinaus gab es jedoch viele ungeklärte Mordserien und den Verdacht, dass nicht jedem Täter alle tatsächlich verübten Morde nachgewiesen werden konnten. Hinzu kommt, dass in der Statistik „solche Mörder gänzlich unberücksichtigt geblieben [sind], die dem typischen Persönlichkeits- und Verhaltensprofil des Serientäters entsprechen, glücklicherweise aber schon nach ihrer ersten Tat dingfest gemacht werden konnten“ (Harbort 2001, S. 21). Diese Tatsachen lassen die Vermutung zu, dass die Statistik nur geringfügig das Ausmaß der reellen Bedrohung durch Serienmörder repräsentiert und von einer deutlich höheren Dunkelziffer ausgegangen werden muss, insbesondere bei steigender Tendenz verübter Serienmorde.
Stephan Harbort führt das Interesse und die Medienpräsenz derartiger Verbrechen auf die verbesserten Informationsmöglichkeiten, explizit seit den 1970er Jahren, zurück. Somit wurden regionale Geschehnisse überregional bekannt und insbesondere die vermehrte Berichterstattung über Serientäter, verstärkte die allgemeine Verbrechensfurcht (vgl. ebd.). In Folge dessen wurden Forderungen der Prävention laut, um dieser schlimmsten Form des Verbrechens vorzubeugen. Dazu ist das Wissen über die Ursachen und das Ausmaß des Geschehens erforderlich; da es an diesem Wissen jedoch mangelt, erwies sich die Prävention folglich problematisch (vgl. ebd.). Bevor jedoch im weiteren Verlauf die Innenwelten der Täter, ihre Motive und Antriebe thematisiert werden, soll zunächst ein Überblick über eine Definition des Phänomens Serienmord gegeben werden.
Der unter Mehrfachmord fallende Begriff Serienmord, wurde lange Zeit als eine Form von Massenmord angesehen und erlangte erst Ende der 1950er Jahre eine Differenzierung innerhalb der Kriminologie (vgl. Newton 2002, S. 357). Bis dahin wurde sowohl unter Serien-, als auch unter Massenmord, ganz allgemein die Ermordung mehrerer Opfer verstanden. Unter Massenmord versteht man heutzutage das Töten von vier oder mehr Opfern am selben Ort und zur selben Zeit (vgl. ebd., S. 258). Dass „Serienmord, also das aufeinanderfolgende Töten von Opfern in Serie“ (ebd., S. 357, Hervorhebung i.O.) ein grauenhaftes und durchaus problematisches Phänomen ist, welches einer alleiningen expliziten Klassifizierung und Differenzierung bedarf, wird somit deutlich.
Zunächst erscheint die Definition eines Serienmordes im FBI-Handbuch Crime Classification Manual aus dem Jahre 1992 ausreichend, indem Serienmord als ein Verbrechen definiert wird, bei dem drei oder mehr zeitlich getrennte Geschehnisse an drei oder mehr unterschiedlichen Orten geschehen und zwischen den Morden eine emotionale Abkühlperiode liegt (vgl. ebd.). Als Problem an dieser Definition erweist sich jedoch, dass das FBI zwar zwischen einfachem Mord, Doppelmord, dreifachem Mord, Massenmord und Mordorgien (Spree-Mord) unterscheidet, eine längere Zeitspanne bis zum nächsten Mord hingegen exkludiert. Somit kann ebenso gut der Fall eintreten, dass einige Monate, wenn nicht sogar Jahre zwischen dem ersten und dem darauffolgenden Mord liegen (vgl. ebd., S. 358). Hinzu kommt, dass nicht alle Mörder, die in Serie getötet haben und demnach als Serienmörder bezeichnet werden müssten, ihre Morde an unterschiedlichen Orten vollstreckt haben, so wie es das FBI deklariert. Als drittes schwer lösbares Problem, erweist sich die sog. Abkühlperiode, die auch unter dem Namen Cooling-Off-Period bekannt ist. Auch hierbei muss die Definition des FBI kritisch betrachtet und anschließend eingeschränkt werden, da eine eingegrenzte Dauer dieser Abkühlperiode nicht expressis verbis festgelegt werden kann. Diese Periode kann von unterschiedlicher Dauer sein und je nach Fall sowohl Tage, Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre umfassen (vgl. ebd.).
Es liegen zwar verschiedene Definitionsvorschläge vor, „aber keiner der Versuche, unbekannte Mörder in ein einheitliches Korsett zu zwängen, hält genauer Überprüfung stand“ (ebd.). Demnach ist es also nicht möglich, Serienmord als ein einheitliches Phänomen zu definieren, welches auf jeden Serientäter im 1:1-Format zutrifft. Stattdessen muss die „Grundlage jeder kriminalistischen Arbeit […] die sorgfältige Tatsachenerhebung [sein], die eine erfolgversprechende Fall-Analyse ermöglicht“ (Hamacher 2002, S. 9).
Aufgrund der erschwerten Definition des Serienmordes, gelangt Newton zu der Überzeugung, dass die präziseste und gelungenste Definition vom Nationalen Institut für Justiz (NIJ) aus dem Jahre 1988 stammt. Dort wird Serienmord wie folgt definiert:
„Eine Serie von zwei oder mehr Morden, die als getrennte Ereignisse begangen werden und meistens, aber nicht immer, von einem Einzeltäter. Die Verbrechen können sich innerhalb einer Zeitspanne von Stunden bis zu Jahren ereignen. Das Motiv ist oft psychologischer Natur, und das Verhalten des Täters sowie die physischen Beweise am Tatort weisen sadistische, sexuelle Untertöne auf“ (NIJ zit. nach Newton 2002, S. 358).
Diese Definition erscheint zunächst am plausibelsten, da die strengen und festgezurrten Kriterien anderer versuchter Definitionen gelockert und erweitert wurden und somit eine gewisse Flexibilität mit sich zieht.
Doch auch diese Definition erweist sich bei gezielter Betrachtung noch nicht als vollkommen geeignet und bedarf einiger Verbesserungen. Kriminalkommissar und ausgewiesener Serienmord-Experte Stephan Harbort, definierte das Phänomen Serienmord schließlich selbst, etwas allgemeiner:
„Der voll oder vermindert schuldfähige Täter begeht allein verantwortlich oder gemeinschaftlich mindestens drei vollendete vorsätzliche Tötungsdelikte, die von einem jeweils neuen, feindseligen Tatentschluß [sic!] gekennzeichnet sind“ (Harbort 2001, S. 20).
Eine adäquate Definition zu finden, gestaltet sich wie aufgezeigt wurde, problematisch. Vielmehr bedarf es einer Kombination mehrerer Definitionen, wobei sich im Rahmen dieser Arbeit an den Definitionsvorschlägen des NIJ und von Harbort orientiert wird.
3. Multifaktorielle Entwicklung zum Serienmörder
Der Mensch wird erst dann als Subjekt definiert, wenn er den materiellen, sozialen und kulturellen Objekten der Umwelt erlebend, denkend und handelnd gegenübertritt (vgl. Hurrelmann 2006, S. 7). Dieser Reifungsprozess des Menschen verläuft in vielen verschiedenen Phasen und birgt durch externe Einflüsse erhebliche Risiken bei der Entwicklung. Der Reifungsprozess soll nun anhand der Sozialisation eines Menschen, seiner Bindung und Beziehung sowie seiner Identitäts- und Sexualitätsentwicklung dargestellt werden. Des Weiteren dienen die Risikofaktoren bei der Persönlichkeitsentwicklung von Frank Schmökel dazu, die tatmotivierenden und -auslösenden Hintergründe für sein sexualpathologisches Verhalten besser verstehen und analysieren zu können.
3.1 Sozialisation
„Die Sozialisationstheorie ist intensiv mit dem Problem beschäftigt, welche sozialen Bedingungen gegeben sein müssen, damit Menschen ihre Persönlichkeit frei entfalten und ihre Identität sichern können. Dazu gehören auch Bildung und Erziehung eines Menschen, um ihn in seiner persönlichen biografischen Entwicklung zu stärken“ (Hurrelmann 2006, S. 7).
Klaus Hurrelmann (2006) definiert Sozialisation als einen Prozess, durch den sich die Persönlichkeit eines Menschen entwickelt. Dies geschieht in Auseinandersetzung mit den natürlichen Anlagen, zu denen insbesondere die körperlichen und psychischen Grunddispositionen einer Person (innere Realität), als auch die sozialen und physikalischen Merkmale der Umwelt (äußere Realität) zählen (vgl. ebd.). Diese Definition schließt folglich sowohl die Eigengestaltung des Menschen mit ein, als auch seine Mitformung durch die Umwelt.
Die Persönlichkeit eines Menschen bildet sich weitestgehend in den ersten drei Lebensjahren aus, sodass zu dieser Zeit stattgefundene Erlebnisse eine sehr prägende Wirkung auf die weitere Entwicklung der Persönlichkeit haben (vgl. Brisch 2009a, S. 106). Den einflussreichsten und somit primären Sozialisationsfaktor der frühen Kindheit stellt die Familie[2] dar, die seit Jahrhunderten als zentrale Instanz der Sozialisation dient und eine emotionale Brücke zu der sozialen Umwelt schlägt: „Sie [Familie] fungiert als elementare Sozialisationsinstanz, die alle Entwicklungsimpulse für Kinder koordiniert“ (Hurrelmann et al. 2003, S. 96). Das Aufgaben- und Möglichkeitsfeld der Familie besteht zum einen darin, die persönlichen Grundbedürfnisse des Kindes zu erkennen und ausreichend zu befriedigen und zum anderen, die Einflüsse der äußeren Realität zu sondieren (vgl. Hurrelmann 2006, S. 139).
Neben der Familie prägen auch soziale Lebensbereiche wie der Kindergarten und die Schule die Persönlichkeitsentwicklung, da sie die gesellschaftliche Funktion der Persönlichkeits- und Leistungsentwicklung von Kindern durch Erziehung und Bildung fördern (vgl. Hurrelmann et al. 2003, S. 96). Diese Sozialisationsinstanzen repräsentieren die sekundäre Sozialisation, indem sie die Erziehung der Kernfamilie unterstützen und diese mit Hilfe von Förderprogrammen im intellektuellen, sprachlichen, visuellen und akustischen Bereich erweitern. Im Laufe der Zeit (ab den 1980er Jahren) wurde die kognitive Kompetenz durch die soziale Komponente ergänzt und soll die Kinder in Bezug auf Kommunikation, Konfliktfähigkeit, Selbstständigkeit und Verantwortung begünstigen (vgl. ebd., S. 113). Darüber hinaus spielen auch die Lebensbereiche Wohnort und -situation sowie Freizeitgestaltung eine erhebliche Rolle bei der Sozialisation von Kindern, da sämtliche exogene Faktoren die Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen und neben positiven, auch negative Entwicklungsimpulse setzen können. Für die Persönlichkeit des Kindes wären möglichst positive Entwicklungsimpulse von Seiten der Sozialisationsinstanzen wünschenswert (vgl. ebd., S. 96).
Doch wie bereits erwähnt, können diese im Ansatz angeführten Sozialisationsfaktoren, jederzeit ein Risiko für die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen darstellen, sodass sie oftmals als Auslöser für späteres delinquentes Verhalten gewertet werden können. Unter Bewältigung wird im Rahmen der Sozialisationstheorie die Bemühung verstanden, Anforderungen und Belastungen mit Hilfe der eigenen körperlichen und psychischen Merkmale zu bestehen (vgl. ebd., S. 153). „Ist der Bewältigungsprozess nicht erfolgreich, kann es zu einer gestörten Verarbeitung der Realität mit Symptomen der Überbeanspruchung in Form von sozialer Abweichung, psychischen Störungen und körperlichen Krankheiten kommen“ (ebd., S. 153f). Gewalt und Kriminalität sind die populärsten, unter soziale Abweichung fallenden, Ausprägungen. Kriminalität gründet sich meist aus gravierenden Schwierigkeiten, mit den Anforderungen an die soziale Integration zurechtzukommen. Einen ganz erheblichen Beitrag zu der Entwicklung delinquenten Verhaltens leistet erneut die primäre Sozialisationsinstanz Familie. Angespannte Familienverhältnisse und dauerhafte Gewaltausübung, sowohl sexueller als auch psychischer Natur, gelten als prekärste Risikofaktoren für delinquentes Verhalten.
3.2 Bindung und Beziehung
Die Bindungstheorie nach Bowlby, Robertson und Ainsworth besagt, „daß [sic!] die Entwicklung einer sicheren emotionalen Bindungsbeziehung beim Kind sowie im weiteren Verlauf des Lebens für die emotionale Stabilität und die gesunde psychische Entwicklung ein Schutzfaktor ist“ (Brisch et al. 2009b, S. 7). Doch was geschieht, wenn dieser Schutzfaktor nicht aufrechterhalten werden kann und die Beziehung von Trennung, Verlust und traumatischen Erfahrungen gekennzeichnet ist?
Bindung wird als dauerhafte, verlässliche und liebevolle Beziehung zwischen einer schwächeren Person und einer wesentlich stärkeren definiert, bei der die Schwächere existenziell von der Stärkeren abhängig ist (vgl. Foerster 2013a, S. 6). Die unmittelbar postnatalen Erfahrungen mit den primären Bezugspersonen vermitteln dem Menschen den Eindruck von Qualität und Verbindlichkeit mitmenschlicher Beziehungen. Je nach Bindungsgestaltung, wird der Betroffene diese unterschiedlichen Vorstellungen von Bindung und Beziehung in seine personale und soziale Kompetenz mit einfließen lassen. Diese Prägung verinnerlicht sich in sogenannten inneren Arbeitsmodellen (vgl. ebd.).
Straftäter weisen größtenteils unsichere Bindungserfahrungen auf, die sowohl in psychischer als auch in sozialer Hinsicht zu schweren Belastungen bei den Betroffenen führen. Inzwischen wird davon ausgegangen, dass Bindungserfahrungen durch transgenerationale Vererbung an die Kinder weitergegeben werden, sodass gemeinhin bereits die Eltern späterer Straftäter eine Kindheit voller Missbrauch, Misshandlung und physischer und psychischer Vernachlässigung erfahren mussten (vgl. ebd., S. 1). Der daraus resultierende, meistens defizitäre Erziehungsstil, prägt die weitere Bindungs- und Beziehungsgestaltung der Kinder beträchtlich, auch wenn der Auslöser für späteres delinquentes Verhalten bereits einen viel früheren Ursprung hat:
„Vor allem in der frühesten postuteralen Phase sind die Bindungsqualitäten von entscheidender Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, da während dieser Phase jene elementaren Grundbedürfnisse des Kindes erfüllt werden müssen, die für das psychische und physische Überleben wichtig sind. Erst wenn diese in genügender und kindgemäßer Weise erfüllt werden, kann sich Urvertrauen einstellen und im weiteren Verlauf eine positive Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit stattfinden“ (Foerster 2013a, S. 1).
Das in diesem Zitat, sich als bedeutsam herausgestellte und wichtige Urvertrauen, die Beziehungsgestaltung in der prägendsten Zeit im Kindesalter und die Folgen bei nicht ausreichender Bindungsqualität, sollen fortlaufend vertieft werden.
3.2.1 Bindungsphasen
Zunächst sollen die vier Entwicklungsphasen einer Bindungsentwicklung dargelegt werden. Die erste Phase beschreibt die Phase der unspezifischen sozialen Reaktionen und lässt sich ca. auf die ersten beiden Monate nach der Geburt eingrenzen. Die sozialen Reaktionsweisen Horchen, Anschauen, Schreien, Festsaugen, Umklammern und Anschmiegen sind in dieser Zeit mit Reflexen vergleichbar und richten sich folglich nicht gezielt an eine Person (vgl. Grossmann/Grossmann 2012, S. 76). Insbesondere die primäre Bezugsperson[3] wird bereits in den ersten beiden Monaten vom Säugling erkannt. Er lernt jedoch ebenso schnell zwischen eng vertrauten und weniger vertrauten Personen zu differenzieren.
Die zweite Phase, die der unterschiedlichen sozialen Reaktionsbereitschaft, ist durch eine bessere und schnellere Auffassungsgabe und Reaktionsbereitschaft des Säuglings gegenüber Bezugspersonen gekennzeichnet (vgl. ebd.). Diese Phase wird auch die zielorientierte Phase genannt und umfasst die ersten sechs Monate. Da die Mutter-Kind-Beziehung in der Regel die erste mitmenschliche Beziehung darstellt (vgl. Brauneck 1974, S. 152), wird in dieser Phase besonders die Mutter vom Kind bevorzugt.
Die Phase des aktiven und initiierten zielkorrigierten Bindungsverhaltens repräsentiert die dritte der vier Bindungsphasen und beginnt in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres. Es werden weitere Entwicklungsfortschritte des Kleinkindes bemerkbar: Die Aktivität des Kindes steigt – der Drang nach selbstständiger Fortbewegung wächst, das gezielte Greifen setzt ein und die primäre Bezugsperson manifestiert sich als geistige Vorstellung, sodass „der mobile Säugling […] jetzt aktiver und selbstständiger als vorher die Nähe zur Bindungsperson bestimmen [kann]“ (Grossmann/Grossmann 2012, S. 77). Hinzu kommt die differenziertere Vokalisation und damit auch die Fähigkeit, Reaktionen auf sein Verhalten vorherzusehen. Neben der Zielorientierung kann das Kleinkind nun sein Ziel auch der Bindungsperson anpassen, indem es seine Unstimmigkeit bezüglich gewisser Verhaltensweisen der Bindungsperson gegenüber offenbart (vgl. ebd.). Im Endstadium der sensomotorischen Entwicklung, bei der sich Grossmann und Grossmann auf Piaget berufen, hat der Säugling eine genaue Vorstellung von seiner primären Bezugsperson, die für ihn die Werte Schutz, Trost und Wohlbefinden verkörpert. „Die Bindungsperson ist zum Zentrum seiner Welt geworden“ (Grossmann/Grossmann 2012, S. 77), bei der sich das Kind rückversichert, wenn es beim Erkunden auf etwas Neues und Unbekanntes stößt. Dieses Verhalten des Kindes spiegelt die enge Bindung zu der betreffenden Person wider. Während die ersten drei Phasen aufgrund der räumlichen Distanz zur Bezugsperson noch Sehnsucht, Verzweiflung, Angst und Trauer hervorrufen, führt die vierte Phase zur Entfremdung und Ablösung, was mit einer Reorganisation verbunden ist (vgl. Bowlby 1973/2006 zit. nach Grossmann/Grossmann 2012, S. 78).
Die vierte und letzte Phase, ist die Phase der zielkorrigierten Partnerschaft, welche erst dann beginnt, wenn das Kind der Sprache mächtig ist und die Intentionen seiner Bezugsperson nachvollziehen kann. Von nun an kann das Kind begreifen, warum einige seiner Wünsche von der Mutter[4] nicht erfüllt werden konnten. Das Verständnis für mögliche Interessenskonflikte wächst und bildet sich weitgehend so aus, dass die Kinder Absichten und Ziele der Bindungspersonen in ihr Denken und Planen miteinbeziehen (vgl. ebd., S. 79).
3.2.2 Bindungsmuster
In den soeben beschriebenen vier Bindungsphasen, können sich unterschiedliche Bindungsmuster herausbilden, die einen erheblichen Einfluss auf das innere Arbeitsmodell des Kindes ausüben. Bevor die vier Bindungsmuster näher erläutert werden, wird zunächst die Bildung eines positiven oder negativen inneren Arbeitsmodells dargestellt, um das spätere Verständnis zu erleichtern.
Bei vorwiegend positiven Bindungserfahrungen in der frühesten Kindheit, bildet sich ein positiv konnotiertes inneres Arbeitsmodell heraus, mit dessen Hilfe sich das Urvertrauen und eine stabile Ich-Identität entwickelt (vgl. Kreisman/Straus 2012, S. 99). Diese ist charakterisiert durch Konfliktfähigkeit und soziale Kompetenz, die es ermöglicht, mit- und zwischenmenschliche Kontakte positiv zu gestalten und empathisch die Grenzen anderer zu respektieren. Jegliche, durch frühe Bindungserfahrungen geprägte Verhaltensweisen befinden sich über die frühe Kindheit hinaus in einem ständigen Lern- und Nachreifungsprozess.
Das innere Arbeitsmodell bei überwiegend negativen Bindungserfahrungen durch primäre Bezugspersonen, gestaltet sich deutlich schwieriger, als bei einem positiv gekennzeichneten inneren Arbeitsmodell. Bei unzulänglicher und diskontinuierlicher Bedürfnisbefriedigung von Nähe, Wärme, Nahrung und Geborgenheit, können Eltern für ihr Kind nicht zu einem essentiellen „sicheren emotionalen Hafen“ (Brisch 2009a, S. 106) werden. Es sich folglich oftmals ein negativ getöntes inneres Arbeitsmodell aus, welches, aufgrund der prägenden Erfahrungen, eine Prognose auf die spätere mitmenschliche Beziehungsgestaltung im Erwachsenenalter ermöglicht. Statt Urvertrauen entsteht vermutlich Urmisstrauen gegenüber jeglichen sozialen Gefügen, bei dem die psychische Begleiterscheinung die chronische und frei flottierende Angst ist, die sich in nahezu allen sozialen Kontakten der Betroffenen widerspiegelt (vgl. Foerster 2013a, S. 7).
In Anlehnung an die inneren Arbeitsmodelle, die sich im Inneren des Kindes internalisieren und sein späteres Sozialverhalten massiv prägen (vgl. ebd., S. 10), sollen nun die daraus möglichen Bindungstypen vorgestellt werden.
Unter optimalen Bedingungen, besteht eine innere Bindungsrepräsentation der Eltern, die ihnen dazu verhilft, die Partnerschaft von gegenseitiger Wertschätzung zu gestalten und eine empathische Grundlage zu schaffen. Nur auf dieser affektiven Basis in der Partnerschaft kann nach der Geburt eines Kindes eine feinfühlige Interaktion mit dem Säugling entstehen, die die Grundlage für die Entwicklung des Urvertrauens darstellt (vgl. Brisch 2009a, S. 105). Das daraus resultierende, beim Säugling, Kleinkind etc. freigesetzte, Explorationsverhalten, ermöglicht dem sicher gebundenen Kind das Knüpfen von Beziehungen sozialer Art, welche wiederum die innere Entwicklung des Kindes fördern (Ainsworth et al. 1969, zit. nach Brisch 2009a, S. 106). Diese Entwicklung würde dem Muster der sicheren Bindung entsprechen.
Negative Auswirkungen auf das innere Arbeitsmodell des Kindes haben hingegen die anderen drei Bindungstypen. Dazu zählt unter anderem die unsicher-vermeidende Bindung, die durch „übergroße Distanz und emotionale[] Kälte der Beziehungsperson gegenüber dem Kind“ (Foerster 2013a, S. 7) gekennzeichnet ist. Ursache dafür ist meist bereits eine spannungsreiche Partnerschaft, in der die Vermittlung von Nähe- und Distanzwünschen problematisch ist und durch die Geburt eines Kindes weiter verschärft wird. Dieses widersprüchliche Bindungsmuster überträgt sich auf den Säugling; er wird im sozialen Umgang mit anderen ebenso distanziert und ambivalent auftreten, da „diese Kinder jegliche Erwartung an eine emotional hilfreiche und verfügbare Beziehung verloren zu haben [scheinen], so daß [sic!] sie auf äußere Reize auch nicht mehr positiv, sondern eher ängstlich erschrocken und abwehrend reagieren“ (Spitz zit. nach Brisch im Beitrag von Hellbrügge in diesem Band 2009, S. 34). Im Hinblick auf diesen Bindungstyp kann kaum von Bindung die Rede sein, da er sich vielmehr auf eine nach außen hin rational und instrumental wirkende Beziehung beschränkt, die affektive Bedürfnisse wie Nähe und Empathie fortwährend meidet und somit die Entwicklung des Urvertrauens im Keim erstickt (vgl. Foerster 2013a, S. 7).
Die unsicher-ambivalente Bindung wird durch eine große Erwartungsunsicherheit des Kindes gegenüber seinen primären Bezugspersonen charakterisiert und gründet sich aus dem gleichen Beziehungsmuster der Eltern, wie bei der unsicher-vermeidenden Bindung. Aufgrund der Erwartungsunsicherheit des Kindes, sind adäquate Reaktionen auf bestimmte Situationen kaum möglich (vgl. ebd.). Urmisstrauen statt Urvertrauen bildet sich gegenüber den Bezugspersonen aus und ruft im Sozialisationsprozess des Kindes ein permanentes Gefühl der Angst und Unsicherheit hervor. Diese beiden unsicheren Bindungstypen stellen einen immensen Risikofaktor für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes dar, da sie in Bewältigungssituationen eingeschränkt sind und sie auch ihre Mitmenschen aufgrund ihrer stark ausgeprägten Ambivalenz in „Autonomie-Abhängigkeits-Konflikte“ (Brisch 2009, S. 107) verwickeln.
Das letzte Bindungsmuster stellt die desorganisierte oder auch desorientierte Bindung dar. Dieser Bindungstyp setzt sich aus Anteilen der anderen drei Bindungsmuster zusammen. Die jeweilige Ausprägung einer der drei anderen Bindungsqualitäten ist abhängig von einer spezifischen äußeren Situation (vgl. Foerster 2013a, S. 7), sodass das betroffene Kind, aufgrund seines desorganisierten multiplen inneren Arbeitsmodells, widersprüchliche (bspw. motorische) Verhaltensweisen zeigen wird (vgl. Brisch 2009a, S. 108). Auch hier fehlt es an einer konstanten haltenden Funktion, sodass die Entwicklung eines kindlichen Urvertrauens unterbunden, bzw. gehemmt wird.
3.2.3 Bindungsstörungen
„Grundlegend bei allen Bindungsstörungen ist, daß [sic!] frühe Bedürfnisse nach Nähe und Schutz in Bedrohungssituationen und bei einer Aktivierung der Bindungsbedürfnisse in ängstigenden Situationen in einem extremen Ausmaß nicht adäquat, unzureichend oder widersprüchlich beantwortet wurden“ (Brisch 2009a, S. 60).
Das wiederholte und kontinuierliche Auftreten solcher pathogener Faktoren, wie Misshandlung, Deprivation und eine massiv gestörte Eltern-Kind-Interaktion, führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Bindungsstörungen, die zusätzlich durch äußerliche Sozialfaktoren beeinträchtigt werden (vgl. ebd., S. 95/98). Bei der Vielzahl an Bindungsstörungen, die eine Steigerung des desorganisierten Bindungsmusters darstellen, liegt eine erhebliche Fragmentierung bis Zerstörung des inneren Arbeitsmodells von Bindung zugrunde. Bindungsstörungen äußern sich entweder in einem überaktivierten Bindungssystem, wodurch die Exploration des Kindes gehemmt wird, oder in einer aufgrund von übermäßiger Exploration resultierenden Bindungshemmung (vgl. ebd., S. 99). Die unter schwerwiegende Psychopathologie fallenden Bindungsstörungen, können in den Klassifikationssystemen für psychische Störungen nicht passend verortet werden, da es „keine ausreichenden diagnostischen Zuordnungen für die Vielfalt und den Schweregrad an Bindungsstörungen“ (ebd.) gibt. Sowohl das DSM-IV (diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen), als auch die ICD-Klassifikation (internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme), beziehen sich größtenteils implizit auf bindungsrelevante Diagnosen, indem beispielsweise die Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen (F91.1) aufgeführt wird. Die Vielzahl der möglichen Bindungsstörungen und ihre Komorbiditäten, sollen hier nicht weiter zur Sprache gebracht werden, stattdessen wird das Augenmerk auf den Zusammenhang zwischen Bindungserfahrungen und Persönlichkeitsstörungen sowie zwischen Bindungserfahrungen und Gewaltdelinquenz gelegt.
3.2.3.1 Bindungserfahrungen und Persönlichkeitsstörungen
Es ist inzwischen bestätigt, dass ein Zusammenhang zwischen Bindungserfahrungen und Persönlichkeitsstörungen besteht. Menschen mit negativen Bindungserfahrungen neigen dazu, die Bedeutung von Beziehung und Bindung stark zu entwerten. Stattdessen betonen sie ihr Streben nach Unabhängigkeit, welches jedoch möglicherweise aus einer unbewussten narzisstischen Angst vor Nähe resultiert (vgl. Foerster 2013a, S. 9). Hinzu kommt die sprachliche Repräsentation, bei der die kognitive Darstellung und der Grad der Emotionalität nicht übereinstimmen. In diesem Fall wurden die Betroffenen wahrscheinlich mit schweren Traumatisierungen oder dem Verlust von Bindungspersonen konfrontiert, ohne diese prägenden Ereignisse angemessen verarbeitet haben zu können. Insbesondere bei Personen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung wurden unverarbeitete und traumatische Bindungserfahrungen geschildert (vgl. Ross/Pfäffling 2001, S. 103). Ebenso herrschen bei den Betroffenen unbewusste Ängste vor allzu großer Abhängigkeit und Nähe gegenüber engeren Bezugspersonen, die in Spaltungsvorgängen als Abwehrmechanismus zum Ausdruck kommen (vgl. Foerster 2013a, S. 9). Das unsichere Bindungsverhalten führt häufig zu einschlägigen Persönlichkeitsstörungen, die oftmals bei Straftätern zu beobachten sind. Daher ist es ebenso nötig, einen Blick auf den Zusammenhang zwischen Bindungserfahrungen und Gewaltdelinquenz zu werfen.
3.2.3.2 Bindungserfahrungen und Gewaltdelinquenz
Der Zusammenhang zwischen unverarbeiteten traumatischen Bindungserfahrungen und Persönlichkeitsstörungen konnte bereits hergestellt werden, doch zusätzlich besteht eine Korrelation zwischen Bindungserfahrungen und Gewaltdelinquenz. „Unsichere Bindungserfahrungen tendieren im Zusammenhang mit Persönlichkeitsstörungen zu gewalttätigem und grenzverletzendem Verhalten, wobei die Grenze zur antisozialen Persönlichkeit fließend ist“ (ebd., S. 11). Darüber hinaus findet sich ein hohes Maß an feindseliger Dominanz delinquenter Personen gegenüber ihren Mitmenschen und die interpersonellen Kontakte der Risikogruppe Straftäter werden durch Feindseligkeit, Dominanz und Aggressivität charakterisiert.
3.3 Identitäts- und Sexualitätsentwicklung
„Für das Individuum ist Identität das Erlebnis einer Einheit des Selbst. […] Die Ausbildung von Identität ist Ausdruck einer Ichfunktion und bedarf verschiedener kognitiver und sozialkognitiver Voraussetzungen“ (Resch et al. 1999, S. 218).
Nur so kann sich eine Persönlichkeit herausbilden, die die Gesamtheit der Eigenschaften und Verhaltensdispositionen eines Menschen vereinbart und ihn zeitlich stabil in unterschiedlichen Situationen charakterisiert und somit auch von anderen Menschen unterscheidet (vgl. Hannover/Greve 2012, S. 544). Das kognitive Wissen über die eigene Person verhilft dem Menschen zum Bewusstsein über die eigene Existenz. Dieses Selbstwissen stellt eine Kombination aus eigenen Beobachtungen und der dazugehörigen Reflexion und einem von außen stammenden, sozialen Feedback dar, welches Teil des Selbst wird (vgl. ebd., S. 545). Eine Fehlentwicklung der Persönlichkeit kann zu fatalen Folgen führen, wie sich im Laufe dieser Arbeit herausstellen wird.
Die Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Menschen durchläuft einen Prozess der Veränderung, der sich aus der Kombination intraindividueller und interindividueller Faktoren ergibt (vgl. ebd., S. 547). In der Kindheit kann – laut Hannover und Greve – die Persönlichkeitsentwicklung anhand des Temperaments des Kindes nachgewiesen werden, da die Temperamentsmerkmale als grundlegende Dimensionen der Persönlichkeit gelten (vgl. ebd., S. 554). Dazu zählen Eigenschaften, die sich auf die Intensität und Qualität emotionaler Reaktionen, das Aktivierungsniveau, die Reaktivität und die emotionale, aufmerksamkeits- und verhaltensbezogene Selbstregulation beziehen. Dies lässt den Hinweis auf die biologischen Grundlagen dieser relativ stabilen Eigenschaften aufkommen. Nach Erikson (1966), einem deutsch-amerikanischem Psychoanalytiker, stellt vor allem die Adoleszenz einen Meilenstein in der lebenslangen Identitätsentwicklung dar, da in dieser Zeit häufig die Frage nach der eigenen Identität aufgeworfen wird und eine Ich-Identität angestrebt wird. Marcia hat die Ausführungen von Erikson dahingehend weitergeführt, als dass er zwischen vier verschiedenen Identitätszuständen unterscheidet (vgl. ebd., S. 554):
Der Zustand der diffusen Identität beschreibt das Fehlen einer Bindung und zielgerichteten Erkundung. Kennzeichen der erarbeiteten Identität ist eine gefestigte Bindung, die offen ist für weitere Erkundungen. Die kritische Identität stellt eine zielgerichtete und aktive Erkundung dar, in dessen Modell die Bindung jedoch noch nicht vorhanden ist. Der vierte Entwurf ist der Zustand der übernommenen Identität, bei der jegliches Explorationsverhalten in der festen Bindung fehlt. Im Erwachsenenalter gehen die klassischen Ansätze der Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung davon aus, dass das Individuum von nun an vollends entwickelt ist, da es in dieser Lebensphase über die höchste Autonomie verfügt und sich die Dimensionen der Persönlichkeit stabilisiert haben. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Entwicklung einen lebenslangen Prozess darstellt, um gesellschaftlich kulturellen Anforderungen und Erwartungen zu entsprechen und „seine zwischenmenschlichen Beziehungen auf der Suche nach einer persönlichen Identität mit Sinn zu füllen“ (Resch et al. 1999, S. 200).
Doch was geschieht, wenn die Konsolidierung der Identität nicht zur zentralen Entwicklungsaufgabe der normalen Adoleszenz wird? Eine Identitätskrise oder Identitätsdiffusion ist charakterisiert durch den Mangel an einem integrierten Selbstkonzept. Betroffene leiden, neben der mangelhaften oder fehlenden Selbstdefinition, an einem schmerzhaften Gefühl von Inkohärenz und chronischer Leere, weisen widersprüchliches Verhalten auf, verspüren eine erniedrigte Angsttoleranz und Impulskontrolle und verzeichnen einen Verlust bzw. Defizit an Werten, Zielen und Beziehungen (vgl. Foelsch et al. 2013, S. 2). Auswirkungen und Konsequenzen einer solchen Identitätsdiffusion sollen im Folgenden im Zusammenhang mit der Sexualitätsentwicklung in Ansätzen dargestellt werden.
„Die Sexualität ist an unseren Körper und an unsere Psyche gebunden“ (Gödtel 1992, S. 22). Bereits im Säuglingsalter lassen sich genitale Reflexmechanismen nachweisen, die auf die Existenz der Sexualität in allen Lebensdyaden hinweisen. Bei Jungen erweist sich die Sexualität im Säuglingsalter und in der frühesten Kindheit bspw. durch einen erigierten Penis beim Eincremen, während bei Mädchen beim rhythmischen Zusammenkneifen der Schenkel eine Ähnlichkeit zum späteren Orgasmus festgestellt werden kann. Im Alter von drei Jahren beginnen Kinder ihre eigenen, aber ebenso auch fremde Geschlechtsorgane zu erkunden (vgl. ebd., S. 25). Ein Jahr später, im Alter von vier, finden sie erotische, gefühlsbetonte Einstellungen zu Gleichaltrigen und erwachsenen Bezugspersonen. Die eigentliche Geschlechtsidentität entwickelt sich zwischen dem siebten und achten Lebensjahr und zieht das Reifen von Phantasien und Tagträumen mit sich (vgl. ebd.). Von nun an steigern sich indirekte und z.T. unterbewusste Probierversuche bzgl. des Sexualverhaltens. Der Hypophysen-, Nebennieren- und Geschlechtshormonspiegel steigt im Laufe der frühen Pubertät (Vorpubertät) und in der Hauptphase der Pubertät wird die Sexualitätsentwicklung aufgrund der Reifung der sichtbaren Geschlechtsmerkmale offensichtlich (vgl. ebd., S. 25f). Während der Pubertät, die ca. drei bis vier Jahre andauert, reift die sexuelle Funktionsfähigkeit weiter aus. Die Sexualitätsentwicklung soll dafür sorgen, dass romantische Liebe entsteht, die sich aus den drei Faktoren Sexualtrieb, Attraktion und Bindung zusammensetzt. Der Sexualtrieb dient der Fortpflanzung, die Attraktion bestimmt die Auswahl bestimmter Sexualpartner und die Bindung soll bewirken, dass Beziehungen lange genug andauern, um eine Familie zu gründen (vgl. Richter-Appelt 2011, S. 497).
[...]
- Arbeit zitieren
- Jana Koschate (Autor:in), 2014, Tatmotivierende und -auslösende Hintergründe bei sexualpathologischen Serientätern am Beispiel von Frank Schmökel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302591
Kostenlos Autor werden


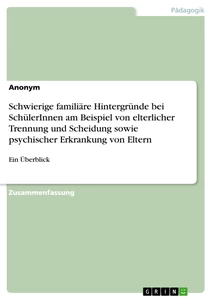











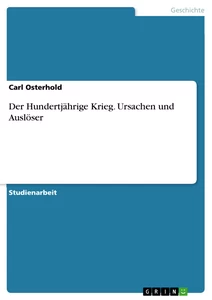





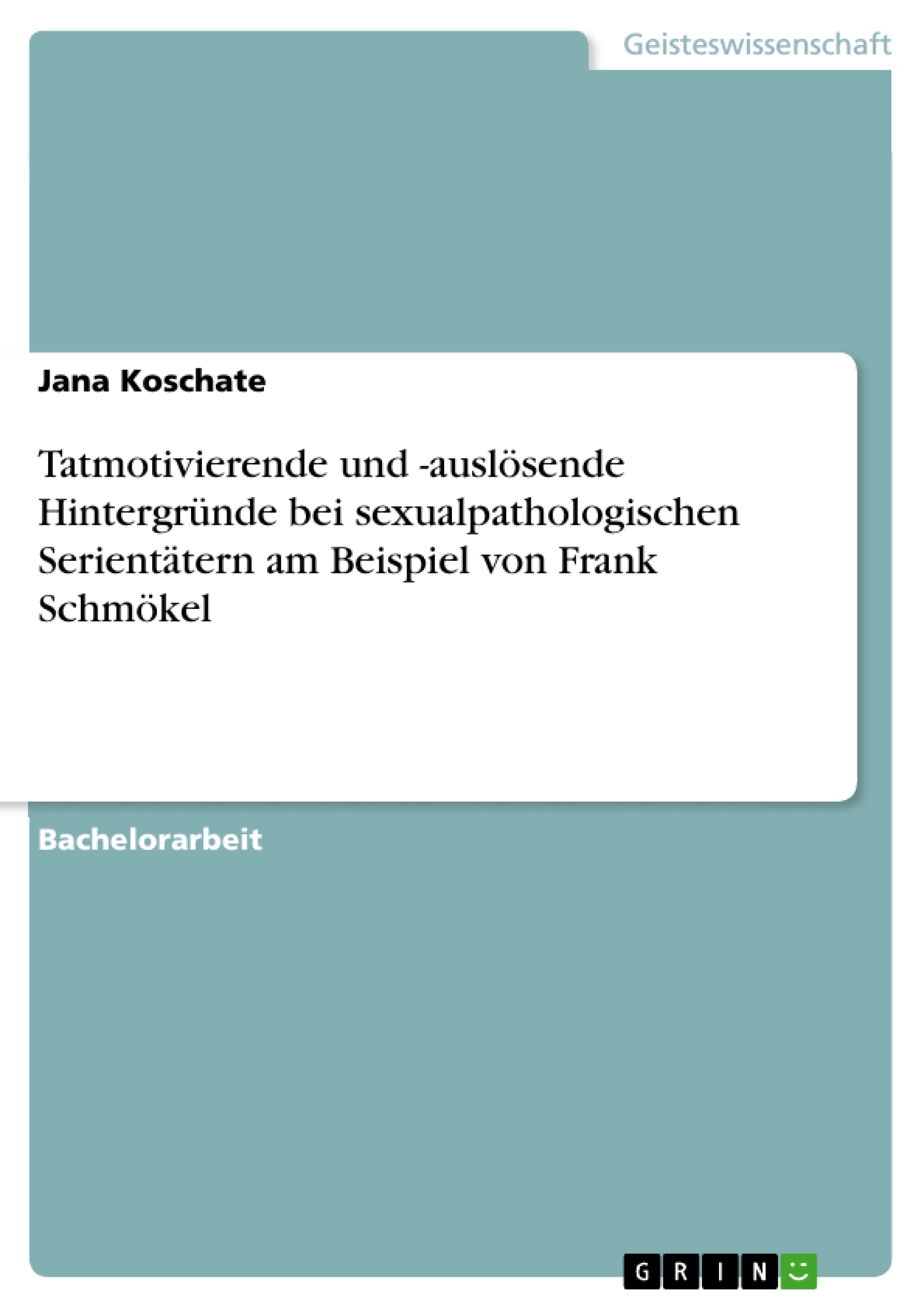

Kommentare