Extrait
Inhalt
Verzeichnis der Abbildungen
Verzeichnis der Tabellen
Verzeichnis der Anlagen
Verzeichnis der Abkürzungen
Hinweise
1. Einleitung
1.1 Relevanz des Themas
1.2 Aufbau der Arbeit
2. Grundlagen
2.1 Palliative Care
2.1.1 Begriffsdefinition
2.1.2 Begriffsherkunft und -entwicklung - Cicely Saunders
2.1.3 Palliative Care als Versorgungskonzept
2.1.4 Lebensqualität als zentrales Ziel der Palliative Care
2.2 Palliative Home Care
2.2.1 Zunahme stationärer und ambulanter Einrichtungen
2.2.2 SGB V, rechtliche Bestimmungen und Empfehlungen
2.2.3 Leistungserbringer
2.2.4 Basisvoraussetzungen für SAPV
2.2.5 Bedeutung der ambulanten Palliativversorgung
2.3 Netzwerk und Netzwerkbildung
2.3.1 Definition und Abgrenzung
2.3.2 Grundlagen
2.3.3 Arten, Typen und Erscheinungsformen
3. Zielstellung
4. Methodik
4.1 Vorgehensweise
4.2 Begründung
5. Ergebnisse
5.1 Professionen und Disziplinen
5.2 Entwicklungsstand SAPV in Sachsen
5.3 Versorgungbedarf im Landkreis Zwickau
5.4 Angebotsstrukturen im Landkreis Zwickau - Ist-Analyse
5.4.1 Stationäre Versorgung
5.4.2 Ambulante Versorgung
5.4.3 Versorgung mit Arznei- und Hilfsmitteln
5.4.5 Zusammenfassung
6. Diskussion
7. Vorschläge für die Netzwerkbildung
7.1 Zielvorstellung
7.2 Zielgruppe
7.3 Netzwerkzentrale
7.4 Phasen der Netzwerkbildung
8. Zusammenfassung und Ausblick
9. Literatur-, Quellen- und Linkverzeichnis
10. Anlagen
11. Glossar
Verzeichnis der Abbildungen
Abbildung 1: Beziehung zwischen Hospiz-Pflege und kurativer Pflege
Abbildung 2: Der Einsatz von Palliative Care bei einer tödlich verlaufenden Erkrankung
Abbildung 3: Entwicklung von Palliativ- und Hospizeinrichtungen in Deutschland zwischen 1986 und 2008
Abbildung 4: Verträge gem. § 132 d SGB V
Abbildung 5: Struktur der Versorgung von Palliativpatienten durch Koordination von Angeboten in der Allgemeinen und Spezialisierten Palliativversorgung
Abbildung 6: Mögliche Schnittstellen in der Palliativversorgung
Abbildung 7: Der Patient in der ambulanten Palliativversorgung
Abbildung 8: Die Familie und die ambulante Palliativversorgung
Abbildung 9: Sterbeorte von Krebspatienten in Deutschland in Abhängigkeit von der ambulanten Versorgungsstruktur
Abbildung 10: Ambulante Palliativversorgung versus Hospitalisation
Abbildung 11: Ausprägungen von Netzwerkstrukturen
Abbildung 12: Mögliche Merkmale für die Netzwerktypologisierung
Abbildung 13: Netzwerktypologie nach Sydow
Abbildung 14: Organisatorische Ebene und Netzwerktypen
Abbildung 15: Beispiel des Dienstleistungsspektrums einer spezialisierten Apotheke
Abbildung 16: Stationäre und ambulante Versorgungsstruktur in Sachsen
Abbildung 17: Verteilung aktuell bei der AOK Plus vorliegender Anträge
Abbildung 18: Landkreis Zwickau Land und Zwickau Stadt vor dem 01.08.2008
Abbildung 19: Bedarfszahlen für die Versorgungsregionen
Abbildung 20: Flächenmäßige Verteilung ausgewählter Leistungserbringer im Landkreis Zwickau
Abbildung 21: Ablauf der Netzwerkbildung
Abbildung 22: Funktionen des Managements interorganisationaler Netzwerke
Abbildung 23: Plan-Do-Check-Act-Zyklus nach Deming
Verzeichnis der Tabellen
Tabelle 1: Stationäre Pflegeeinrichtungen im Landkreis Zwickau in den Jahren 2003, 2005, 2007
Tabelle 2: Anzahl ambulanter Pflegedienste im Raum Zwickau
Tabelle 3: Entwicklung der Zahlen der Allgemeinmediziner/Praktische Ärzte in der Stadt Zwickau
Tabelle 4: Zulassungsbeschränkungen gem. § 102 Abs. 1 SGB V - Direktionsbezirk Chemnitz vom 29.04.2009
Tabelle 5: Psychotherapie in Zwickau
Verzeichnis der Anlagen
Anlage 1: Gesetzestexte
Anlage 2: Inhalte SAPV
Anlage 3: Zusammensetzung der Stichprobe
Anlage 4: Modelle ambulanter palliativer Versorgungsangebote in Deutschland
Anlage 5: Flyer Brückenbetreuung in Zwickau
Anlage 6: Fallkonstellationen der KVS
Anlage 7: Entwurf eines Fragebogens
Verzeichnis der Abkürzungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hinweise
Mehrheitlich wird die maskuline Schreibweise gewählt. Damit sind stets beide Geschlechter angesprochen.
Je nach Versorgungskontext existieren unterschiedliche Bezeichnungen für den erkrankten Menschen. Dazu zählen zum Beispiel Gäste, Bewohner und Kunden. In der vorliegenden Arbeit wird vom betroffenen Menschen bzw. vom Betroffenen gesprochen. Da dieser Begriff das soziale Umfeld des Betroffenen mit berücksichtigt.
1. Einleitung
1.1 Relevanz des Themas
Verbesserte Lebensbedingungen, wie beispielsweise eine bessere Hygiene sowie eine gesunde und vor allem (v.a.) ausreichende Ernährung, sowie medizinische Fortschritte in der Bekämpfung von Krankheiten führten in Deutschland zu einem demographischen Wandel, der verschiedene gesellschaftliche und gesundheitspolitische Herausforderungen auch im Umgang mit den Themen Sterben und Tod mit sich brachte. Diese wechselnden Gegebenheiten manifestierten sich in Veränderungen im Altersaufbau der Bevölkerung, im Anstieg der Lebenserwartung, in der Verschiebung der Todesursachen und Individualisierung der Lebensläufe (Ewers, Schaeffer, 2005, S.7 ff.).
In Deutschland lebten im Jahr 2008 rund 16 Millionen Menschen, die 65 Jahre oder älter waren. Dies entsprach etwa 19,0% der Gesamtbevölkerung[1]. Im Jahr 2030 werden 22 Millionen prognostiziert und weitere 20 Jahre später 23 Millionen. Über 4,1 Millionen Menschen waren 2008 80 Jahre und älter (5,0% der Gesamtbevölkerung). Dieser Anteil wird sich bis zum Jahr 2050 verdreifachen. Zudem erfolgte ein kontinuierlicher Anstieg der Lebenserwartung seit 1990 in Deutschland. Dieser lag im Jahr 2008 bei 77 (Männer) beziehungsweise (bzw.) 82 (Frauen) Jahren. Zusätzlich war im Bundesland Sachsen eine zunehmende Abwanderung, die verstärkt jüngere Altersgruppen betraf, zu verzeichnen, sodass insgesamt ein Anstieg der über 60-Jährigen und eine Abnahme der unter 60Jährigen zu beobachten war (BIB, 2008, S.18-55).
Der Altersanstieg führte zu grundlegenden Veränderungen des Morbiditäts- und Mortalitätsspektrums mit einer stärkeren Betonung von Multimorbidität und chronischer Krankheit. Im Jahr 2007 waren die häufigsten Todesursachen in Sachsen mit 48,8% HerzKreislauf-Erkrankungen und mit 24,5% bösartige Neubildungen (Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 2009a).
Die Familienstrukturen änderten sich zu sogenannten “Bohnenstangenfamilien” mit mehreren Generationen aber wenigen Geschwistern. Das traditionelle Milieu “Großfamilie” gab es nicht mehr und es entstanden zunehmend multilokale Familiensysteme. Mit diesen Entwicklungen waren in Sachsen eine Zunahme von Single-Haushalten (Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 2009b) sowie Veränderungen in den sozialen Netzwerken verbunden. Dies führte zu einer Individualisierung der Lebensläufe sowie einem wachsenden Bedarf an fremder Hilfe und Unterstützung (Knipping, 2007a, S.633).
Im 19. Jahrhundert erfolgte die Betreuung der betroffenen Menschen durch die Familie in vertrauter häuslicher Umgebung (Knipping, 2007a, S.633). Dies bildete einen festen Bestandteil geltender gesellschaftlicher Traditionen und Normen. Die Häuslichkeit wurde mit „Vertrautheit, Normalität und Erlebnissen“ assoziiert und ermöglichte dem Betroffenen „Freiheit, Autonomie und Würde“ (Meuret, 2008, S.5). In dieser Zeit starben etwa 5,0% der Patienten in Krankenhäusern (Meuret, 2008, S.197). Basierend auf der Auflösung des Drei- Generationen-Haushalts, der Erfolge der Medizin und der damit verbundenen „Illusion, dass diese auch in der Situation einer unheilbaren Erkrankung noch einen Ausweg findet“, sowie aufgrund der Tabuisierung der Themen Sterben und Tod (Meuret, 2008, S.39, 198), erfolgte seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts eine Institutionalisierung des Sterbens, obwohl es der Wunsch der meisten Menschen war, in häuslicher Umgebung zu versterben (75,0%) (Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS) (2009)). In den vergangen Jahren starben zehn bis 20,0% zu Hause, etwa 30,0% in einer Pflegeeinrichtung und etwa 50,0% im Krankenhaus“ (Seeger, 2007a, S.11). Verantwortlich für die Diskrepanz der Wünsche der Patienten und der Realität waren strukturelle Probleme in der ambulanten Versorgung von Palliativpatienten (Schindler, 2007, S.59).
Als Grundlage zur Gestaltung der ambulanten palliativen Versorgung und Begleitung von betroffenen Menschen war die Zusammenarbeit in einem interdisziplinären und interprofessionellen Netzwerk nötig, um einerseits die vorhandenen ambulanten Betreuungskapazitäten zu nutzen (Gemeinsamer Bundesausschuss, 2007a) und andererseits eine ganzheitliche, patientenorientierte, ambulante Behandlung, Versorgung und Betreuung, die das körperliche, seelische wie auch das soziale Wohlbefinden betroffener Menschen berücksichtigt, zu ermöglichen (Heller, Knipping, 2007, S.44 f.; Knipping, 2007a, S.635; Heimerl, Heller, Pleschberger, 2007, S.51). Dadurch wurde sowohl eine Steigerung der Versorgungsqualität als auch eine kontinuierliche Versorgung erreicht (Europarat, 2003, S.51).
1.2 Aufbau der Arbeit
Im ersten Teil der Arbeit erfolgt eine Darstellung der theoretischen Grundlagen, in denen die Grundzüge der Palliative Care und der Palliative Home Care dargestellt werden. Außerdem wird die derzeitige gesundheitspoltische Situation hinsichtlich der Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) erläutert. Darauf aufbauend werden die Grundlagen der Netzwerktheorie als eine Voraussetzung für die ambulante Versorgung dargelegt. Basierend auf einer Literatur- und Datenbankrecherche (Kapitel vier) werden Vorschläge für die Konzeption einer Netzwerkstruktur, Entwicklungsschwerpunkte sowie Möglichkeiten der Umsetzung im Kapitel sechs dargestellt. Abschließend dient Kapitel sieben der Zusammenfassung und dem Ausblick.
2. Grundlagen
Die theoretischen Grundlagen geben einen Überblick über das Wesen der Palliative Care. Zudem erfolgt eine Abgrenzung und detaillierte Darstellung der ambulanten Palliativversorgung (Palliative Home Care) und eine theoretische Erläuterung der Netzwerkbildung und -gestaltung, da die Vernetzung regionaler Akteure eine wesentliche Voraussetzung für Palliative Home Care darstellt.
2.1 Palliative Care
Im folgenden Abschnitt wird ein theoretischer Einblick in die Palliative Care gegeben, anhand dessen eine Grundlage für die praktische Umsetzung geschaffen wird.
2.1.1 Begriffsdefinition
Die Bezeichnung „Palliative Care“ wurde im Jahr 1975 durch Balfour Mount[2] geprägt. „Palliative“ basierte auf dem lateinischen Wort „pallium“ und bedeutete soviel wie „der Mantel“. Student et al. übersetzten „Palliative Care“ wie folgt: „liebevoll-umhüllende Fürsorge für Menschen in der letzten Lebenskrise“ (Student, Napiwotzky, 2007, S.7). Der Begriff bezeichnete die Linderung von Beschwerden bei einer Krankheit in Verbindung mit Fürsorge und Pflege (Steffen-Bürgi, 2007, S.30 f.). Mit der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 1990 konnte sich der Begriff „Palliative Care“ weltweit durchsetzen. Die WHO hatte dabei den von Balfour Mount geprägten Begriff mit den „konzeptionellen Bausteinen der Hospizidee verbunden“ (Pleschberger, 2007, S.27).
Die Definition der WHO von 1990 wurde im Jahr 2002 durch sie selbst revidiert. Nach dieser Begriffsbestimmung war Palliative Care ein „Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen und ihrer Familien, welche sich im Erleben und der Auseinandersetzung einer unheilbaren, fortschreitenden Erkrankung befinden.“ Dies erfolgt definitionsgemäß durch „ ... die Prävention und Linderung von Leiden, durch eine frühzeitige Identifikation, tadellose Einschätzung und Behandlung von Schmerzen und anderen physischen, psychosozialen und spirituelle[n] Belastungen ...“.
Palliative Care
- unterstützt die Linderung von Schmerzen und anderen belastenden Symptomen,
- bekennt sich zum Leben und betrachtet Sterben und Tod als einen natürlichen Prozess,
- setzt sich dafür ein, den Tod weder hinauszuzögern noch zu beschleunigen,
- integriert psychosoziale und spirituelle Aspekte in einer umfassenden Betreuung (Care),
- bietet ein Unterstützungssystem, um den betroffenen Menschen zu helfen, ein möglichst aktives Leben bis zum Tod führen zu können,
- bietet ein Unterstützungssystem, um den Familien zu helfen, den Krankheitsverlauf und die eigene Trauer besser zu bewältigen,
- benötigt ein interdisziplinäres und interprofessionelles Team, welches sich an den Bedürfnissen des betroffenen Menschen und seiner Familie orientiert und welches Unterstützung in der Trauerarbeit liefert - sofern dies gewünscht ist -,
- soll die Lebensqualität verbessern und versucht, den Verlauf der Krankheit positiv zu beeinflussen,
- ist bereits in der frühen Phase einer Erkrankung umzusetzen, auch in Kombination mit anderen Interventionen, welche lebensverlängernde Möglichkeiten in Aussicht stellen - wie zum Beispiel Chemotherapie und Bestrahlung - und schließt weitere Interventionen zum besseren Verständnis und für einen gezielten Umgang mit belastenden Symptomen und Komplikationen ein (WHO, 2009).
Diese Definition erweiterte den ursprünglichen Hospizansatz, denn Palliative Care setzte nicht erst in den letzten Lebenswochen ein, sondern zum Zeitpunkt der lebensbedrohlichen Diagnosestellung. Außerdem wurde ein interdisziplinäres Team zur Behandlung und Betreuung in den Vordergrund gerückt. Das ursprüngliche Phasenmodell (Abbildung 1, Abbildung 2) verschob sich in Richtung von Modellen, in denen simultan kurative und palliative Behandlungskonzepte eingesetzt wurden. Zudem wurde die aktive Trauerarbeit mit den Angehörigen von Beginn der palliativen Betreuung an in den Prozess der „Palliative Care“ einbezogen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Beziehung zwischen Hospiz-Pflege und kurativer Pflege; Quelle: Student, Napiwotzky, 2007, S.11
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Der Einsatz von Palliative Care bei einer tödlich verlaufenden Erkrankung; Quelle: Student, Napiwotzky, 2007, S.11
Neben der Definition der WHO wurde im Jahr 1989 der Begriff durch die European Association for Palliative Care (EAPC) erklärt. Demnach wurde Palliative Care als eine „aktive, umfassende Betreuung und Behandlung von Betroffenen, deren Erkrankung auf kurative Behandlungsmaßnahmen nicht mehr anspricht, verstanden. Die Kontrolle von Schmerzen und anderen Symptomen sowie von sozialen, psychischen und spirituellen Problemen stand im Vordergrund.“ Die EAPC betonte ebenso wie die WHO die Interdisziplinarität in der Betreuung und Behandlung. Dabei wurde die Fürsorge/Pflege (Care) in ihrer ureigensten Form betrachtet, wobei die Bedürfnisse der Betroffenen im Mittelpunkt stehen. Der Ansatz berücksichtigte den betroffenen Menschen, seine Familie sowie auch seine Umwelt, bejahte das Leben und betrachtete das Sterben als einen normalen Prozess, der weder beschleunigt noch hinausgezögert wird. Ebenso wie in der Definition der WHO war das Ziel der Palliative Care das Erreichen einer bestmöglichen Lebensqualität (Steffen-Bürgi, 2007, S.36).
Aus den Definitionen konnten die Eigenschaften von Palliative Care abgeleitet werden. Ergänzend zu den bereits genannten Aspekten existieren unterschiedliche Modelle, die als Teilbereiche der Palliative Care gesehen wurden. Dazu zählten die Begriffe „Supportive Care“ und „End-of-Life-Care“. Während Supportive Care einerseits Maßnahmen zur psychischen sowie sozialen Unterstützung und andererseits Aktivitäten der (medizinischen)
Symptomlinderung beschrieb (Steffen-Bürgi, 2007, S.34), war End-of-Life-Care durch die Behandlung und Betreuung von terminalen und sterben Menschen charakterisiert (Meuret, 2008, S.25).
2.1.2 Begriffsherkunft und -entwicklung - Cicely Saunders
Die neue Hospizidee, die auf die Initiative von Dr. Cicely Saunders (Großbritannien, 1940) zurückging, bildete die Grundlage für das heutige Verständnis von Palliative Care. Dr. Saunders, Krankenschwester, Ärztin und Sozialarbeiterin, gründete 1967 das erste Hospiz (St. Christophers Hospiz) der neuen Art. Der besondere Unterschied zu früheren Bewegungen und Einrichtungen waren die ausgeprägte Symptomkontrolle und die Schmerztherapie. Das Credo des Hospizes war es, von den sterbenden Menschen und ihren Angehörigen zu lernen (Student, Napiwotzky, 2007, S.6). Die ursprünglichen Hospize[3] waren Herbergen für Pilger entlang der großen Pilgerstraßen in Europa, die in der Zeit des Mittelalters von großen Mönchsorden gebaut wurden (Pleschberger, 2007, S.25). Die Basis für das Hospizkonzept bildete das christentümliche Verständnis vom „Leben als eine Reise mit dem Ziel ersehnter Ruhe und Glückseligkeit“ (Pleschberger, 2007, S.25).
Aus der neu entstandenen Idee eines Hospizes durch Saunders entstand der Begriff „Hospice Care“, der die konzeptionellen Elemente vereint. Darin wurde eine multidisziplinäre Sichtweise für die Behandlung und Betreuung der betroffenen Menschen gesehen. Zudem war der Hospizgedanke durch den Einsatz eines multiprofessionellen Teams charakterisiert. Saunders definierte die Medizin, die Pflege, die Sozialarbeit und die Seelsorge als Kerndisziplinen. Ein weiterer Kernbestandteil des Konzeptes bestand in der Interreligiösität (Pleschberger, 2007, S.26).
Saunders entwickelte die Hospizidee als Gegenbewegung auf die zunehmende Institutionalisierung des Sterbens in einem von medizinischer Sichtweise geprägten System, in dem das Sterben als Niederlage galt (Steffen-Bürgi, 2007, S.31). Hiermit sollte der Tabuisierung des Sterbens entgegengewirkt werden. Bereits Saunders stellte fest, dass die meisten ihrer zu betreuenden Personen, zu Hause leben wollten (Student, Napiwotzky, 2007, S.7). Daher wurde im Jahr 1969 der erste ambulante Hospizdienst eröffnet, gefolgt vom ersten Beratungsteam im Jahr 1978 (Pleschberger, 2007, S.26).
In der BRD wurde zwischen Palliativmedizin und Hospizarbeit unterschieden. Palliative Care war ein Modellansatz zur Betreuung und Pflege von betroffenen Menschen, wobei eine stärkere Betonung pflegerischer und medizinischer Aspekte erfolgte. Die Hospizarbeit wurde „primär vom ehrenamtlichen Engagement getragen“ und stellte einen Teil einer Bürgerbewegung dar. Palliative Care wurde als ein „gemeinsames Dach“ begriffen, das Palliativmedizin, Palliativpflege, Hospizarbeit, etc. vereint. Ein Hospiz war ein Teil des Netzwerkes (Pleschberger, 2007, S.27; Schindler, 2007, S.60 ff.).
2.1.3 Palliative Care als Versorgungskonzept
Palliative Care wurde als umfassendes Versorgungskonzept verstanden, welches den Betroffenen in den Mittelpunkt rückte (Kränzle, 2007, S.4; Heller, Knipping, 2007, S.39). Bei der Behandlungs- und Versorgungsgestaltung[4] wurden die realen Versorgungsbedürfnisse, sowie das Befinden des Betroffenen und dessen Angehörigen berücksichtigt, um eine bestmögliche Einflussnahme auf die Lebensqualität herzustellen (Knipping, 2007a, S.635). Palliative Care unterstützte alle Menschen, „die sich mitten in ihrem Leben in einer palliativen Phase befanden“ und sich mit einer unheilbaren, chronischen Erkrankung auseinandersetzten (Knipping, 2007b, S.15ff.).
Die radikale Betroffenenorientierung setzte das Vorhandensein einer inneren Haltung voraus. Diese konnte als „Compassion“ (Mitleidenschaft mit den Schwachen) beschrieben werden. Dabei war Palliative Care besonders um Kommunikation und den Aufbau einer zeitlich begrenzten, intensiven Beziehung zum Betroffenen bemüht. Diese Beziehung meinte aber keinesfalls die Fürsorge von oben nach unten, sondern die Umkehr der - angenommenen - Asymmetrie, denn eine solche Beziehung entstand, indem die „Lebensgeschichte, die Gefühle und Gedanken der Betroffenen aufgenommen und angenommen wurden“. Die Betroffenen hatten einen Vorsprung an bestimmten Erfahrungen. Sie selbst schrieben die „Partitur bei der Orchestrierung des Lebensendes“ (Heller, Knipping, 2007, S.44f.).
Das „Herzstück“ der Palliative Care war das Konzept des „Total Pain“ (Steffen-Bürgi, 2007, S.32), welches ein durch Saunders entwickeltes Versorgungskonzept darstellte. Dieses Konzept berücksichtigte nicht nur körperliche Schmerzen, sondern auch mentale sowie spirituelle Probleme und trug damit dem ganzheitlichen Ansatz der Palliative Care Rechnung. Für eine vertrauensvolle Beziehung wurden die Menschen in ihrer individuellen Lebenslage und Schmerzgeschichte gesehen, sodass auf ihr individuelles Schmerzempfinden reagiert werden konnte (Heller, Knipping, 2007, S.41).
Saunders beschrieb in ihrem Konzept bereits die Notwendigkeit der Interkulturalität und Interreligiösität. Beide Bestandteile gehörten ebenso zu einer der Grundideen von Palliative Care. Diese Auffassung basierte auf der pluralistischen Gesellschaft, die durch unterschiedliche religiöse Weltanschauungen und einen hohen Individualisierungsgrad charakterisiert wurde. Das Verständnis der Palliative Care ergab sich aus Achtung und Respekt vor dem Menschen (Heller, Knipping, 2007, S.45). Der Betroffene wurde in seiner Einzigartigkeit gesehen (SAMW, 2006, S.4 ff.).
Die Interventionen erfolgten mittels eines interdisziplinären und interprofessionellen Teams (so früh wie möglich), wobei die Zusammenarbeit verschiedener Professionen, Disziplinen und Organisationen im Vordergrund stand (Knipping, 2007b, S.15ff.). Die Notwendigkeit der Interdisziplinarität und der Interprofessionalität begründete sich in der selektiven Blindheit der jeweiligen Disziplin bzw. Berufsgruppe. Eine Ergänzung durch andere Sichtweisen vervollständigte das Gesamtbild und ermöglichte die Integration verschiedener Kenntnisse und Erfahrungen (Kränzle, 2007, S.4).
2.1.4 Lebensqualität als zentrales Ziel der Palliative Care
Das zentrale Anliegen von Palliative Care war die Herstellung einer bestmöglichen Lebensqualität von Betroffenen und ihren Angehörigen, die sich mit Problemen einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert sahen. Das primäre Ziel der Palliative Care war demnach nicht nur die Orientierung auf die klinische Symptomatik. Lebensqualität war als das subjektive Erleben des persönlichen Gesundheitszustandes definiert. Sie stellte ein Konzept dar, welches die individuellen, subjektiven und situativen Gegebenheiten berücksichtigte (Steffen-Bürgi, 2007, S.32; Meuret, 2008, S.31).
Zur Verbesserung der Lebensqualität und des Wohlbefindens wurden Symptomkontrolle und das Prinzip des „Active Total Care“ angewendet. Die Symptomkontrolle und insbesondere Schmerztherapie waren gekennzeichnet durch die „gezielte Vermeidung, frühzeitige Erfassung und Dokumentation sowie die Behandlung körperlicher Beschwerden und psychischer, sozialer und spiritueller Belastungen“(Steffen-Bürgi, 2007, S.33). Zur Verbesserung der Lebensqualität erfolgte die Linderung von krankheitsbezogenen und - unabhängigen Beschwerden (Müller-Busch, 2008, S.8). Das Prinzip der „Active Total Care“ bezeichnete ein ganzheitliches, umfassendes Versorgungskonzept. Dabei standen die individuellen Betreuungsbedürfnisse[5] im Mittelpunkt. Damit eine Verbesserung der Lebensqualität erreicht werden konnte, verwies das Konzept auf die ressourcenorientierte und salutogenetische Betreuung sowie auf „die partizipative Gestaltung der Beziehung zwischen dem Betroffenen und seinen Betreuungspersonen“ (Bürgi-Steffen, 2007, S.32 f.).
2.2 Palliative Home Care
Palliative Care wurde in verschiedenen Versorgungskontexten realisiert. Diese erstreckten sich über den stationären und ambulanten Sektor und schlossen zum Beispiel (z.B.) Palliativstationen, stationäre Hospize und ambulant tätige Betreuungsdienste ein (Student, Napiwotzky, 2007, S.14ff.). Im folgenden Abschnitt werden zunächst einige historische sowie aktuelle Entwicklungstendenzen erläutert. Daraufhin erfolgen die Darstellung der gesetzlichen und rechtlichen Grundlagen, der Voraussetzungen der ambulanten Palliativversorgung und deren inhaltliche Besonderheiten.
2.2.1 Zunahme stationärer und ambulanter Einrichtungen
In der Bundesrepublik Deutschland (BRD) begann Anfang 1980 die Entwicklung der Hospizidee. Basierend auf den Euthanasieverbrechen während des Nationalsozialismus, traf „die Vorstellung, Sterbende in spezielle Abteilungen der Krankenhäuser abzuschieben“ zunächst auf Ablehnung, sodass sich die Hospizidee nur schwer durchsetzen konnte (Kränzle, 2007, S.3). Die Erkenntnis, dass der Sterbeprozess besondere
Betreuungsmaßnahmen erforderte, führte im Jahr 1983 zur Entstehung der ersten Palliativstation in der BRD. Diese war in das Universitätsklinikum von Köln integriert. Im folgenden Jahr entstand der erste ambulante Hospizdienst, welcher 1986 durch das erste stationäre Hospiz ergänzt wurde. Der „Prototyp“ deutscher stationärer Hospize wurde 1987 in Recklinghausen eröffnet. Diese Einrichtung bestand aus neun Betten und bot sterbenskranken Menschen eine umfassende Versorgung. Aufgrund ungesicherter Finanzierungsmöglichkeiten eröffneten in den folgenden Jahren wenig ähnliche Einrichtungen. Seit 1990 nahm die Zahl stationärer Hospize zu, da mit dem § 37 Abs. 1 Sozialgesetzbuch fünf (SGB V) eine mögliche Finanzierung nach dem Prinzip „ausgelagerte Häuslichkeit“ geschaffen wurde. Da dieses Prinzip politisch nicht durchzusetzen war, erfolgte 1997 die Integration des § 39 a in das SGB V. Damit wurde eine Finanzierungsgrundlage stationärer Hospize gesetzlich gesichert. Zur Stärkung des ambulanten Sektors bot die Erweiterung des § 39 a SGB V im Jahr 2001 eine Basisförderung für ambulante Hospizdienste (Kränzle, 2007, S.3; Student, Napiwotzky, 2007, S.11 f.). Seit dem 01. April 2007 hatten die Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) einen Anspruch auf SAPV, worauf im weiteren Verlauf der Arbeit näher eingegangen wird.
In der BRD war insgesamt betrachtet eine Zunahme stationärer und ambulanter Einrichtungen zwischen 1986 und 2008 zu verzeichnen (Abbildung 3). Dabei wurden „autonome“ stationäre Hospize sowie krankenhausintegrierte Palliativstationen für den stationären Bereich und ambulante Hospiz- und Palliativpflegedienste unterschieden. Durch den Anstieg der Zahl der Hospize in der BRD gab es im Jahr 2007 „in jedem größeren Ort“ eine derartige Versorgung (Kränzle, 2007, S.3; Student, Napiwotzky, 2007, S.12). Trotz des Anstiegs der Anzahl stationärer Einrichtungen, konnte dennoch „[...] nicht von einer ausreichenden Versorgung gesprochen werden“. Erfahrungen aus Großbritannien zeigten, dass ein Bedarf von rund 50 bis 60 Betten pro einer Millionen Einwohner bestand. Im Jahr 2008 lag das Bettenangebot mit rund 2.600 Betten in 300 stationären Hospizen und Palliativstationen deutlich unter dem errechneten Bedarf (Müller-Busch, 2008, S.9).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Entwicklung von Palliativ- und Hospizeinrichtungen in Deutschland zwischen 1986 und 2008; Quelle: Müller-Busch, 2008, S.9
2.2.2 SGB V, rechtliche Bestimmungen und Empfehlungen
In Deutschland wurden drei Versorgungebenen unterschieden. Dazu zählten der Palliativmedizinische Ansatz, die Allgemeine und die Spezialisierte Palliativversorgung. Entsprechend des Palliativmedizinischen Ansatzes sollten alle Fachkräfte, die im Gesundheitswesen tätig waren, mit den grundlegenden Prinzipien der Palliativmedizin vertraut sein und diese praktisch umsetzen können. Die Allgemeine Palliativversorgung beschrieb Tätigkeiten von im Gesundheitswesen tätigen Fachkräften, die nicht ausschließlich im Bereich der Palliativmedizin arbeiteten, aber Fortbildungen absolviert hatten und über Kenntnisse in diesem Bereich verfügten. Die Spezialisierte Versorgung bezeichnete Dienste, die hauptsächlich Palliativversorgung leisteten. Sie betreuten in der Regel Betroffene mit komplexen und schwierigen Bedürfnissen und benötigten daher ein höheres Maß an Ausbildung (Europarat, 2003, S.35).
Grundlagen des SGB V
Durch das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-WSG), welches am 01. April 2007 in Kraft trat, wurde der gesetzliche Anspruch der Versicherten auf die SAPV mit den §§ 37 b SGB V und 132 d SGB V geschaffen (Gesetztestexte[6], Richtlinie des G-BA, Gemeinsame Empfehlungen der Krankenkassen).
Die Durchführung einer SAPV kam gem. § 37 b SGB V für Menschen, die mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei zugleich begrenzter Lebenserwartung und besonders aufwändiger Versorgung, in Betracht. Diese Leistung war von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu verordnen und umfasste neben ärztlichen und pflegerischen Leistungen, Schmerztherapie und Symptomkontrolle. Das Ziel der SAPV war die Betreuung der betroffenen Menschen in vertrauter häuslicher Umgebung oder im familiären Bereich (§ 37 b Abs. 1 SGB V). Ebenso hatten Personen in stationären Pflegeeinrichtungen einen Anspruch auf die SAPV (§ 37 b Abs. 2 SGB V).
Über die SAPV sowie deren Vergütung und Abrechnung sollten die Krankenkassen mit geeigneten Einrichtungen oder Personen Verträge abschließen, soweit dies für eine bedarfsgerechte Versorgung notwendig war (§ 132 d Abs. 1 SGB V). Zudem sollten Empfehlungen über die personellen und sächlichen Anforderungen an die Leistungserbringung sowie über Maßnahmen zur Qualitätssicherung erarbeitet werden. Dies erfolgte durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf
Bundesebene, der Spitzenorganisation der Hospizarbeit und der Palliativversorgung sowie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (§ 132 d Abs. 2 SGB V).
Richtlinie (RL) des G-BA
Der G-BA war gesetzlich verpflichtet, eine Richtlinie über die SAPV zu erstellen, die die Anforderungen an die Erkrankung und die Kooperation der Leistungserbringer mit den bestehenden stationären Hospizen und ambulanten Hospizdiensten sowie mit dem verordnenden Arzt beinhaltete (§ 37 b Abs. 3 SGB V).
Im Dezember 2007 verabschiedete der G-BA die „Richtlinie des G-BA zur Verordnung von Spezialisierter ambulanter Palliativversorgung“. Demnach war das Ziel der SAPV, die Lebensqualität und die Selbstbestimmung schwerstkranker Menschen zu erhalten, zu fördern und zu verbessern, um ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung oder in stationären Pflegeeinrichtungen zu ermöglichen. Bei der Leistungserbringung war anstelle eines kurativen Ansatzes die medizinisch-pflegerische Zielsetzung, Symptome und Leiden einzelfallgerecht zu lindern. Außerdem standen die individuellen Bedürfnisse und Wünsche des Betroffenen bzw. seiner ihm vertrauten Personen im Mittelpunkt. Die SAPV umfasste zusätzlich die pädiatrische Versorgung (GB-A, 2007a).
Die Versicherten hatten einen Anspruch auf die SAPV, wenn eine besonders aufwändige Versorgung nach medizinischen und pflegerischen Erfordernissen auch ambulant oder in stationären Pflegeeinrichtungen erbracht werden konnte und wenn eine besondere Erkrankung zu Grunde lag (ebd.).
Nach dieser Richtlinie gilt eine Erkrankung
- als nicht heilbar, wenn nach dem allgemeinen anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse Behandlungsmaßnahmen nicht zur Beseitigung dieser Erkrankung führen können,
- als fortschreitend, wenn ihr Verlauf trotz medizinischer Maßnahmen nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse nicht nachhaltig aufgehalten werden kann,
- als weit fortgeschritten, wenn die Verbesserung von Symptomatik und Lebensqualität sowie die psychosoziale Betreuung im Vordergrund der Versorgung stehen und die Lebenserwartung nach begründeter Schätzung der Ärztin oder des Arztes auf Tage, Wochen oder Monate gesunken ist (ebd.).
Als entscheidendes Abgrenzungskriterium zur allgemeinen ambulanten Palliativversorgung (AAPV) galt der besondere Versorgungsbedarf der Betroffenen (G-BA, 2007b, S.3 f.). Danach bestand ein solcher Bedarf, wenn anderweitige ambulante Versorgungsstrukturen nicht ausreichten, um die in § 1 Abs. 1 der RL formulierten Ziele der Palliativversorgung (menschenwürdiges Leben bis zum Tod in der vertrauten Umgebung, optimierte Symptomkontrolle, etc.) zu erreichen. Dazu gehörte beispielsweise eine komplexe Symptomatik, die spezifische palliativmedizinische und -pflegerische Maßnahmen voraussetzte (GB-A, 2007a).
Die SAPV wurde ausschließlich durch die Leistungserbringer nach § 132 d SGB V je nach Versorgungsbedarf intermittierend oder durchgängig als Beratungsleistung, Koordination der Versorgung, additiv unterstützende Teilversorgung oder als vollständige Versorgung - insbesondere wenn die AAPV nicht ausreicht - erbracht[7]. Sie wurde grundsätzlich als Leistung verstanden, die das bestehende Versorgungsangebot der Vertragsärzte, Krankenhäuser und Pflegedienste ergänzt. Die Zusammenarbeit der Leistungserbringer erforderte die Abstimmung der Maßnahmen sowie die Erstellung verbindlicher Kooperationsvereinbarungen mit den Kooperationspartnern (G-BA, 2007a).
Insgesamt ging der GB-A davon aus, dass 10,0% aller Sterbenden eine SAPV benötigten und für die große Mehrheit die AAPV ausreichend war (G-BA, 2007b).
Gemeinsame Empfehlungen des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen
Im Juni 2008 veröffentlichte der Spitzenverband Bund der Krankenkassen die „Gemeinsamen Empfehlungen nach § 132 d Abs. 2 SGB V für die SAPV“[8].
Die SAPV sollte durch fachlich kompetente, spezialisierte Leistungserbringer nach den allgemein anerkannten medizinischen und pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen bedarfsgerecht und wirtschaftlich erbracht werden. Zu diesen Leistungserbringern gehörten qualifizierte Ärzte und Pflegekräfte, die sich an der Konzeption von Palliative-Care-Teams (PCT) orientierten. Die personellen Anforderungen umfassten zusätzlich die Notwendigkeit einer telefonischen Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit sowie die ständige Verfügbarkeit des Arztes und/oder der Pflegefachkraft. Dies schloss Hausbesuche ein. Dabei musste das Fachpersonal bestimmte Anforderungen erfüllen (Spitzenverband Bund der Krankenkassen, 2008, S.2-4), worauf in den folgenden Kapiteln näher eingegangen wird.
Eine psychosoziale Unterstützung sollte bei der Leistungserbringung in enger Zusammenarbeit z.B. mit ambulanten Hospizdiensten nach § 39 a Abs. 2 SGB V, Seelsorge und Sozialarbeit gewährleisten werden (Abbildung 4). Zudem wurde eine Zusammenarbeit der PCT mit den Hausärzten angestrebt. Daraus entstanden multiprofessionell vernetzte Versorgungsstrukturen im regionalen Gesundheitssystem, wobei der spezialisierte Leistungserbringer in die regionale Versorgungsstruktur zu integrieren war (ebd., S.3 f.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Verträge gem. § 132 d SGB V; Quelle: Bayrische Hospiz Stiftung, 2009
Zu den Mindestanforderungen an die sächliche Ausstattung gehörten eine geeignete Patientendokumentation, Arzneimittel für die Krisenintervention, Arzt/Pflegekoffer/Bereitschaftstasche sowie eine geeignete administrative Infrastruktur, wie z.B. Büroräume, Kommunikationstechnik. Außerdem mussten die spezialisierten Leistungserbinger über eine eigenständige Adresse und geeignete Räumlichkeiten verfügen, in denen Beratungen von Betroffenen und Angehörigen, Teamsitzungen und Besprechungen und die Lagerhaltung von Arzneimitteln möglich waren (ebd., S.4).
Zudem waren geeignete Maßnahmen - wie z.B. regelmäßige Fortbildungen, multidisziplinäre Qualitätszirkel und Fallbesprechungen sowie die Einrichtung eines geeigneten Dokumentationssystems - zur Qualitätssicherung zu treffen (ebd., S.5 f.).
2.2.3 Leistungserbringer lebenslimitierender Erkrankungen, wie z.B. fortgeschrittene Krebsleiden, übernahmen ebenso Fachärzte einen wesentlichen Anteil. Die Leistungserbringer hatten unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen. Für die Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Palliative Care gehörten im ambulanten Setting immer auch Hausbesuche (Schindler, 2007, S.60 ff.).
Die tragende Struktur für die SAPV in Deutschland, welche bereits in einigen Modellprojekten aufgebaut wurde, war das PCT, dessen Mitglieder ausschließlich oder schwerpunktmäßig in der SAPV tätig waren (Müller-Busch, 2008, S.10). Diese bezogen pflegerische und/oder ärztliche Aspekte bei der Betreuung und Begleitung schwer kranker und sterbender Menschen ein. Zudem umfasste die Arbeit dieser Teams die Beratung der Betroffenen und ihrer Angehörigen sowie des involvierten Fachpersonals bei speziellen Problemen (Schindler, 2007, S.60 ff.). Entsprechend der individuellen Bedürfnisse erfolgte ein abgestimmtes Hinzuziehen anderer Berufsgruppen, wie Seelsorger, Sozialarbeiter, Physiotherapeuten und freiwillige Helfer (Abbildung 5). Die Beteiligung dieser Professionen war für die umfassende Betreuung unverzichtbar[9] (Schindler, 2007, S.60 ff., Europarat, 2003, S.14)[10].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Struktur der Versorgung von Palliativpatienten durch Koordination von Angeboten in der Allgemeinen und Spezialisierten Palliativversorgung; Quelle: Müller-Busch, 2008, S.11)
In den „Empfehlungen des Ministerkomitees des Europarats zur Strukturierung der palliativmedizinischen und -pflegerischen Versorgung“ wurde die Notwendigkeit der Teamarbeit ebenfalls hervorgehoben. Demnach musste die Versorgung interdisziplinär und multiprofessionell ausgerichtet werden. Alle Teammitglieder sollten sich ihrer eigenen Rolle bewusst sein und zur Erfüllung ihrer Aufgaben die entsprechenden Kenntnisse besitzen. Die Erstellung der Pflege- und Behandlungspläne erfolgte in Abstimmung aller Beteiligten (PCT, Betroffener, Angehörige). Die ambulante Palliativversorgung erforderte das Wirken eines Koordinators, damit sich die Informationen der involvierten Professionen und Disziplinen gegenüber den Betroffenen und ihren Angehörigen nicht widersprechen. An dieser Stelle wurde auf die emotionalen und physischen Belastungen für Pflegende und Begleitende hingewiesen. Daher wurde die Betreuung und Begleitung der Pflegenden und Begleitenden als ein wesentlicher Bestandteil eines palliativmedizinischen Konzepts angesehen („Caring for Caregivers) (Europarat, 2003, S.14).
In Deutschland konnte sich neben dem Begriff des PCT auch die Bezeichnung „Ambulanter Palliativdienst“ (APD) durchsetzen (Schindler, 2007, S.60 ff.).
Neben dem Fehlen von Finanzierungsmöglichkeiten für die spezialisierten Systeme, erschwerte die Konkurrenzsituation zwischen den Leistungserbringern die Implementierung eines PCT. Eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz war demnach die „glaubhafte Darstellung des Angebots der SAPV als Ergänzung und nicht als Konkurrenz“. Zudem war es notwendig, den persönlichen Nutzen/Profit für die anderen Leistungserbringer zu betonen (Schindler, 2007, S. 62).
2.2.4 Basisvoraussetzungen für SAPV
Zu den inhaltlichen Besonderheiten von Palliativ-Care-Angeboten im ambulanten Sektor gehörten Schnittstellenmanagement, Fachkompetenz und die sektorenübergreifende Zusammenarbeit sowie spezielles Fachwissen (Schindler, 2007, S.63 f).
Schnittstellenmanagement und Integration
In der Regelversorgung herrschte häufig eine unzureichende Kommunikation zwischen dem Fachpersonal über mehrere Schnittstellen hinweg. Zudem waren Defizite in der gemeinsamen Abstimmung der Versorgung erkennbar. Die Palliativversorgung erforderte eine hohe Flexibilität in der Versorgung und demnach einen häufigen Abstimmungsbedarf zwischen den Leistungserbringern, da eine hohe Betroffenenorientierung zu Grunde lag und demnach individuelle Krankheitsverläufe entstanden (Schindler, 2007, S.63 f.). Außerdem entstanden aufgrund einer unzulänglichen Kommunikation Behandlungsverzögerungen und Reibungsverluste, Doppeluntersuchungen oder „fragwürdige Therapieschritte“ sowie lange Wege durch das Versorgungssystem. Durch die Entwicklung und Implementierung integrierter Versorgungsverbünde war die Möglichkeit gegeben, direkte Zugänge zu Versorgungsangeboten und gangbare Pfade durch das Versorgungssystem für den Betroffenen zu schaffen (Scheaffer, 2005, S.77 ff.).
Durch eine Integration der in die Palliativversorgung involvierten Akteure war es möglich, die SAPV „nahtlos, ohne Unterbrechungen und Diskontinuitäten“ durchzuführen. Dies ermöglichte eine kontinuierliche patientenorientierte Betreuung (Knipping, 2007a, S.637). Da die Palliativversorgung sowohl im ambulanten als auch im stationären Sektor erfolgte, war im Rahmen einer ganzheitlichen Betreuung und Versorgung eine Integration dieser Sektoren anzustreben (Abbildung 6), denn Brüche und Diskontinuitäten waren in der Versorgung schwerkranker und sterbender Menschen keine Ausnahmeerscheinung (Medizinische Hochschule Hannover, 2004, S.244). Diese zeigten sich besonders während der häuslichen Versorgung. In der Konsequenz entstand ein „permanenter Wechsel zwischen Krankenhausversorgung und häuslicher Versorgung“. Die Ursachen lagen in der wenigen Beachtung der tatsächlichen Weiterversorgung nach der Entlassung aus dem Krankenhaus (Scheaffer, 2005, S.81 f.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Mögliche Schnittstellen in der Palliativversorgung; Quelle: Medizinische Hochschule Hannover, 2004, S.245
[...]
[1] Gesamtbevölkerung 82,3 Millionen Menschen, darunter 42,0 Millionen Frauen und 40,3 Millionen Männer (Jahr 2006)
[2] kanadischer Onkologe, Schüler von Dr. C. Saunders
[3] Der Begriff „Hospiz“ leitet sich aus dem lateinischen Begriff „hospitum“ ab, was mit „Gastfreundschaft“ übersetzt wird. (Pleschberger, 2007, S. 25)
[4] biologische, soziale, psychische, biografische und lebensweltliche Aspekte (Knipping, 2007a, S.635, S. 15 ff.).
[5] Betreuungsbedürfnisse: physisch, psychisch, kulturell, spirituell, sozial (Bürgi-Steffen, 2007, S. 32 f.)
[6] Anlage 1 :Gesetzestexte
[7] Anlage 2: Inhalte SAPV
[8] Gesetzlicher Auftrag ergibt sich aus § 132 d Abs. 2 SGB V
Die professionellen Träger der AAPV waren vordergründig die Hausärzte und die allgemeinen Pflegedienste. In der Behandlung chronisch progredienter und
[9] Eine ausführliche Analyse der zu beteiligenden Professionen und Disziplinen folgt.
[10] Glossar: „Palliative-Care-Team“
- Citation du texte
- Stephanie Schmidt (Auteur), 2009, Spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Konzeption einer Netzwerkstruktur in Westsachsen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148552
Devenir un auteur





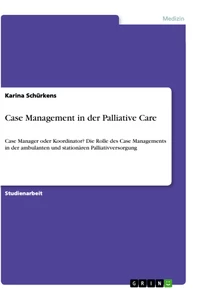











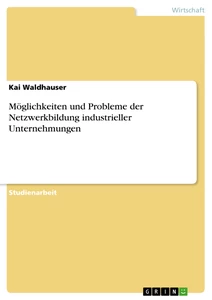

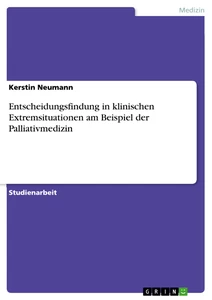


Commentaires