Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG
2 ZIEL UND AUFBAU DER ARBEIT
I EINFÜHRUNG: SERIENMÖRDER IN DER US-REALITÄT
3 SERIENMORD UND FBI
3.1 DEFINITION UND SERIEMÖRDERTYPOLOGIE GEMÄSS FBI
3.2 DER PSYCHOPATHISCHE SERIENMÖRDER
II DER FIKTIONALE FILM
4 DER FILM ALS NARRATIVER TEXT
4.1 FIKTIONALES ERZÄHLEN
4.2 DAS GENRE
4.3 DAS GENRE PSYCHOTHRILLER
III SERIENMÖRDER IN HOLLYWOOD
5 SERIENMÖRDER ALS FILMFIGUREN
5.1 DIE VERSCHIEDENEN GESICHTER DES FIKTIONALEN SERIENMÖRDERS
5.2 HANNIBAL LECTER UND CO. - REALISTISCHE PSYCHOPATHEN IM FIKTIONALEN FILM
5.3 REALITÄTSNAHE UND REALITÄTSFERNE GEWALTDARSTELLUNGEN IM SERIENKILLERFILM
5.4 EXKURS: DER SERIENMÖRDER ALS FIGUR NARRATIVER DISKONTINUITÄT
5.5 ZUSAMMENFASSUNG & ARBEITSDEFINITIONEN
IV UNTERSUCHUNGSRELEVANTE THEORIEN
6 FIGURENANALYSE IM FILM
6.1 AUFGEBAUTES PERSONENWISSEN IM FILM
6.2 SPEZIFISCHE FUNKTIONSROLLEN UND SOZIALE HANDLUNGSROLLEN
6.3 INDIVIDUALISIERTE FIGUREN
6.4 B ACKSTORY UND B ACKSTORYWOUND NACH MICHAELA KRÜTZEN
6.5 CHARAKTERENTWICKLUNG
6.6 STABILE CHARAKTERMERKMALE UND VORÜBERGEHENDE GEMÜTSLAGEN
6.7 ZUSAMMENFASSUNG
V EMPIRISCHER TEIL
7 UNTERSUCHUNGSZIELE
8 THEORIEN IM KONTEXT DER UNTERSUCHUNG
8.1 DARSTELLUNG
8.2 CHARAKTERENTWICKLUNG
9 FORSCHUNGSFRAGEN
10 METHODE: FILMANALYSE
11 OPERATIONALISIERUNG UND FORSCHUNGSDESIGN
11.1 STICHPROBE
11.2 GRUNDGESAMTHEIT, UNTERSUCHUNGSZEITRAUM UND FILMAUSWAHL
12 UNTERSUCHUNG
12.1 EINZELANALYSEN
12.1.1 BEISPIELANALYSE THE SILENCE OF THE LAMBS (1991)
12.1.2 ANALYSE VON SE7EN (1995)
12.1.3 ANALYSE VON AMERICAN PSYCHO (2000)
12.1.4 ANALYSE VON SAW II (2005)
12.1.5 ANALYSE VON UNTRACEABLE (2008)
12.2 ZUSAMMENFÜHRUNG DER EINZELANALYSEN
12.2.1 KATEGORIENBILDUNG UND - MODIFIZIERUNG: FIGURENDARSTELLUNG
12.2.2 KATEGORIENBILDUNG: FIGURENENTWICKLUNG
13 FIGURENVERGLEICH
13.1 GEMEINSAMKEITEN
13.2 UNTERSCHIEDE
14 ERKENNTNIS
14.1 KEINE SIGNIFIKANTEN VERÄNDERUNGEN IN DER FIGURENDARSTELLUNG
14.2 VERÄNDERUNGEN IN DER FIGURENDARSTELLUNG
14.3 KEINE SIGNIFIKANTE ENTWICKLUNG DER EIGENSCHAFTEN
14.4 ENTWICKLUNGSTENDENZEN
14.5 BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN & FAZIT
15 SCHLUSSWORT
1 Einleitung
Anziehend und abstossend zugleich, üben Serienmörder spätestens seit Jack the Ripper eine am- bivalente Faszination aus. In der Zwischenzeit sind sie zu einem festen Bestandteil der postmo- dernen Kultur geworden, was sich in zahlreichen Büchern, Theaterstücken, Kunstwerken und wissenschaftlichen Seminaren niederschlägt, die den Serienmord und damit den Serienmörder thematisieren. Auch im Film scheint diese zwiespältige Figur nicht an Interesse eingebüsst zu haben, wie Thomas bestätigt:
Serienmord ist en vogue. Auch wenn dieses Phänomen seit dem ersten massenmedialen Boom, [...] Ende der 1980er Jahre [...], als [...] filmisches Thema immer wieder totgesagt wurde, hat es sich längst als fester Bestandteil der Populärkultur etabliert [...].“2
Seit den 90er Jahren nimmt sich vor allem der Film immer wieder dieser seriellen Mörder an, insbesondere Hollywood. Jonathan Demmes Romanverfilmung The Silence of the Lambs gilt diesbezüglich als Wegbereiter. Waren Serienmörder als Filmfiguren bis dahin eher selten anzu- treffen, finden sie mit dem Welterfolg von The Silence of the Lambs endgültig den Weg ins Mainstreamkino.3 So folgen auf Hannibal Lecter zahlreiche weitere Filmfiguren in dieser Ma- nier, man denke hier beispielsweise an Mickey Knox (Natural Born Killers), David Allen Griffin (The Watcher) oder Earl Brooks (Mr. Brooks). Diesen Serienmördern ist gemeinsam, dass sie alle fiktionale, aber realistisch dargestellte Figuren sind, welche aus eigenem Willen töten und deren Handlungen sich in einer Welt abspielen, wie sie auch in der Realität vorkommen kann. In der Psychologie des Serienmordes spricht man von diesen bewusst handelnden Serienmördern von Psychopathen. Ein Psychopath leidet gemäss Definition an einer Persönlichkeitsstörung.4 Das Töten aus eigenem Willen kann eindeutig als Persönlichkeitsstörung betrachtet werden, des- halb werden in der vorliegenden Arbeit die Begriffe Psychopath und psychopathisch für diejeni- gen Serienmörder verwendet, welche aus eigenem Willen töten.
Angesichts der regelrechten Überschwemmung an solchen Serienmörderfiguren seit The Silence of the Lambs, stellt sich hier die Frage, ob sich die Darstellung dieser Figuren im direkten Ver- gleich seit Hannibal Lecter verändert hat oder über die Jahre konstant geblieben ist. Was erfährt der Zuschauer über diese Figuren, welche so nah am wirklichen Menschen sind? Gibt es ge- meinsame Darstellungsmuster, welche diese Serienmörderfiguren auszeichnen? Sind Tendenzen einer sich verändernden Figurendarstellung zu erkennen? Und wie verhält es sich mit den Eigen- schaften dieser realistischen und bewusst handelnden Serienmörderfiguren, lässt sich eine Ent- wicklung ausmachen oder bleibt der Charakter über die Jahre konstant?
Ein Blick in wissenschaftliche Abhandlungen zu diesem Thema zeigt, dass eine Untersuchung in diese Richtung bis jetzt noch nicht unternommen wurde. So beschreibt etwa der Journalist Chris- tian Fuchs in seinem Buch Kinokiller 50 Mörder und die Filme, die sich auf ihre Taten beziehen oder davon inspiriert wurden, jedoch bleibt eine ausführliche und vergleichende Figurenanalyse aussen vor. Auch Philip L. Simpsons Abhandlung Psycho Paths - Tracking the serial killer though contemporary american film and fiction, fehlt es an einer ausführlichen und vor allem vergleichenden Figurenanalyse dieser Antihelden. Simpson konzentriert sich vielmehr auf die historische Entwicklung dieses filmischen Phänomens. Michaela Krützen wiederum zergliedert und analysiert anhand The Silence of the Lambs die Protagonistin und Heldin des Films, wobei sie auch Bezug auf den Serienmörder Hannibal Lecter nimmt, jedoch liegt ihr Fokus nicht auf einer Analyse dieser beiden Figuren, sondern auf der Erzählstruktur des Hollywoodkinos im Allgemeinen. Ein aktuelles Buch aber nimmt sich der Lücke an spezifischen Charakteranalysen fiktionaler Serienmörder in Lecter-Manier zumindest teilweise an: Dessecting Hannibal Lecter liefert insgesamt zwölf Essays mit Fokus auf den bekannten Antihelden. Die Figur Hannibal Lecter selbst wird hier jedoch nicht primär anhand der Filme untersucht, sondern vor allem an- hand Thomas Harris’ Romanen. Zudem handelt es sich bei den Essays selbst nicht um analyti- sche, sondern um interpretative Texte. Deshalb kann dieses Buch im Folgenden zwar als Hilfs- mittel dienen, jedoch nicht als Grundlage.
Angesichts dieser Lücke an vergleichenden filmanalytischen Untersuchungen fiktionaler Se- rienmörderfiguren, wie sie dem Vorbild Hannibal Lecters so zahlreich folgten, soll im Folgenden eine solche Analyse durchgeführt werden. Deshalb widmet sich die vorliegende Arbeit der Dar- stellung und Entwicklung fiktionaler Serienmörderfiguren seit The Silence of the Lambs bis heu- te. Der Fokus liegt dabei auf realistisch dargestellten Serienmörderfiguren, welche aus eigenem Willen töten und damit bewusst handeln. Die Figur Hannibal Lecter bildet den Ausgangspunkt der Analyse, deshalb lauten die, dieser Studie zugrunde liegenden Forschungsfragen wie folgt:
a) Hat sich die Darstellung des männlichen, fiktionalen, realistisch dargestellten und bewusst handelnden Serienmörders im Hollywoodkino seit Jonathan Demmes The Silence of the Lambs verändert?
b) Wie haben sich die Eigenschaften dieser Figur seitdem entwickelt?
Wie die Fragen beantwortet werden sollen und wie die Untersuchung aufgebaut ist, wird im nächsten Kapitel genauer erläutert.
2 Ziel und Aufbau der Arbeit
Ziel der vorliegenden Studie ist es, die oben genannten Forschungsfragen zu beantworten. Dazu muss zunächst jede Serienmörderfigur einzeln auf Darstellung und Entwicklung hin analysiert werden, um anschliessend ein Kategoriensystem mit beschreibenden Kategorien entwickeln zu können. Diese machen die jeweilige Figurendarstellung, sowie die jeweilige Charakterentwick- lung sichtbar und ermöglichen am Ende einen Vergleich zwischen den hier analysierten Figuren. So ist es möglich, Aussagen in Bezug auf die Darstellung und Entwicklung der hier untersuchten Serienmörderfigur zu machen und damit Antworten auf die Forschungsfragen zu erhalten.
Um ein Verständnis für die hier behandelte Thematik zu gewährleisten, wird zunächst der Serienmörder in der US-amerikanischen Realität behandelt. Dabei wird auf den Serienmord und die damit verbundene Rolle des FBI eingegangen (Kap. 3), sowie auf die vom FBI entwickelten Serienmördertypologien (Kap. 3.1). Daneben wird ausserdem der psychopatische Serienmörder genauer beschrieben, da dieser ein bewusst handelnder Täter ist, so wie er hier in fiktionaler Form untersucht werden soll (Kap. 3.2).
Im zweiten Teil der Arbeit wird der fiktionale Film genauer betrachtet. Hier geht es einerseits um den Film als narrativen Text (Kap. 4.1), um fiktionales Erzählen (Kap. 4.2) sowie um den Begriff ’Genre’ und den Psychothriller (Kap. 4.2 und 4.3).
In einem dritten Teil wird schliesslich spezifisch auf den Serienmörder in Hollywood eingegan- gen. Dabei wird die filmische Entwicklung der Serienmörderfigur beschrieben (Kap. 5), sowie die verschiedenen Gesichter des fiktionalen Serienmörders beleuchtet (Kap 5.1). Daran an- schliessend wird die Figur des realistischen Psychopathen im fiktionalen Film erläutert (Kap. 5.2), um anschliessend auf realitätsnahe und realitätsferne Gewaltdarstellungen im Serienkiller- film eingehen zu können. Ein Exkurs zum Serienmörder als Figur narrativer Diskontinuität, be- schreibt daraufhin die Beziehung zwischen Hollywood und Serienkiller aus narrativer Sicht (Kap. 5.4). Abschliessend zu diesem Teil werden in Kapitel 5.5 Arbeitsdefinitionen formuliert, welche für die vorliegende Untersuchung gelten sollen. Eine kurze Zusammenfassung zeigt da- bei die wichtigsten Punkte auf.
Im vierten Teil der Untersuchung werden schliesslich die untersuchungsrelevanten Theorien der Figurenanalyse behandelt, mit deren Hilfe der hier zu analysierende Serienmörder untersucht werden soll (Kap. 6). So wird zunächst das aufgebaute Personenwissen im Film behandelt, sowie die Unterscheidung zwischen spezifischen Funktionsrollen und sozialen Handlungsrollen erläu- tert (Kap. 6.1 und 6.2). Anschliessend folgen Ausführungen zu individualisierten Figuren (Kap. 6.3), sowie zur Backstory und Backstorywound (Kap. 6.4). Letzteres Kapitel stützt sich dabei auf Krützens Erläuterungen. Daraufhin wird auf die Charakterentwicklung eingegangen (Kap. 6.5). Dazu gehört auch die Unterscheidung zwischen stabilen Persönlichkeitsmerkmalen und vorüber- gehenden Gemütslagen (Kap. 6.6). Eine Zusammenfassung schliesst dieses Kapitel schliesslich ab (Kap. 6.7).
Der darauf folgende empirische Teil (V) führt schliesslich in die Untersuchung ein. Zunächst werden die Untersuchungsziele beschrieben (Kap. 7), um anschliessend die untersuchungsrele- vanten Theorien, wie sie im vierten Teil der Arbeit erläutert wurden in den Kontext der Untersu- chung zu bringen (Kap. 8). Daraufhin werden die Forschungsfragen aufgezeigt (Kap. 9) und die hier verwendete Methode der Filmanalyse genauer erläutert (Kap. 10). Im Kapitel Operationali- sierung und Forschungsdesign (Kap. 11) wird daraufhin die Stichprobe erläutert, sowie die defi- nitive Filmauswahl und der Untersuchungszeitraum festgelegt (Kap. 11.1 und 11.2). Daran an- schliessend beginnt die eigentliche Untersuchung. So wird jeder Film aus der definitiven Film- auswahl zunächst einzeln auf die relevanten figurenanalytischen Aspekte Darstellung und Figu- renentwicklung hin analysiert (Kap. 12 bis 12.1.5), wobei die Charaktermerkmale jeweils in ei- ner Tabelle zusammengefasst werden. Diese Tabellen werden schliesslich zusammengeführt, um eine Gegenüberstellung der Figuren zu erhalten (Kap. 12.2). Die darauf folgenden Kapitel 12.2.1 und 12.2.2 widmen sich schliesslich der Modifizierung dieser Merkmaltabellen. Daraus entsteht schliesslich ein Kategoriensystem mit beschreibenden Kategorien, mit dessen Hilfe die Serien- mörderfiguren miteinander verglichen werden können (Kap. 13). Dabei werden sowohl Gemein- samkeiten als auch Unterschiede in Bezug auf die hier relevanten Forschungsfragen erläutert (Kap. 13.1 und 13.2). In Kapitel 14 werden schliesslich die gewonnenen Erkenntnisse aufgezeigt und diskutiert, um anschliessend in Kapitel 14.5 die Forschungsfragen zu beantworten. Eine Zu- sammenfassung der gesamten Untersuchung bringt daraufhin die wichtigsten Aspekte noch ein- mal auf den Punkt, bevor ein Schlusswort und ein Ausblick (Kap. 15) die Untersuchung abschliessen.
I Einführung: Serienmörder in der US-Realität
Aufgrund des US-amerikanischen Fokus’ stützen sich die folgenden Ausführungen auf Definitionsansätze des Federal Bureau of Investigation (FBI)5. So folgt zunächst eine Einführung in die Thematik des Serienmords und die damit verbundene Rolle des FBI. Anschliessend wird auf Serienmörder-Definitionen, sowie Serienmörder-Typologien nach FBI-Massstäben eingegangen. Daneben wird zudem der Begriff ’psychopathischer Serienmörder’ erläutert.
3 Serienmord und FBI
Einer weit verbreiteten Ansicht zufolge geht der Begriff ’Serienmörder’ auf den US- amerikanischen FBI-Agenten Robert K. Ressler zurück. Demzufolge begann Ressler in seinen Seminaren und auf Konferenzen den Begriff 'Serienmörder' zu verwenden, weil er die bis dahin übliche Definition 'Morde an Unbekannten' als unzureichend betrachtete6 - bis Anfang der acht- ziger Jahre wurden sämtliche Mehrfachmörder unter der Einheitsbezeichnung 'Massenmörder' eingeordnet.7 1983 rückte das Konzept des 'seriellen Tötens' nach einer Medienkonferenz zum Thema Serienmord erstmals als solches in den Blickpunkt der amerikanischen Gesellschaft und brachte eine Definition hervor, wonach Serienmörder nicht aus Gründen der Habgier, des Kamp- fes, der Eifersucht oder aufgrund von familiären Streitigkeiten töten. Obwohl an dieser Medien- konferenz nicht explizit auf die sexuelle Dimension des Serienmordes hingewiesen wurde, so wurde der Sexualmord nachfolgend zu einem Medienphänomen und mit dem Serienmord als solchem gleichgesetzt.8 Diese öffentliche Konzentration auf den Sexualmord führte, gemäss Simpson, dazu, dass andere Formen der seriellen Tötung grösstenteils ausgeklammert wurden. Dieses verzerrte Bild und die plötzliche, starke Beachtung dieses Themas durch die Medien ver- ursachten in der Folge eine Angststeigerung, ja sogar eine Serienkillerpanik, in der amerikani- schen Öffentlichkeit. „The key concepts were that serial murder was an ’epidemic’ in contempo- rary America“9, wie Kappeler et al. festhalten. Dadurch wurde die Bevölkerung empfänglicher für die Idee, dass eine massive bundesstaatliche Beteiligung an der Bekämpfung von Serien- mord die einzige Möglichkeit zur Lösung dieses Problems war. Diese Herangehensweise des FBI glich einem Kochrezept: „Define a crime problem in the most extreme terms possible, gene- rate a siege mentality among the American public, and then offer the FBI as the only feasible solution to the problem.“10 Schmid behauptet, dass das FBI absichtlich das öffentliche Bild über Serienmorde manipuliert habe, um so seine eigenen Ziele zu erreichen, sowohl im ideologischen Sinn (Dominanz der Perspektive), als auch im materiellen Sinn (bundesstaatliche Geldmittel zur Bekämpfung des Problems).11 Auch Kappeler et al. verweisen diesbezüglich auf die Rolle des FBI:
„[...] the 1983 work on serial murder became a justification for a new center for the study of violent crime at the FBI Academy [...] with a new Violent Criminal Apprehension Program (VICAP) [...]. In practice, the serial kil- ler panic helped to justify the new proposals, and the creation of a National Center for the Analysis of Violent Crime (NCAVC) was announced by President Reagan in June 1984, with an explicit focus on ’repeat killers’ [...]. Serial murder thus provided a wedge for an expansion of the federal role in law enforcement intelligence.“12
Die damals herrschende Serienmörder-Panik diente dem FBI folglich als Rechtfertigung in eige- ner Sache. So wurde auch bei den Opferzahlen stark übertrieben, wie Jenkins festhält: „In reali- ty, serial homicide accounts for a very small proportion of American murders, and the claims frequently made in the 1980s exaggerate the scale of victimization by a factor of at least twen- ty.”13 Diese Übertreibungen führten in der Folge auch zum Eindruck, dass Serienmorde vor- zugsweise in den USA stattfinden, „that there is a peculiarly American vulnerability to this sort of crime […].”14 Diese Folgerung ist jedoch, nach Jenkins, schwer nachzuweisen. So wird bei- spielsweise angenommen, dass Serienmörder, im Vergleich zu anderen Mördern, in den USA etwa ein bis zwei Prozent ausmachen, was nicht viel mehr ist als etwa in Grossbritannien: “The difference between the two societies is not that Americans necessarily have a greater proclivity for random irrational homicide, but that U.S. murder rates are simply far higher overall than those of any comparable developed society.”15 So steht die Chance, Opfer eines Serienmörders zu werden in den USA etwa bei 1:10’000, also bei gerade mal 0,01 % und das wiederum bedeu- tet, dass 99.99 % der Amerikaner an anderen Ursachen sterben, als dass sie Opfer eines Serien- mörders werden.16
3.1 Definition und Seriemördertypologie gemäss FBI
Der Terminus 'Serienmörder' ist heutzutage weit verbreitet. So könne man laut Robertz den Ein- druck bekommen, dass es sich um einen präzise definierten Forschungsgegenstand handle. Ein Blick auf die internationale Fachliteratur zeige jedoch erhebliche Differenzen in der Sichtweise und Definierung des Phänomens 'Serienmord'.17 Da sich die vorliegende Studie am US- amerikanischen Sektor orientiert, stützen sich die folgenden Ausführungen, wie bereits erwähnt, primär auf Definitionsansätze des FBI und dessen Klassifizierung von Serienmördern.
Bei der Definierung des Phänomens Serienmord stützt sich das FBI auf die legislative Verfas- sung, worin Serienmord als eine Serie von drei oder mehr Morden beschreiben wird, welche charakteristische Gemeinsamkeiten aufzeigen und aus diesem Grunde die Vermutung zulassen, dass die Morde von derselben Person/denselben Personen ausgeführt wurden.18 Entsprechend FBI-Definition tötet ein Serienmörder drei oder mehr Menschen in einem Zeitraum von mehr als 30 Tagen, wobei er zwischen den Morden eine „cooling-off period“19, eine so genannte Abküh- lungsphase einlegt. Diese Zeit zwischen den Morden ist ein signifikanter Faktor zur Unterschei- dung zwischen Serienmörder, Massenmörder und Spreekiller (zu Deutsch: Amokläufer). So legt weder der Massenmörder, noch der Spreekiller zwischen den Morden eine Abkühlungsphase ein, sondern begeht die Morde zu einem Zeitpunkt (Massenmörder) oder aber innerhalb eines kurzen Zeitraums (Spreekiller).20 Beide Typen interessieren sich zudem nicht für die Identität der Opfer, d.h. sie bringen jeden um, der ihnen über den Weg läuft, wobei sie in der Regel keine sexuellen Motive haben. Der Serienkiller hingegen wählt typischerweise seine Opfer aus (Z.B. nur Frauen mit blonden, langen Haaren) und hat oft sexuelle Motive. Zudem besteht zwischen Täter und Opfer in der Regel keine soziale Beziehung, deshalb wirken die Taten eines Serienmörders wie Einzeltaten.21
Sehr umstritten ist bei vielen Forschern die Frage, ob monetärer Gewinn als Motivation ein Definitionsmerkmal des Serienmörders darstellt. Das FBI selbst nimmt dieses Merkmal in die Serienmörder-Definition mit ein, unterscheidet dabei aber zwischen zwei Gewaltkategorien, na- mentlich der instrumentellen und der affektiven Kategorie. So gehören Serienmörder, welche aufgrund monetärer Einflüsse töten in die instrumentelle Gewaltkategorie, wohingegen solche, deren alleiniges Ziel der Tod des Opfers ist, in die affektive Kategorie eingereiht werden. Auch Holmes und Holmes vertreten diese Sichtweise: „Our position is that the number of victims, the motivation, and the anticipated gain (material or psychological) are all integral to the definition of a serial killer.“22 Für Jenkins wiederum gehören sowohl profit- als auch politisch orientierte Serienmorde aus der Serienmörder-Definition ausgeschlossen.23
Ungeachtet der Motivation unterscheidet das FBI bestimmte Typen des Serienmörders: „visiona- ry, mission, hedonistic, and power / control.“24 Diese Unterscheidung hilft einerseits die Denk- weise eines Serienmörders zu verstehen und andererseits bietet sie Hilfe bei der polizeilichen Ermittlung serieller Morde (Profiling). Demgemäss wird der vision äre Serienmörder (visionary) durch Stimmen oder Visionen zum Töten 'gezwungen'. Er ist mit anderen Worten geisteskrank. Dieser Serienmördertypus ist in der Minderheit, sein Anteil wird auf weniger als 5% geschätzt.25 Der missionarische Typus (mission) tötet 'schlechte' oder des Lebens 'unwürdige' Menschen, also jene, die seiner Ansicht nach den guten Menschen schaden. Der Mordzwang entsteht hier nicht durch Stimmen oder Visionen, sondern durch die moralische oder ethische Auffassung des Serienmörders selbst.
Der hedonistische Serienkiller (hedonistic) lässt sich in drei Subtypen unterteilen: den lust killer (Lustmörder), den thrill killer und den comfort killer. Die ersten beiden töten aus sexueller Motivation heraus, wobei das Leid und die Tötung der Opfer beim thrill killer im Vordergrund steht. Ihm geht es, wie das Wort impliziert, um den Nervenkitzel. Seine Taten sind, ebenso wie beim lust killer, bewusst geplant und entspringen seinem eigenen Willen, wobei letzterer ausschliesslich zur sexuellen Befriedigung tötet.26
Demgegenüber mordet der Comfort Killer für sein leibliches Wohl wie Geld, Versicherungsleis- tungen oder geschäftliche Interessen. Seine Motivation zu töten kommt dem Auftragskiller gleich.
Beim letzten Serienmörder-Typ (power/control) erhält der Mörder seine Befriedigung durch das Gefühl der absoluten Macht bzw. Kontrolle über seine Opfer. Er erfährt also eine Befriedigung und Erregung, die nicht in erster Linie den erzwungenen Sexualhandlungen oder Tötungen selbst entspringt.27 Harbort nennt diesen Typus den „sadistisch deviante[n] Serienmörder“28. Dieser quält, foltert und tötet, um seine eigenen seelischen und psychischen Deformationen zu kompen- sieren. Seine Taten werden in der Regel von bewusstseinsdominanten Allmachtsfantasien inspi- riert, beherrscht und angetrieben („zwanghaft-ritualisiertes Fantasieren“29 ). Dieser Tätertyp plant seine perversen Taten bis ins kleinste Detail und ist gemäss Harbort in der Regel alles andere als töricht.30
FBI-Forscher haben ein Konzept zur Unterscheidung der Vorgehensweise von Serienmördern entwickelt. Demgemäss differenzieren sie zwischen organisierten und desorganisierten bzw. zwischen methodisch und planlos vorgehenden Tätern. Methodisch operierende Serienmörder planen demzufolge die Morde bewusst und bereiten diese vor, während planlose Serienmörder ihre Taten eher spontan bzw. rauschhaft begehen.31
Die Opfer des organisierten Täters werden aufgrund spezifischer Merkmale ausgewählt und sind in der Regel verletz- bzw. angreifbar: „Organized offenders [...] are more likely to select vulnerable victims to increase the probability of being successful and to avoid detection.“32 Der Mörder bringt dabei die Tatwerkzeuge selber mit und entfernt diese nach der Tat wieder. Die Leichen der Opfer werden an einen anderen, meist vorher erkundeten Ort transportiert und versteckt. In der Regel lässt die Tötungsart sadistische, langsame Foltermethoden erkennen. Bourgoin nennt diesen Typ Serienmörder den „wohlorganisierten Psychopathen“33. Er ist die bedeutendste und gefährlichste Kategorie unter den Serienkillern, da er zurechnungsfähig und in der Regel sehr intelligent ist.34 Gemäss Bourgoin wurden von mehreren hundert Serienmördern, die seit Beginn des Jahrhunderts verurteilt worden sind, weniger als zwanzig für unzurechnungsfähig oder gerichtlich für Geisteskrank erklärt.35
Tatorte planloser Serienmörder spiegeln eine spontane, explosive Gewalttat wider. Die Opfer werden willkürlich ausgesucht und meist schnell und brutal ermordet. Anschliessend werden sexuelle Handlungen und/oder Verstümmelungen an den bereits toten Opfern vorgenommen. In der Regel dienen zufällig vorhandene Gegenstände dem Mörder als Tatwaffen, welche nach dem Tötungsakt achtlos liegengelassen werden. Die Opfer werden im Tatverlauf körperlich extrem entstellt und häufig durch Zerstörung oder Verdeckung des Gesichtes der Persönlichkeit beraubt. Die Leichen werden sichtbar am Tatort liegengelassen.
Nach Annahme der Autoren Holmes und Holmes spiegeln diese unterschiedlichen Verhaltens- weisen einen meist ebenso gegensätzlich ausgeprägten Persönlichkeitscharakter wider. So hat der methodisch operierende Serienmörder in der Regel einen überdurchschnittlichen Intelligenz- quotienten und verhält sich typischerweise kompetent, sowohl in sozialen, als auch in sexuellen oder beruflichen Kontexten. Dies bestätigt auch das FBI-Law Enforcement Bulletin, welches seit 1996 einmal monatlich erscheint:
„The more organization demonstrated by an offender, the more likely the offender will be intelligent, socially competent, capable of skilled employment, evidence conscious, controlled, and able to avoid identification [...]. They lack feelings of guilt or remorse and view their victims as mere objects that they can manipulate for their own perverse satisfaction and sense of power, control, mastery, and domination.“36
Im Regelfall geht seinen Taten ein situativer Stressauslöser und Alkoholkonsum voraus. Der methodisch agierende Serienmörder ist aggressiv und durchlebt seine Morde nach den Taten in seiner Vorstellung immer wieder neu (vgl. dazu den Begriff 'zwanghaft-ritualisiertes Fantasieren' von Harbort, S. 12). Oft nimmt er auch Gegenstände oder Körperteile seiner Opfer mit und ver- folgt die Medienberichterstattungen, sowie die polizeilichen Ermittlungen seiner Taten.37 Demgegenüber ist der desorganisierte Serienmörder für gewöhnlich von durchschnittlicher bis unterdurchschnittlicher Intelligenz und verhält sich auf sozialer, sexueller und beruflicher Ebene unsicher und inkompetent. Er lebt häufig alleine oder mit einer Person zusammen, welche für ihn elterliche Funktionen erfüllt und hat noch keine sexuellen Erfahrungen gesammelt. Die Durch- führung seiner Taten ist gekennzeichnet durch geistige Verwirrung und wahnhafte Vorstellun- gen. Er leidet unter Minderwertigkeitskomplexen (oft aufgrund körperlicher Merkmale) und un- ter seinem gesellschaftlich niedrigen Status.38
Die Serienmörder-Typologie des FBI zeigt die Unterschiede zwischen einem methodischen und einem desorganisierten Täter im Überblick auf:
TAB. 1: METHODISCHER VS. DESORGANISIERTER TÄTER39
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tatsächlich handelt es sich bei dieser Tabelle um eine idealtypische Unterscheidung. In der Pra- xis können sich durchaus Merkmale methodischen und planlosen Vorgehens vermischen. So kann sich ein Serienmörder in einen Amokläufer (Spreekiller) verwandeln, wenn er merkt, dass die Polizei herausgefunden hat, wer er ist und ihn verfolgt. Dem Serienmörder wird dann klar, dass man ihn bald fasst, und so wird die bevorstehende Konfrontation mit der Polizei ein Ele- ment seiner Verbrechen. Aus diesem Grunde ist es in der Realität nicht möglich, Serienmorde verlässlich und systematisch in methodische oder planlose Taten zu differenzieren. Laut Bour- goin stimmen die psychologischen Profile der verhafteten Mörder aber zu 77% mit jenen über- ein, die vor ihrer Verhaftung erstellt wurden.40
Ungeachtet der Unterscheidungskategorien von Serienmörder-Typen gibt es gemeinsame Variablen, welche die meisten Serienmörder auszeichnen, entgegen den verschiedenen möglichen Handlungsauslösern:
Serienmörder sind für gewöhnlich von weisser Hautfarbe und zwischen 25 und 34 Jahre alt. Sie sind in der Regel intelligent, charismatisch und die meisten von ihnen sind psychopathisch. Wie bereits erwähnt, fokussieren die meisten Serienkiller einen bestimmten Opfertyp. So wählte bei- spielsweise der Serienmörder Ted Bundy41 ausschliesslich junge Frauen mit dunklen Haaren und einem Mittelscheitel. Oft bedient sich der Serienmörder zudem einer List, um an seine Opfer heranzukommen. Ted Bundy trug häufig einen Gips am Arm, um Sympathie zu erwerben und um Hilfe zu bitten. Wurde in den 80er Jahren noch davon ausgegangen, dass Serienmörder in der Regel umherwandern, so wird dieser Mobilitätsfaktor heute in Frage gestellt, wie Jenkins fest- hält:
„Serial killers do not generally ’roam’. This was an issue of moment in the 1980s when it was alleged that the typical killer wandered freely across the county, killing in ten or twety states […]. However, such offenders were and are a small minority, and the majority of killers tend to operate within one city or even one neighbourhood […].”42
Ihre Opfer ermorden Serienmörder grundsätzlich mit Handwaffen wie Messer oder blossen Fäusten wobei sie stets physischen Kontakt mit ihren Opfern haben. Sind ihre Morde Anfangs noch bis ins Einzelne geplant, so töten sie gegen Ende ihrer Mordkarriere eher in Panik, wobei manche mehr als eine Person in kürzester Zeit umbringen. Hier ist wieder der Fall von Ted Bun- dy beispielhaft. Als die Polizei ihm auf den Fersen war, griff er in weniger als zwei Stunden fünf junge Frauen auf brutalste Art und Weise an. „Normally, the serial killer waits, stalks, kills, waits, stalks, kills“43, wie Anne Rule bemerkt. Gegen Ende seiner mörderischen Laufbahn aber vergeht immer weniger Zeit zwischen dem Warten und dem Töten, weil der Serienmörder merkt, dass ihm die Polizei auf die Schliche gekommen ist. Eine weitere Charakteristik des Serienmör- ders ist, dass die meisten von ihnen unehelich geboren und als Kinder physisch, sexuell oder psychisch missbraucht wurden. Diese Serienkiller tendieren zu Alkohol und Drogensucht, was ihre sadistischen Fantasien zusätzlich verschlimmert. Viele leben ausserdem mit einer nichts ahnenden Partnerin zusammen, wobei die Beziehung oft durch Fesselspiele oder andere sadisti- sche Handlungen gekennzeichnet ist.44 Ted Bundy etwa verlangte von seiner Partnerin, sich während des Geschlechtsverkehrs tot zu stellen.
3.2 Der psychopathische Serienmörder
In der Psychologie des Serienmordes wird zwischen zwei Personenkreisen differenziert: dem psychotischen und dem psychopathischen Serienmörder. Der psychotische Serienmörder ist „der paranoide Geisteskranke, der auch schizophren sein kann“45, wohingegen der psychopathische Serienmörder verhaltensgestört ist und eine asoziale Persönlichkeit hat. Er ist in der Regel sehr intelligent, gewissenlos und gefühlskalt, wobei er in der Lage ist, „Gefühle vorzutäuschen, die er nicht empfindet.“46
II Der fiktionale Film
Um spezifisch auf den fiktionalen Serienmörder eingehen zu können, muss zunächst der Film als erzählendes Konstrukt betrachtet werden, was auch das fiktionale Erzählen beinhalten, sowie den Begriff des Genres. Daneben wird zudem der Psychothriller genauer beschrieben, da sich dieses Genre auf die hier zu untersuchenden Filme bezieht.
4 Der Film als narrativer Text
Der Film ist ein narrativer Text. Deshalb basiert er ebenso wie ein Buch oder ein Gespräch auf der Erzähltheorie. Erzähltheorie, auch Narratologie genannt, ist die Wissenschaft des Erzählens und befasst sich generell mit der Analyse erzählender Texte. Dabei wird zwischen faktualem und fiktionalem Erzählen unterschieden, sowie zwischen alltäglicher und dichterischer Rede, also der „Redesituation in der eine Erzählung erfolgt.“47 Massgeblich beeinflusst wurde die Erzähltheorie vor allem durch Vladimir Propps Untersuchung russischer Volksmärchen im Jahre 1928. Propp fand damals heraus, dass sämtliche Erzählungen mit denselben Grundbausteinen konstruiert sind, unabhängig von ihrem Inhalt. Heutzutage spielt die Narratologie in vielen verschiedenen Bereichen eine wichtige Rolle, wie etwa in den Filmwissenschaften. So definierte beispielsweise Seymour Chatman bereits 1980 in Story and Discourse den Film als narrative Gattung und die Erzählung als eine Zusammensetzung aus Geschichte (Was) und Diskurs (Wie).
Die Geschichte bzw. der Inhalt besteht demnach aus einer Kette von Ereignissen (Events), wel- che Handlungen (Actions) und Geschehnisse (Happenings) in sich vereint, sowie deren Substan- zen (Existents) im Sinne von Charakteren und Kulissen (Characters, Items of setting).
Der Diskurs (Discourse) wiederum ist das Mittel, durch welchen dieser Inhalt kommuniziert wird. Grafisch lässt sich dies wie folgt darstellen:48
ABB. 1: ERZÄHLTHEORETISCHE ELEMENTE NACH CHATMAN
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Um einen narrativen Text analysieren zu können, sei dies nun ein Film, ein Buch oder ein Ge- spräch, muss, neben seinen Elementen, auch dessen „kommunikative Absicht“49 mit einbezogen werden. So kann beispielsweise ein Film dokumentarischen oder fiktionalen Charakter haben und damit unterschiedliche Absichtserklärungen beinhalten. Da in der vorliegenden Arbeit aus- schliesslich fiktionale Kinofilme untersucht werden, wird im Folgenden auf das fiktionale Erzäh- len eingegangen.
4.1 Fiktionales Erzählen
Wie oben bereits erwähnt, wird in der Narratologie zwischen faktualem und fiktionalem Erzäh- len unterschieden. Während faktuale Erzählungen den Leser, Hörer und Zuschauer „zum ge- meinsamen Nachvollziehen bzw. Wahr-Nehmen [auffordern]“50, laden fiktionale Filme zum „Mit-Imaginieren“51 ein. So werden dem Zuschauer nicht etwa fertig zusammengesetzte Ge- schichten serviert, sondern „Bausätze und Imaginationsangebote, [welche] erst einmal mit eige- nen Versatzstücken aus Fantasie und kontextuellem Wissen, aus emotionalen Implikationen und Sinngebungen [angereichert] und ergänz[t] [werden müssen bzw. sollen].“52 Wird in einer Film- sequenz beispielsweise gezeigt, wie sich der Protagonist John anzieht und in der darauf folgen- den, wie er sich am Flughafen ein Ticket kauft, dann füllt der Zuschauer die Lücke zwischen diesen beiden Sequenzen mit plausiblen Details: John fasst seinen Koffer, verlässt das Haus und fährt zum Flughafen, sei das nun mit einem Auto, einem Taxi, einem Bus oder einer Strassen- bahn. Fiktion ist deshalb immer auf einen Empfänger angewiesen. Dieser muss „vom Fiktions- charakter des jeweiligen Textes [absehen] und für die Dauer [des Films] der Täuschung unter- lieg[en], das Erzählte sei tatsächlich geschehen.“53 Die Fiktion selbst hält sich dabei typischerweise an bereits festgelegte Maximen und Formen, wie etwa die der narrativen Genres. Nach Ganz-Blättler gehört Fiktion „zu den unterhaltenden Textsorten, denn sie stellt der sozialen Realität alternative Spielarten von Realität zur Seite, die auf Grund ihrer Kodierung als ‚Wirklichkeitsmodell’ [...] ein Stück weit Unverbindlichkeit signalisieren.“54
4.2 Das Genre
Erzählungen folgen also für gewöhnlich festgelegten Regeln und Konventionen. Auf diese Wei- se lässt sich der Film bzw. die Geschichte in ein Klassifikationsschema, d.h. in ein Genre, ein- ordnen. Bezog sich der Genrebegriff ursprünglich auf einzelne Präsentationsformen, wie das Drama, die Poetik und später auch den Roman, so ist er heute weit spezifizierter und meist in- haltsbezogen, wie Newcomb festhält: „In more recent periods, [...] genre has taken on far more specific notions of classification, often focused on content. And even more significantly, genres are defined by their conventions or repeated, expected, to-a-degree-predictable qualities.“55 Genres werden also vor allem durch ihre Konventionen oder wiederholenden, erwartenden, bis zu einem gewissen Grad vorhersehbaren Qualitäten, definiert. Dadurch lassen sich Krossmedial - von Literatur bis hin zu Film, Radio und Fernsehen - Werke, welche einem Muster folgen, wie beispielsweise der Western, die Krankenhausserie oder die Romanze, als Genre einordnen, wo- bei innerhalb dieser Kategorien weitere Klassifikationen möglich sind.56 Aufgrund ihrer partiel- len Vorhersagbarkeit bieten Genres für die Film- und Fernsehindustrie beträchtliche ökonomi- sche Gewinne, denn sie halten sich an bereits Bekanntes, an schon da Gewesenes und liefern dementsprechend einen bestehenden Pool an Anlagen und Techniken, welche immer wieder aufs Neue eingesetzt werden können. Aber nicht nur der Produzent eines Genre-Films, auch der Re- zipient desselben ahnt immer bis zu einem gewissen Grad, womit er rechnen kann, weil er die Muster der verschiedenen Genres und deren Charakteristiken kennt. Genre-Filme wecken und erfüllen somit immer eine gewisse Erwartungshaltung. Newcomb hält diesbezüglich fest: „Genre films, in fact, arouse and complicate feelings about the self and society that more serious films, because of their bias toward the unique, may rarely touch. Within film, the pleasures of originali- ty and the pleasures of familiarity are at least equally important.“57 Diese Erfolgsversprechende Mischung zwischen Vertrautheit und Einzigartigkeit macht sich vor allem Hollywood zunutze.
Es kann diesbezüglich als grösster und erfolgreichster Genre-Film-Produzent angesehen werden und hat damit auch massgeblich das Bild dessen geprägt, was in postmodernen Kulturkreisen mit dem Genrebegriff assoziiert wird. So gehört heutzutage auch der Serienmörder zu einem wieder- kehrenden Charakter in unterschiedlichen Genres, wie etwa im Horrorfilm oder Psychothriller.58 Ausgehend von The Silence of the Lambs wird im Folgenden das Genre ’Psychothriller’ genauer beschrieben.
4.3 Das Genre Psychothriller
Der Psychothriller ist zunächst ein Subgenre des Thrillers und dieser wiederum ist ein Subgenre des Kriminalfilms. Der Terminus Thriller leitet sich ab aus dem englischen to thrill, was über- setzt werden kann als „erschauern“ oder „erregen“59. Es geht hier um die Relation von Film und Rezipient, um eine Akzentuierung der Spannung (suspense) und somit um die Erzeugung von thrill, der „lustvoll erlebten Angst“60. Alfred Hitchcocks Psycho ist diesbezüglich ein Schlüssel- film. In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich vor allem der Psychothriller zu einer besonde- ren Form der Kriminalgeschichte. Der Film The Silence of the Lambs ist dafür ein Musterbei- spiel.61 Trotzdem kann der Psychothriller als Genre nicht klar definiert werden, da diese Be- zeichnung unterschiedlich verwendet wird. Golden geht in ihrem Versuch einer Begriffsdefiniti- on vom übergeordneten Genre Thriller aus und ordnet dem Psychothriller folgende Kriterien zu:
1. Der amerikanische Psychothriller konstruiert eine Täterfigur, die aufgrund eines psychisch abweichenden Verhaltens einen Normverstoss [...] ausübt.
2. Der amerikanische Psychothriller integriert keine fantastischen oder übernatürlichen Elemente, d.h. die filmische Realität funktioniert unter vergleichbaren Bedingungen wie die des Zuschauers. Das Figureninventar beinhaltet keine jenseitigen Entitäten, wie bei- spielsweise Geister, Vampire, Werwölfe oder andere Fantasiegestalten. Des weiteren bil- den die Gesellschaftssysteme des Psychothrillers keine utopischen oder futuristischen Weltmodelle samt Bewohner ab. Dadurch entsteht für den Rezipienten ein Effekt der Wiedererkennung und ein Orientierungsvermögen innerhalb der abgebildeten Handlung.
3. Der amerikanische Psychothriller grenzt innerhalb der Handlung das Motiv des organi- sierten Verbrechens oder der Mafia-Thematik sowie den Bereich der Agentenfilme aus. Die Täterfigur im Psychothriller ist im Gegensatz zu derartigen Filmen nicht in eine übergeordnete Organisation einbezogen. Statt dessen stehen eigene Interessen im Vordergrund der Gewalthandlung [...].62
Mit Hilfe dieser Kriterien lassen sich die Filme der vorliegenden Untersuchung klar bestimmen und eingrenzen. Bevor jedoch das Forschungsdesign und die Stichprobe erläutert werden können, müssen zunächst der fiktionale Serienmörder im amerikanischen Film, sowie die untersuchungsrelevanten, filmanalytischen Theorien behandelt werden.
III Serienmörder in Hollywood
5 Serienmörder als Filmfiguren
In den amerikanischen Horrorfilmen der 20er und 30er Jahre, war der Serienmörder stets auf irgendeine Weise physisch verändert. So sieht Peter Lorre in M - Eine Stadt sucht einen Mörder bizarr genug aus, um Argwohn zu wecken und im Film Invisible man ist der Killer, wie der Titel schon sagt, einfach unsichtbar. Diese strikte Trennung der Mörder von den Opfern durch die physische Erscheinung, wurde ausschliesslich bei Serienmörderfiguren vorgenommen, nicht aber bei konventionellen Mördern. Diese waren stets menschlich und wurden häufig von gut aussehenden, berühmten Schauspielern verkörpert. Der Serienmörder selbst fristete im Film jener Zeit ein spärliches Dasein mit unspektakulären Auftritten.63
Während des Zweiten Weltkriegs taucht der Serienmörder schliesslich in billigen B-Produktionen vermehrt auf der amerikanischen Leinwand auf, da die Nachrichten über Mas- sentötungen in Europa, nach dem Kriegseintritt der USA im Jahre 1941, langsam ins amerikani- sche Bewusstsein eindringen. So entstehen ab 1942/43 ausserordentlich viele Filme, in denen irr gewordene Kriegsheimkehrer oder auch 'Fremdlinge' europäischer Herkunft die amerikanische Umwelt in Angst und Schrecken versetzen. Während das Grauen bei einigen durch ein halbtieri- sches Wesen hervorgebracht wurde (z.B. George Waggners The Wolfman und Robert Floreys The beast with five fingers) positionierten andere den Schrecken eindeutig im Bereich der 'ganz normalen' menschlichen Vernunft (z.B. Hitchcocks Shadow of a Doubt, Robert Siodmaks Phan- tom Lady oder Charlie Chaplins M. Verdoux).64 Letztere gingen dabei vor allem mit der auf- kommenden Psychoanalyse einher und zeigten einen Killer, der den Wunsch zu morden hegte und dies nicht aufgrund physischer Veränderungen, sondern aufgrund einer psychologischen Abweichung: „The serial killer as horrific monster appears human, but a 'hidden' monstrosity radiates a kind of moral leprosy that taints all who come in contact, much like werewolves or vampires infect others with their 'disease'.“65 Diese neuen Serienkiller waren schlauer, unauffäl- liger, kontrollierter und gefährlicher als alle anderen. Sie mordeten häufig deshalb, weil es ihnen den nötigen 'Kick' gab. Es waren Menschen, für die der Mord ein fester Bestandteil ihrer eigenen Persönlichkeit darstellte, ein Mittel, sich auszudrücken und weiterzuentwickeln, ja sogar ein Mit- tel zum Stressabbau. Somit war die Figur des Psychopaten geboren. Mit dem Welterfolg von Jonathan Demmes The Silence of the Lambs im Jahre 1991 „wird die lange Zeit verpönte The- matik endgültig von den führenden Studios Hollywoods für genehm erklärt“66 und so wurde der Psychopath von diesem Moment an zu einem akzeptierten filmischen Bestandteil und gibt seit- dem nicht selten eine eindrucksvolle Erscheinung ab.67
Inzwischen hat eine regelrechte Überflutung an solchen Psychopathen-Filmen stattgefunden - man denke hier etwa an Kalifornia (1993), Natural Born Killers (1994), Se7en (1995), Copycat (1995), Nightwatch (1997), The Watcher (2000) und Taking Lives (2004) - um nur einige davon zu nennen. Diese Filme zeigen, ebenso wie The Silence of the Lambs, den Serienmörder als menschliches Wesen und folgen damit einer realistischen Figurendarstellung. Als fiktionaler Charakter weist der Serienmörder verschiedene Gesichter auf.
5.1 Die verschiedenen Gesichter des fiktionalen Serienmörders
Als fiktionaler Charakter zeigt der Serienmörder verschiedene Gesichter, viele davon innerhalb derselben Erzählung: den Künstler der Geächteten bzw. der Gesetzlosen, den hyperintelligenten Spieler, den männlichen Helden, den Visionär oder den dämonischen Folterer. Der Charakter des Künstlers der Geächteten geht mit einer fast schon obsessiven Bindung des Serienmordes zur Kunst einher. Das Verbrechen deckt sich in diesem Sinne mit dem literari- schen Romantizismus des späten 18. Jahrhunderts. Sowohl der Gesetzesbrecher als auch der tra- ditionsbrechende Künstler folgen demnach einer bestimmten Vorstellung des Individuellen, wel- ches losgelöst von gesellschaftlichen Ethiken und Werten existiert (metaphysisches Individuum).
Insofern rebellieren beide gegen verankerte Wertsysteme. Deshalb erstaunt es nicht, dass die meisten fiktionalen Serienkiller „ artist manqu é s “68 sind, frustrierte, unerfüllte Künstler ihrer eigenen gescheiterten Ambitionen.
Ein weiteres geläufiges Gesicht des fiktionalen Serienkillers ist das des Spielers (gameplayer). Dieser hat eine überdurchschnittliche, wenn nicht gar geniale Intelligenz, denn die kulturelle Konstruktion des Serienmordes, ob Fakt oder Fiktion, „often emphasizes the intellectual abilities of the killer, positing someone brighter or more cleverly manipulative than the average Ameri- can“69, wie Simpson konstatiert. So zeigt dieser überintelligente Mörder auch oft einen makabren Sinn für Humor, sowohl in Worten als auch in seinen Taten. Als dramaturgisches Mittel stellt ihn diese Intelligenz in den Dienst langwieriger und komplizierter Katz-und-Maus Spiele, in wel- chen der Serienkiller meist einen Schritt voraus ist. Dieser hohe Intellekt und die damit einher- gehende Rationalität machen den fiktionalen Serienmörder, wie Simpson sagt, „sane and there- fore capable of being incarcerated as an 'evil' transgressor in accordance with countersubversive ideological principles.“70
Der maskuline Held bzw. der kriegerische Ritter ist ein weiteres Gesicht des fiktionalen Serienmörders. Die Ritterlichkeit steht diesbezüglich für das selbsttäuschende Wesen des erobernden / verführenden Helden.
Eine vierte Physiognomie ist die des Hellsehenden, des Visionärs, der sich durch Blutopfer einen Aufstieg in eine mystische Daseinsebene erhofft. Das Ritual des Blutopfers ist dabei oft eine Mischung aus christlichem Ritual und/oder primitiver Magie.71
Des Weiteren gibt es noch den dämonischen Boten und Folterer. Dieser Serienmörder ist ein Monster im wahrsten Sinne des Wortes - ein Omen göttlicher Ungunst. Er ist die wahre Ausge- burt der Hölle in menschlicher Form. Der Serienkiller fungiert bzw. sieht sich hier als gottge- sandten Rächer, der die wahren Sünder zu bestrafen hat. Er kann auch 'gesandt' werden, um eine ganze Bevölkerung für ihre Sünden zu bestrafen bzw. zu zerstören. Er ist ein Bote der schlimmstmöglichen Form der Apokalypse, die durch Hoffnungslosigkeit gekennzeichnet ist und das nicht nur im Hinblick auf das einzelne Individuum, sondern die Gesellschaft an sich. Dem- gemäss ist nicht die Wiedergeburt das Elementare aller Dinge, sondern die Zerstörung. Die Zivi- lisation ist zum sterben bestimmt: „Destruction is the primary result, not rebirth in any redempti- ve sense.“72 Diese 'apokalyptische Ästhetik' wird im Serienkiller-Kino der 90er praktisch zum Prinzip erhoben. Wurde in früheren Serienmörderfilmen vor allem Kritik an der amerikanischen Ideologie geübt, so stand nun das Mörderspektakel im Vordergrund. Diese 'sensationalistische Agenda' ging einher mit der Bemühung, den Serienkiller möglichst als Monster zu zeigen. In diesem Sinne sind die Killer der 90er Jahre zwar 'reale' Menschen aber unmissverständlich auf ein dämonisches Anderssein angelegt, das grösstmögliche Gewalt und reaktionäre Impulse recht- fertigt: „The more popular 1990s films [...] tend to focus on individual deviancy - a demonic Other - rather than mass ideological culpability or reform“73, wie Simpson bestätigt. Eine solche Dämonisierungsstrategie verlangt nicht nur, dass die Serienkiller intelligenter sind als ihre Zeit- genossen, sondern auch, dass sie eine Gewalt an den Tag legen, die sogar abgestumpfte Kino- gänger schockiert: „[T]he serial killer spectaculars invest horror in the dehumanizingly brutal techniques of the killers.“74 Insofern haben diese Serienmörder, im Gegensatz zu vielen anderen gewalttätigen Actionhelden wie etwa Rambo, kein Interesse an einer sozialen Reform. In Wirk- lichkeit implizieren diese Filme, dass der Erfolg des Serienkillers von einer stagnierenden ameri- kanischen Kultur abhängt, die genauso bleibt, wie sie ist: „The texts portray ritual, repeat murder as the apolitical strategy that these primitives choose in order to transcend the excesses of mate- riality in the postmodern moment.“75 Was diese Filme so pessimistisch macht ist ihre Aussage, dass in jeder Seele ein solcher ’Primitivling’ vorhanden ist.
Als Gemisch mehrerer Genres, vereint Serienmörder-Fiktion in sich mindestens vier allgemeingültige strukturelle oder thematische Muster: „the neo-Gothic, the detective procedural, the 'psycho' profile, and the mytho-apocalyptic.“76
Die neo-Gotik betont dabei die Beziehung zwischen Killer und Opfer als eine Art gefährlicher Verführung, die sich durch Grenzüberschreitungen und Tabubrüche auszeichnet. Die detektivi sche Perspektive wiederum legt ihren Fokus auf den Killer, widmet sich aber mindestens genauso den Detektiven, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihn zu stoppen. Psycho profile hingegen stellt den Serienmörder ins Zentrum der Betrachtung, indem die Zuschauer entweder direkt den mörderischen point of view einnehmen, oder aber sehr nah dran sind (z.B. durch Freunde, Liebhaber, Bekanntenkreis oder Opfer). Das apokalyptische und damit letzte Muster zeigt den Serienkiller als eine Art gottgesandten dämonischen Boten, dessen Taten direkt oder indirekt das 'reinigende' Feuer der Apokalypse über eine verfehlte Welt bringen.77
Im Folgenden muss die Figur des Psychopathen genauer beleuchtet werden, um die spezifische Begriffsverwendung in der vorliegenden Studie zu bestimmen.
5.2 Hannibal Lecter und Co. - realistische Psychopathen im fiktionalen Film
„[V]or 1990 tauchten [psychopathische Serienmörder] entweder selten oder nur als Randfiguren auf [...].“78 Dies änderte sich, wie erläutert wurde, mit Jonathan Demmes The Silence of the Lambs Anfang der Neunziger. Hier rückte die Figur des psychopathischen Serienmörders in Form von Hannibal Lecter wieder ins Blickfeld und ist in der Zwischenzeit zu einem festen Be- standteil des US-amerikanischen Kinos geworden. Diese Figur zeichnet sich aus durch „Unbe- rechenbarkeit, Gefährlichkeit, Rücksichtslosigkeit [...] und das Fehlen aller Motive“79, wie Golde festhält. Diese Täterfigur übt durch ihr psychisch abnormes Verhalten, das sich in Gewaltanwen- dungen manifestiert, einen Verstoss gegen die Normen der Gesellschaft bzw. deren Mitgliedern aus. Die eigenen Interessen des Täters stehen dabei Vordergrund.80 Dr. Robert D. Hare be- schreibt den Psychopathen anhand der Definition von Psychoanalytiker Robert Lindner folgen- dermassen:
„Der Psychopath ist ein Rebell, der stur die vorherrschenden Regeln und Normen missachtet... ein Rebell ohne Ziel, ein Agitator ohne Parole, ein Revolutionär ohne Programm: in anderen Worten: Seine Rebellion zielt nur darauf ab, Ziele zu erreichen, die nur für ihn sebst wichtig sind; er ist unfähig zu Anstrengungen zum Wohle anderer. Alle seine Bestrebungen verfolgen nur, unabhängig von ihrem vorgeblichen Zweck, die sofortige Befriedigung seiner eigenen Wünsche und Bedürfnisse.“81
Wie in der Einleitung der vorliegenden Studie bereits angedeutet wurde, leiden Psychopathen an einer Persönlichkeitsstörung. Diese ist jedoch nicht mit Geisteskrankheit zu verwechseln:
„[Psychopathen] sind soziale Raubtiere, die sich mit Charme und Manipulation skrupellos ihren Weg durchs Leben pflügen [...]. Ein Gewissen und Mitgefühl für andere Menschen fehlt ihnen völlig, uns so nehmen sie sich selbstsüchtig, was sie begehren und machen, ws sie wollen. Dabei missachten sie gesellschaftliche Normen und Erwartungen ohne jegliches Schuldbewusstsein oder Reuegefühl.“82
Hares Definition verweist deutlich auf den Aspekt des normwidrigen aber bewussten Handelns, das einen Psychopathen ausmacht. So kann diese Begriffsbestimmung, aufgrund der Eingangs festgelegten Prämisse, dass in der vorliegenden Arbeit ausschliesslich fiktionale aber real darge- stellte und bewusst handelnde Serienmörder analysiert werden, im Folgenden auf die hier zu analysierende Figur angewendet werden; mit anderen Worten: Der dieser Studie zugrunde lie- gende Serienmörder ist ein Psychopath, weil er aus eigenem Willen mordet und sich seiner Ge- walthandlungen bewusst ist. Die Gewalt selbst kann dabei realitätsnah oder aber unrealistisch dargestellt werden, deshalb muss dieser Aspekt im Folgenden erläutert werden, um ihn am Ende entsprechend zu fixieren.
5.3 Realitätsnahe und realitätsferne Gewaltdarstellungen im Serienkillerfilm
Die Einordnung der Gewalt in einen fiktiven oder fiktionalen Zusammenhang ist unabdinglich, da Gewalt im Film sowohl wirklichkeitsgetreu, als auch unrealistisch dargestellt werden kann. Fiktiv meint dabei den „ Inhalt, in Bezug auf Gewaltdarstellungen also de[n] Handlungskontext [während] fiktional [...] die Darstellungsweise [der Gewalt beschreibt], also die Tatsache, dass eine Handlung inszeniert ist im Gegensatz zur Abbildung von real Vorhandenem.“83 Eine fiktio- nale Gewaltdarstellung kann dabei der Realität entsprechend gestaltet sein oder aber realitätsfer- ne Welten zeigen, die so in der Wirklichkeit nicht vorkommen können, wie etwa im Science- Fiction-Film.84 Grimm, Kirste und Weiss halten diesbezüglich fest, dass fiktive Gewalt „die in aller Regel auch fiktional ist, [meistens] Darstellungen umfasst, die so in der aussermedialen Realität nicht vorkommen würden.“85 Wichtig ist hier also auch der Kontext, in welchem die Gewaltdarstellung gezeigt wird. So kann die dargestellte Welt unserem Realitätskonzept ent- sprechen, davon abweichen oder gar auf faktische Elemente hinweisen, während die Darstel- lungsmittel fiktional oder dokumentarisch sein können. Da in der vorliegenden Studie aus- schliesslich fiktionale, realistisch dargestellte Serienmörderfiguren analysiert werden, muss auch die Gewaltdarstellung eine wirklichkeitsgetreue sein. Die Darstellungsmittel sind demgegenüber fiktional und nicht dokumentarischen Charakters. Bevor die hier geltenden Arbeitsdefinitionen definiert werden, wird in einem Exkurs zunächst die Beziehung zwischen dem fiktionalen Se- rienmörder und dem Hollywood-Film aus narrativer Sicht erläutert.
5.4 Exkurs: Der Serienmörder als Figur narrativer Diskontinuität
Unsere Sehgewohnheiten sind geprägt durch die ästhetischen Vorschriften der klassischen Hol- lywood-Ära (1907-1960). Waren frühere Filmstreifen (primitives Kino, 1895-1907) geprägt durch Momente der Diskontinuität, Zerstückelung und Unabgeschlossenheit, so lehrte uns das bürgerliche Erzählkino Hollywoods „aus einer Abfolge von montierten Einzelbildern einen vor- geschriebenen Sinn zu erkennen“86, indem durch eine geschickte und gezielte Anordnung von Einzelteilen der Eindruck von Konstanz und Zusammengehörigkeit erzeugt wurde. Der damit verbundene unsichtbare Schnitt ermöglicht es dem Zuschauer, sich mühelos im dargestellten Raum zurechtzufinden und vermittelt ihm dadurch ein Gefühl der Geborgenheit. Demgegenüber konstituieren widersprüchliche Verbindungen beim Rezipienten eine visuelle Entfremdung.
Deshalb sind die Schnittmuster Hollywoods einzig dazu angelegt, die Zuschauer zu beschwichti- gen und ihnen damit ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Filme im klassischen Stil liefern dem Auge des Rezipienten ein exakt berechnetes Repertoire von aufeinander abgestimmten Perspek- tiven. Auch die Inhalte (stories) und Erzählformen (plots) sind dabei auf eine Homogenisierung angelegt und folgen strikten ästhetischen und geometrischen Regeln. Die dramaturgischen Struk- turen des klassischen Hollywoodkinos streben nach inhaltlichem- und kausalem Zusammenhang sowie nach Abgeschlossenheit der Handlung. Dieses Schema hat auch heute noch seine Gültig- keit. Dabei beschränkt sich die Vorstellung nach einem kausalen Zusammenhang, der die Hand- lung vorantreibt, meistens auf eine Form des seelischen Beweggrunds der Charaktere. Der Zufall als erzählerischer Bestandteil wird dabei weitgehend vermieden. So kann der Rezipient die Er- eignisse nicht nur nachvollziehen, sondern oft auch vorhersehen und dies wiederum gibt ihm das beruhigende Gefühl, die Handlung zu steuern. Da narrative Diskontinuitäten den Zuschauer verwirren, wird eine abgeschlossene Erzählmethode und Lösung von der kommerziellen Filmin- dustrie bevorzugt und damit wird alles was unkontrollierbar ist aus dem Rahmen verbannt.87
Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass gerade die Figur des Serienkillers bei vielen bestrebten Filmemachern immer schon beliebt war, denn diese motivlosen und unberechenbaren Täter bringen laut Schwab
„das stabile Bildinventar einer Gesellschaft vorübergehend ins Wanken. Durch ihre Irrationalität und Unfassbar- keit markieren sie [eine] Lücke zwischen den klaren Bildern unserer aufgeklärten Gedankenwelt [...] und weisen als wiederkehrende Bildstörer ständig darauf hin, dass sich die Welt nie vollkommen entziffern und eindeutig le- sen lässt.“88
Geschichten über Serienkiller thematisieren in diesem Sinne das Potential und das Bedürfnis, anhand eines scharfsichtigen Blicks aus einem undefinierten Puzzle voller aufgefächerter und beunruhigender Einzelaufnahmen eine einheitliche und Konstante Mordreihe zu entwerfen, in welcher die Verbindungen von einer Tat zur anderen, ganz wie in einem Film, zeitlich geordnet und logisch strukturiert sind. Filmisch betrachtet sind Serienkiller deshalb „hochgradig selbstre- flexive und auch dekonstruktivistische Figuren“89, denn sie umgehen immer wieder unser Ver- langen nach systematischen und kausalen Sinnzusammenhängen, was gerade das klassische Hol- lywoodkino so sehr zu stillen versucht. Geschichten über Serienkiller eignen sich deshalb bes- tens dazu, den Wunsch nach völliger Gewissheit betont zur Schau zu stellen oder aber bewusst zu zerstören. Im übertragenen Sinne verdeutlichen sie gemäss Schwab „den Prozess des klassi- schen plottings, indem sie uns vor Augen führen, wie aus einer strukturlosen - proairetischen - Abfolge von mörderischen Aktionen (series of shocks) durch die Überlagerung eines erklärenden hermeneutischen Kodes eine lesbare Geschichte konstruiert werden kann.“90 Für Simpson verfü- gen Serienkiller im Film über eine „open-ended dialectic“91 zwischen dem Bedürfnis, dem sozia- len System zu entsprechen und dem geheimen Wunsch, sich über dessen Regeln ungestraft hin- wegzusetzen. Als Metapher bringt der Serienkiller die Grenzen zwischen Gut und Böse, Links und Rechts, Mann und Frau, Kunst und Kitsch zum Einstürzen. Was in diesen 'Ruinen' zum Vor- schein kommt, ist nicht der edle Wilde, sondern der bestialische Kannibale. Wichtig ist dabei nach Simpson, zwischen fiktionalen und realen Serienmördern zu trennen, da der Serienkiller im Film in der Regel nicht viel mit seinen realen Ebenbildern gemein hat. Im Film werden Serien- killer bezüglich ihrer Methodik und Pathologie oft exotischer dargestellt, als sie in Wirklichkeit sind, weil ihre Macher der Verführung selten widerstehen können, sie auf einzigartige Weise zu sensationalisieren:
„[...] fictional serial killers’ motives are usually more metaphysically, psychologically, and culturally grandiose or, inversely nihilistic, than those of their real-life counterparts. [...] Their character is an elyborate construct de- signed exclusively to test [...] philosophical maxims (free will versus determinism), psychological systems (usu- ally psychoanalytic), socioeconomic models (capitalism in particular), and, of course, the binary nature of good and evil itself.“92
5.5 Zusammenfassung & Arbeitsdefinitionen
Wie erläutert wurde, hat sich die Figur des fiktionalen Serienmörderes im amerikanischen Film ab 1942/43 immer mehr dem realen Menschen angenähert, bis schliesslich die Figur des psychopathischen Serienmörders zum Vorschein kam. Mit dem Welterfolg von The Silence of the Lambs wurde diese Figur in Form von Hannibal Lecter im populären Kino etabliert. Seitdem sind zahlreiche weitere Filme in dieser Manier entstanden. Die Serienmörderfiguren dieser Filme sind Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Studie. Sie müssen dabei in ihren Grundzügen der Figur Hannibal Lecter entsprechen, da diese Ausgangspunkt der späteren Figurenanalyse ist. Dementsprechend gelten hier folgende Kriterien:
Der Serienmörder ist fiktional, aber realistisch dargestellt. Er ist männlich, agiert methodisch und zeigt eine realitätsnahe Gewalt. Er ist sich seines abnormen Verhaltens bewusst und kann deshalb als Psychopath bezeichnet werden.
Daneben spielt, auch der Kontext des Films eine entscheidende Rolle. Wie in Kapitel 5.2 darge- legt wurde, kann der Film eine Welt zeigen, welche unserem Realitätskonzept entspricht, davon abweicht oder auf faktische Elemente hinweist. Die Darstsellungsmittel sind dabei entweder fiktional oder dokumentarisch. Ausgehend vom Film The Silence of the Lambs gilt für die vorliegende Untersuchung folgende Arbeitsdefinition:
Die Handlung des fiktionalen Films muss fiktionale Darstellungsmittel aufweisen und sich in einer Welt abspielen, wie sie auch in der Realität vorkommen kann.
Hier wird deutlich, dass sich die Arbeitsdefinitionen mit den zuvor festgelegten Kriterien des Psychothrillers decken, wie sie in Kap. 4.3 beschrieben wurden. An dieser Stelle muss jedoch noch eine zusätzliche Eingrenzung vorgenommen werden. Ausgehend von The Silence of the lambs, werden im Folgenden nicht nur Filme mit fantastischen Elementen ausgegrenzt, sondern auch solche, deren Handlungen in vergangenen Zeiten spielen, wie etwa im Film From Hell. Somit gilt hier folgende Arbeitsdefinition:
Die Handlung des fiktionalen Films muss sich in einer postmodernen Welt abspielen.
Nachdem nun die relevanten Arbeitsdefinitionen erläutert wurden, kann im Folgenden auf die Figurenanalyse im Film eingegangen werden.
IV Untersuchungsrelevante Theorien
In diesem Kapitel werden die, für diese Untersuchung relevanten, figurenanalytischen Aspekte behandelt. Mit Hilfe dieser Ausführungen soll der fiktionale Serienmörder analysiert werden, um schliesslich einen Vergleich zwischen den einzelnen Figuren tätigen und damit die Forschungsfragen beantworten zu können.
6 Figurenanalyse im Film
Das konkrete Erkenntnisinteresse der vorliegenden Studie richtet sich auf den männlichen, fiktionalen, real dargestellten und methodisch agierenden Serienmörder im Hollywood-Film seit The Silence of the Lambs. Deshalb liegt der Fokus im Folgenden auf der Figurenanalyse, wobei nur jene Aspekte behandelt werden, welche für die hier vorgenommene Untersuchung zu Darstellung und Entwicklung zentral sind.
Zunächst folgen Ausführungen zur Darstellung einer Figur. So wird als Erstes erläutert, wie der Rezipient etwas über die Figuren im Film erfahren kann. Anschliessend wird zwischen spezifi- schen Funktionsrollen und sozialen Handlungsrollen differenziert, um daraufhin auf individuali- sierte Figuren eingehen zu können und aufzuzeigen, aus welchen Dimensionen eine realistisch dargestellte Figur besteht und welche Kriterien dabei beachtet werden müssen. Im Anschluss daran wird auf die Begriffe Backstory und Backstorywound eingegangen, weil diese für die Figu- rendarstellung ebenfalls von Bedeutung sind. Danach folgen Ausführungen zur Charakterent- wicklung einer Figur. Dabei wird zwischen beständigen Persönlichkeitsmerkmalen und vorüber- gehenden Gemütslagen unterschieden.
6.1 Aufgebautes Personenwissen im Film
„Grundsätzlich kann das Personal von Filmen [...] als Figuren und Akteure bezeichnet werden: Sie sind Figuren in einem Spiel der Inszenierung [...], und sie sind Akteure von Handlungen, welche die Narration vorantreiben“93, wie Mikos festhält. Dabei tragen mannigfaltige Gestaltungsmittel zur Inszenierung bei. Diese reichen von Kostümen, Kleidern, Masken und Licht, bis hin zu Kameraposition und der jeweiligen Bildeinstellung. „Die Inszenierung kann bestimmte Aspekte der Figuren und bestimmte soziale Rollen in spezifischen Handlungskontexten hervorheben, die [...] von dramaturgischer Bedeutung sind.“94 So wird etwa Hannibal Lecters Gefährlichkeit in The Silence of the Lambs laut Mikos
„dadurch unterstützt, dass er aus einer leichten Untersicht mit einer bestimmten Kopfhaltung gezeigt wird: In Gross- und Nahaufnahmen hält er den Kopf leicht gesenkt und blickt unter seinen Lidern hervor. Dadurch entsteht der Eindruck von Macht und Bedrohung, die von ihm auszugehen scheint.“95
Die Nähe der Kamera zur handelnden Person kann also ebenso zu ihrer Inszenierung beitragen, wie beispielsweise deren Kleidung. Im Zentrum der vorliegenden Studie stehen jedoch weniger ästhetische und gestalterische Mittel, wie „Kamera, Licht, Schnitt/Montage, Ausstattung, Ton/Sound, Musik, visuelle Effekte und Spezialeffekte“96, als vielmehr die Figuren und Akteure selbst, also die fiktionalen, psychopathischen Serienmörder. Dabei können zwar allfällige gestalterische Mittel, wie beispielsweise die Kleidung oder wie im Falle Hannibal Lecters die Kameraposition, in die jeweilige Figurenanalyse mit einfliessen, auf eine theoretische Auseinandersetzung dieser Elemente wird jedoch im weiteren Verlauf verzichtet.
Wie eine Person im Film vom Zuschauer wahrgenommen wird hängt primär davon ab, wie viel über die Figur im Verlauf der Narration ’gesagt’ wird, d.h. der Eindruck, den das Publikum über eine Figur im Film gewinnt, hängt vom Wissen ab, welches im Verlauf des Films um die Figur herum aufgebaut wird. Prinzipiell kann der Zuschauer nur auf zwei Arten etwas über die Person im Film erfahren: durch die direkte Beobachtung ihrer Handlungen und Interaktionen oder aber durch indirekte Quellen, wie Dialoge anderer Personen, Zeitungsartikel usw.97 Im Gegensatz zu Mikos, erwähnt Faulstich diesbezüglich noch die Erz ählercharakterisierung. Hier wird die Figur durch einen unsichtbaren Erzähler aus dem Off charakterisiert (voice over).98 Ein Beispiel dafür wäre etwa der Film American Beauty, in welchem der Protagonist selbst seine Lebensgeschichte mittels voice over erzählt. Aus literaturwissenschaftlicher Sicht lässt sich das direkte und indi- rekte Charakterisieren wie folgt darstellen:
ABB. 3: DIREKTES UND INDIREKTES CHARAKTERISIEREN AUS LITERATURWISSENSCHAFTLICHER SICHT
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Teach Sam (o.J.): Lehren und Lernen Online. Direktes und indirektes Charakterisieren. URL: http://www.teachsam.de/deutsch/d_literatur/d_gat/d_epik/strukt/figu/fig_5_3_1.htm (17.04.08).
Je mehr der Zuschauer über eine Figur im Film erfährt, desto eher kann er sich auch in diese hineinversetzten und ihr Handeln nachvollziehen. Bleibt jedoch das Wissen um eine Figur in dem Sinne beschränkt, dass keinerlei Erklärung für deren Verhalten geliefert wird, wie etwa im Falle Hannibal Lecters, so bleibt diese mysteriös und undurchsichtig. Um eine Figur im Film hinreichend analysieren zu können, muss auch ihre Rolle innerhalb des Films klar definiert werden.
6.2 Spezifische Funktionsrollen und soziale Handlungsrollen
Das Publikum identifiziert die Rolle einer Figur durch kulturelle Kodes, d.h. die Figur wird vom Publikum mit den gleichen Kodes beurteilt, wie reale Menschen im Alltagsleben. Dabei ist nicht nur das aufgebaute Wissen um die handlungsleitenden Akteure entscheidend, sondern auch das vom Zuschauer herangetragene „lebensweltliche Wissen um soziale und typische Protagonistenrollen sowie [dessen] Selbst- und Identitätskonzepte [...].99
Grundsätzlich lassen sich im fiktionalen Film zwei Arten von Handlungsrollen unterschieden: Spezifische Funktionsrollen und soziale Handlungsrollen. Dementsprechend können manche Figuren einzig durch ihren Status und ihre Funktion definiert sein, wie etwa der Gefängniswärter, der Clarice Starling in The Silence of the Lambs den Durchgang zu Hannibal Lecter gewährt. Solchen eindimensional gezeichneten Figuren bleibt wenig Spielraum was die Charaktergestaltung betrifft, zentral ist hier vielmehr ihre funktionale Bestimmung, die sich aus deren Status und Funktion innerhalb des Films ergibt. Nichtsdestotrotz können solche spezifischen Funktionsrollen im Verlauf des Films in soziale Handlungsrollen überführt werden. Meist bleiben aber solche spezifischen Funktionsrollen Randfiguren vorbehalten.
Protagonistenrollen wiederum sind in der Regel durch Status und Funktion, als auch und vor allem über die Handlung selbst definiert. Protagonisten sind dreidimensionale, individualisierte Figuren mit einer Fülle von charakterisierenden Details, welche sie zu einmaligen, unverwech- selbaren Personen machen. Zudem sind sie wandlungsfähig und haben eine Vergangenheit.100 Indem Protagonisten ihre Handlungsrolle ausüben, treiben sie die Erzählung voran. Dabei kön- nen sie ihre Handlungsrolle, je nach Thema der erzählten Situation ändern. Mikos spricht dies- bezüglich von einer „Hierarchie von Handlungsrollen“101. So nimmt der Detektiv zwar primär die Handlungsrolle ’Detektiv’ ein, wird aber gleichzeitig auch in zahlreichen anderen Rollen gezeigt, wie etwa „als Kunde, Kneipenbesucher oder Fahrgast eines Taxis. Diese Rollen sind der des Detektivs nachgeordnet, tragen aber zu deren Glaubwürdigkeit bei“102, wie Mikos festhält. Ebenso wie reale Personen, handeln somit auch fiktive Personen eines Filmtextes in verschiede- nen sozialen Rollen in bestimmten Interaktionssituationen. Dementsprechend „[vereinen sich] in den Handlungsrollen [...] Statusposition, individuelle Charaktermerkmale, sowie die auf die Handlung bezogene Biografie der Protagonisten.“103 Nur wenn all diese Aspekte bei der Figu- renkonstruktion beachtet werden, können glaubwürdige, individualisierte Personen entstehen. Da in der vorliegenden Studie ausschliesslich fiktionale, aber realistische Serienmörderfiguren auf ihre Darstellung hin untersucht werden, muss im Folgenden von realen Menschen ausgegangen werden. Deshalb wird nun die dreidimensionale Figur genauer beschrieben.
6.3 Individualisierte Figuren
„Eine Idee reicht nie für eine gute Story, eine starke Figur dagegen schon.“104 Lajos Egris Zitat verdeutlicht, wie wichtig Charakterporträts sind, denn jedes literarische Werk steht und fällt mit der Glaubwürdigkeit seiner Figuren. So muss etwa ein Film nicht zwingend durch eine aussergewöhnliche Handlung bestechen. Das was den Film ausmacht ist nicht primär die Geschichte, sondern vielmehr die in ihr enthaltenen Charaktere, denn sie sind das Basismaterial eines jeden Werkes. Nach Chatman ist Charakterisierung:
„The depicting, in writing, of clear images of a person, his actions and manners of thought and life. A man’s na- ture, enviroment, habits, emotions, desires, instincts: all these go to make people what they are, and the skillful writer makes his important people clear to us through a portrayal of these elements.“105
Um also einen glaubwürdigen, starken Charakter konstruieren zu können, muss der Autor wis- sen, warum sich seine Figuren so verhalten, wie sie sich verhalten. Er muss ihre Einstellungen zum Leben kennen, sowie ihre Gefühle, Wünsche und Gewohnheiten. Der Autor muss also mit anderen Worten, von lebensechten Menschen ausgehen und all diese Aspekte, die einen ’echten’ Menschen ausmachen, in seine Figur einfliessen lassen. Wichtig ist dabei, dass sich der Protago- nist von anderen Personen im Film unterscheidet und dazu gilt es nach Egri folgende Fragen zu beantworten:
- Wer sind diese Menschen?
- Woher kommen sie?
- Wie war ihre Kindheit?
- Was sind ihre Lebensumstände?
- Welche Pläne, Träume und Hoffnungen haben sie?
- Wonach streben sie?
- Welche Enttäuschungen haben sie hinter sich?
- Welche Komplexe haben sie?106
Demzufolge setzt sich jede individualisierte Figur aus drei Dimensionen zusammen: der physi- schen, der soziologischen und der seelisch-geistigen Dimension: Die physische Dimension ist die erkennbarste und einfachste. Sie bezieht sich auf das Aussehen und den Gesundheitszustand ei- ner Figur, was sowohl auf die Figur selbst, als auch auf den Betrachter einen erheblichen Ein- fluss hat. Durch die Physis einer Figur zeigt sich, ob diese mit ihrem Aussehen zufrieden ist, ob sie unter Minderwertigkeitskomplexen leidet oder von anderen bewundert wird, ob sie abwei- send, überheblich oder tolerant ist und welche Ansprüche sie hat.
[...]
2 Thomas, Alexandra: Serienmord als Gegenstand der Kulturwissenschaften. Ein Streifzug durch das Reich der Zeichen, Mythen und Diskurse. In: Frank J. Robertz/Alexandra Thomas (Hrsg.): Serienmord. Kriminologische und kulturwissenschaftliche Skizzierungen eines ungeheuerlichen Phänomens. München 2004, S. 253-281, hier S. 253.
3 Schwab, Angelica: Serienkiller in Wirklichkeit und Film. Störenfriede oder Stabilisator? Eine sozioästhetische Untersuchung (Nordamerikastudien. Münchner Beiträge zur Kultur und Gesellschaft der USA, Kanadas und der Karibik, Bd. 1). Hamburg/London 1998, S. 70.
4 Vgl. Fremdwörterduden. Office-Bibliothek. Elektronische Version 4. 10. Graz 2006. 1
5 Anmerkung: Das Federal Bureau of Investigation (FBI) wurde 1908 während der Präsidentschaft Theodore Roose- velts gegründet und beschäftigt heute über 30'800 Mitarbeiter weltweit. Das FBI ist der investigative Arm des US- amerikanischen Justizdepartements, wobei die offizielle Bezeichnung FBI erst seit 1935 ihre Gültigkeit hat. Das FBI ermittelt in Sachen Terrorismus, Spionageabwehr, Internetmissbrauch, Korruption, öffentliches Recht, organisiertes Verbrechen, Wirtschaftskriminalität, schwerer Diebstahl und Gewaltverbrechen (vgl. dazu: Federal Bureau of Inves- tigation (o.J.): URL: http://www.fbi.gov/ ).
6 Vgl. Robertz, Frank J.: Serienmord als Gegenstand der Kriminologie. Grundlagen einer Spurensuche auf den We- gen mörderischer Phantasien. In: Robertz, Frank J./Thomas, Alexandra (Hrsg.): Serienmord. Kriminologische und kulturwissenschaftliche Skizzierungen eines ungeheuerlichen Phänomens. München 2004, S. 15-50, hier S. 16f.
7 Vgl. Bourgoin, Stéphane: Serienmörder. Pathologie und Soziologie einer Tötungsart. Reinbek bei Hamburg 1995, S. 13.
8 Vgl. Ebd., S. 78.
9 Kappeler, Victor E./Blumberg, Mark/ Potter, Gary W.: The mythology of crime and criminal justice. 2. Ed. Illinois 1996, S. 70.
10 Kappeler et. al. 1996, S. 79.
11 Vgl. Schmid, David: Natural Born Celebrities. Serial Killers in American Culture. Chicago 2006, S. 80.
12 Kappeler et al. 1996, S. 79. Vgl. dazu auch Schmid 2006, S. 85f.
13 Jenkins, Philip: Using Murder. The social construction of serial homicide. New York 1994, S. 22.
14 Ebd., S. 41.
15 Ebd.
16 Vgl. Ebd., S. 46.
17 Vgl. Robertz 2004, S. 16f.
18 Brantley, Alan C./Kosky, Robert A., Jr. (2005): Serial Murder in the Netherlands. A look at Motivation, Behavi- our, and Characteristics. Definition Difficulties. In: FBI Law Enforcement Bulletin. Vol. 47, No. 1. Washington DC 2005. URL: http://www.fbi.gov/publications/leb/2005/jan2005/jan2005.htm (15.05.08).
19 Holmes, Roland M./Holmes, Stephen T.: Contemporary perspectives on serial murder. Thousand Oaks 1998, S. 1.
20 Vgl. Ebd., S. 1 und Bourgoin 1995, S. 14.
21 Vgl. Bourgoin 1995, S. 6. und Robertz 2004, S. 17.
22 Holmes/Holmes 1998, S. 2.
23 Vgl. Jenkins 1994, S. 23.
24 Holmes/Holmes 1998, S. 2.
25 Vgl. Ebd. und Bourgoin 1995, S. 20.
26 Vgl. Cameron, Deborah/Frazer, Elizabeth: Lust am Töten. Eine feministische Analyse von Sexualmorden. Berlin 1990, S. 47.
27 Vgl. Holmes/Holmes 1998, S. 3; Hervorhebungen durch den Verfasser. Vgl. dazu auch Robertz 2004, S. 23; Hervorhebungen im Original.
28 Harbort, Stephan: Mörderisches Profil. Phänomen Serienkiller. Leipzig 2002, S. 147. 8
29 Harbort 2002, S. 146.
30 Ebd.
31 Ebd., S. 257.
32 FBI Law Enforcement Bulletin (2005). Vol. 74. No. 1. URL: http://www.fbi.gov/publications/leb/2005/jan2005/jan2005.htm (15.05.08).
33 Bourgoin 1995, S. 23.
34 Vgl. Ebd., S. 32.
35 Vgl. Ebd., S. 23 und 41; Hervorhebungen durch den Verfasser. 9
36 Brantley/Kosky 2005.
37 Vgl. Harbort 2002, S. 146.
38 Vgl. Robertz 2004, S. 21.
39 Vgl. Bourgoin 1995, S. 38f.
40 Vgl. Ebd., S. 38.
41 Anmerkungen: Ted Bundy wurde im November 1946 in Philadelphia als Theodore Robert Cowell geboren. Er studierte Jura und Psychologie und interessierte sich für die Politik. Er galt als charmant, intelligent und redegewandt. 1976 wurde Bundy wegen Mordes angeklagt, doch ihm gelang die Flucht aus dem Gefängnis. Erst zwei Jahre später wurde Ted Bundy erneut verhaftet. Im Januar 1980 wurde er des Mordes für schuldig gesprochen und zweifach zum Tode verurteilt. 1989 wurde er auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Ted Bundy hat mindestens 30 Frauen ermordet und gilt als einer der schlimmsten Serienmörder in der Geschichte (vgl. Newton, Michael: Die grosse Enzyklopädie der Serienmörder. 2. Aufl. Graz 2002, S. 48-53).
42 Jenkins 1994, S. 45.
43 Rule, Ann: The Stranger Beside Me. Ted Bundy. The shocking inside story. New York 1980, S. 27.
44 Vgl. Holmes/Holmes 1998, S. 14f.
45 Bourgoin 1995, S. 31.
46 Ebd., S. 32.
47 Martinez, Matias/Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie. 3. Aufl. München 2002, S. 10. 13
48 Chatman, Seymour: Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Cornell 1980, S. 19.
49 Ganz-Blättler, Ursula: Die (Fernseh-)Fiktion als Gemeinschaftswerk(en) und kulturelle Teilhabe. In: Hepp, Andreas/Winter, Rainer (Hrsg.): Kultur - Medien - Macht. Cultural Studies und Medienanalyse. 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2006, S. 284 - 298, hier S. 285.
50 Ebd.
51 Ebd.
52 Ebd.
53 Martinez/Scheffel 2002, S. 21.
54 Ganz-Blättler 2006, S. 290f.
55 Newcomb Horace: Narrative and Genre 2004, S. 423 URL: http://www.sagepub.co.uk/mcquail5/downloads/Handbookchaps/ch20%20Downing%20HB.pdf (13.02.08).
56 Vgl. Ebd.
57 Ebd., S. 424.
58 Vgl. Hickethier, Knut: Das Genre des Kriminalfilms. Balance zwischen Verbrechensfaszination und Ordnungssicherung. In: Hickethier, Knut (Hrsg.): Kriminalfilm. Stuttgart 2005, S. 19-21 (Reclam Filmgenres).
59 Anmerkung: Die Übersetzung basiert auf Langenscheidts Universalwörterbuch ’Englisch’.
60 Hickethier 2005, S. 23.
61 Vgl. Ebd.
62 Golde, Inga: Der Blick in den Psychopathen. Struktur und Wandel im Hollywood-Psychothriller. Kiel 2002, S. 19.
63 Cettl, Robert: Serial Killer Cinema. An Analytical Filmography with an Introduction. North Carolina 2003, S. 4- 7.
64 Vgl. Schwab, Angelica: Serienkiller in Wirklichkeit und Film. Störenfriede oder Stabilisator? Eine sozioästhetische Untersuchung (Nordamerikastudien. Münchner Beiträge zur Kultur und Gesellschaft der USA, Kanadas und der Karibik, Bd. 1). Hamburg/London 1998, S. 70.
65 Simpson, Philip L.: Psycho Paths. Tracking the serial killer through contemporary film and fiction. Southern Illinois 2000, S. 10.
66 Schwab 1998, S. 70.
67 Vgl. Cettl 2003, S. 3-14.
68 Cettl 2003, S. 9.
69 Simpson 2000, S. 23.
70 Ebd.
71 Ebd.
72 Ebd., S. 177.
73 Simpson 2000, S. 174.
74 Ebd., S. 175.
75 Ebd.
76 Ebd., S. 25.
77 Vgl. Ebd., S. 23-25; Hervorhebungen durch den Verfasser. 20
78 Werner, Paul: Film noir und Neo-Noir. München 2005, S. 163.
79 Golde 2002, S. 12.
80 Vgl. Ebd., S. 19.
81 Hare, Robert D.: Gewissenlos. Die Psychopathen unter uns. Wien/New York 2005, S. 71.
82 Ebd., S. xi.
83 Grimm, Petra/Kirste, Katja/Weiss, Jutta: Gewalt zwischen Fakten und Fiktionen. Eine Untersuchung von Gewaltdarstellungen im Fernsehen unter besonderer Berücksichtigung ihres Realitäts- bzw. Fiktionalitäts-grades. (Schriftenreihe der NLM, Bd. 18). Berlin 2005, S. 59.
84 Vgl. Ebd.
85 Ebd.
86 Ebd., S. 98.
87 Vgl. Schwab 1998, S. 98-116; Hervorhebungen im Original.
88 Ebd., S. 115f.
89 Ebd.
90 Schwab 1998, S. 119; Hervorhebungen im Original.
91 Simpson 2000, S. 18.
92 Ebd., S. 21.
93 Mikos 2008, S. 166.
94 Ebd.
95 Mikos 2008, S. 167.
96 Ebd., S. 192.
97 Vgl. Ebd., S. 169.
98 Vgl. Faulstich, Werner: Grundkurs Filmanalyse. München 2002, S. 99. Hervorhebungen im Original. 27
99 Vgl. Platz-Waury, Elke: Drama und Theater. Eine Einführung (Literaturwissenschaft im Grundstudium). 5. Aufl., Tübingen 1999, S. 88-96.
100 Vgl. Ebd., S. 76 - 81.
101 Ebd., S. 171
102 Ebd.
103 Ebd.
104 Egri, Lajos: Literarisches Schreiben. Starke Charaktere, originelle Ideen, überzeugende Handlung. Deutsche Erstausgabe. Berlin 2002, S. 89.
105 Chatman 1980, S. 107.
106 Egri 2002, S. 190.
- Arbeit zitieren
- Helena Stamatovic (Autor:in), 2008, Psychopathen im Hollywoodkino, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191461
Kostenlos Autor werden
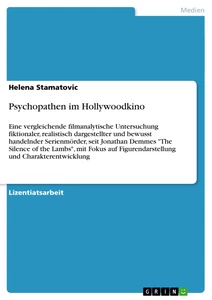









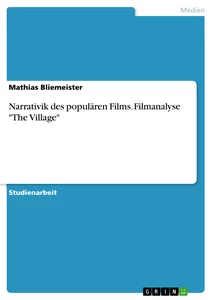
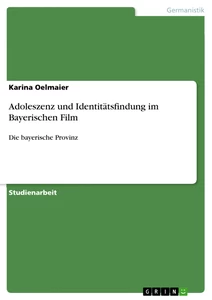
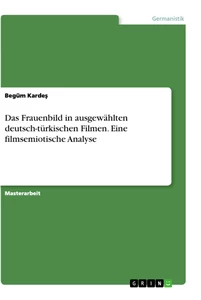
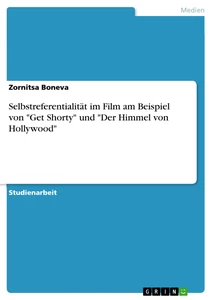

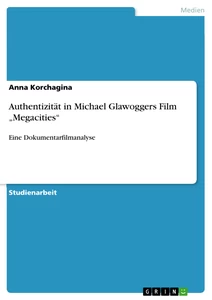



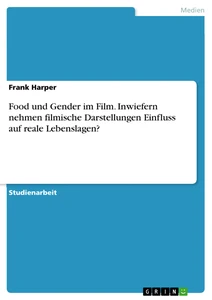
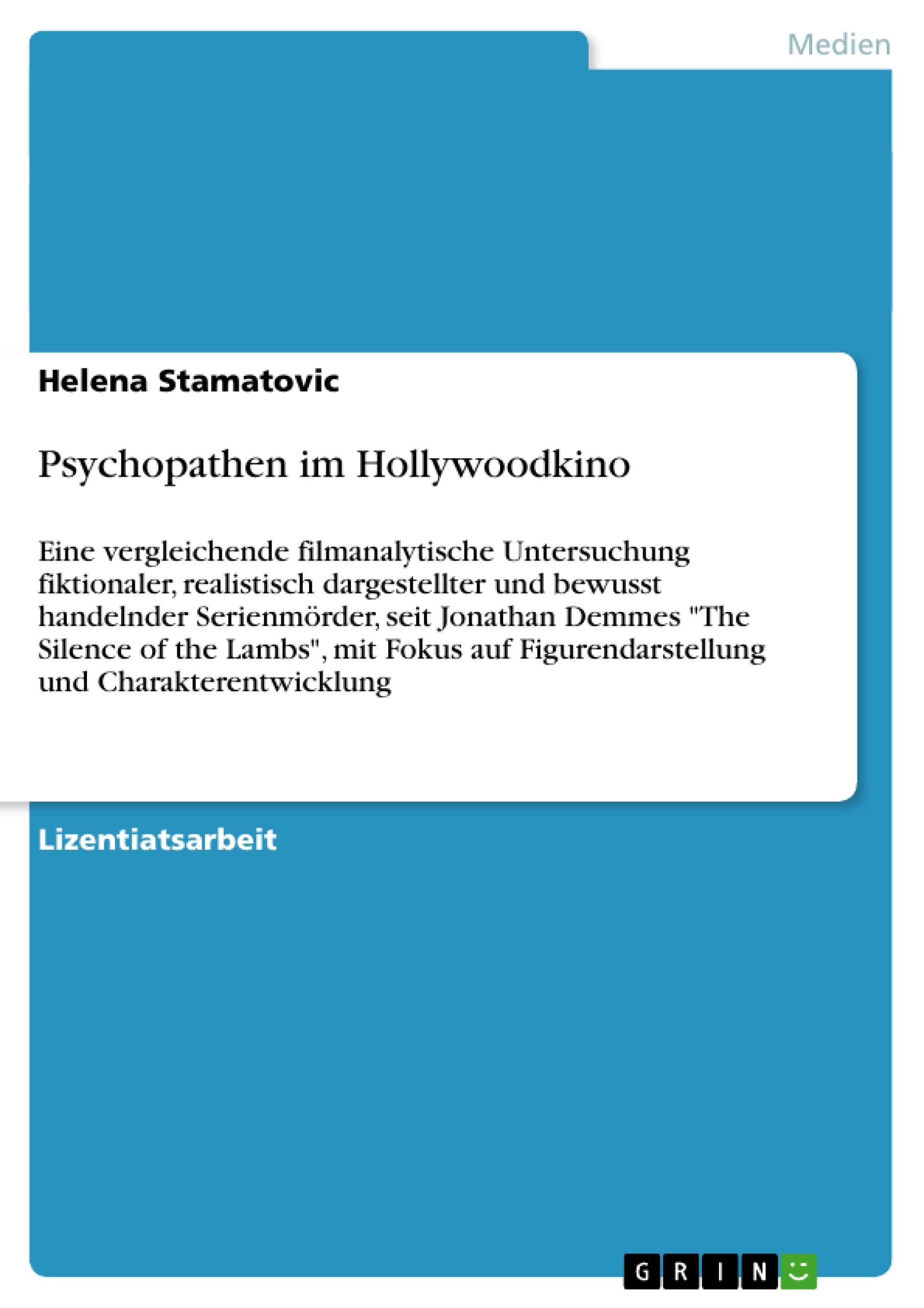

Kommentare