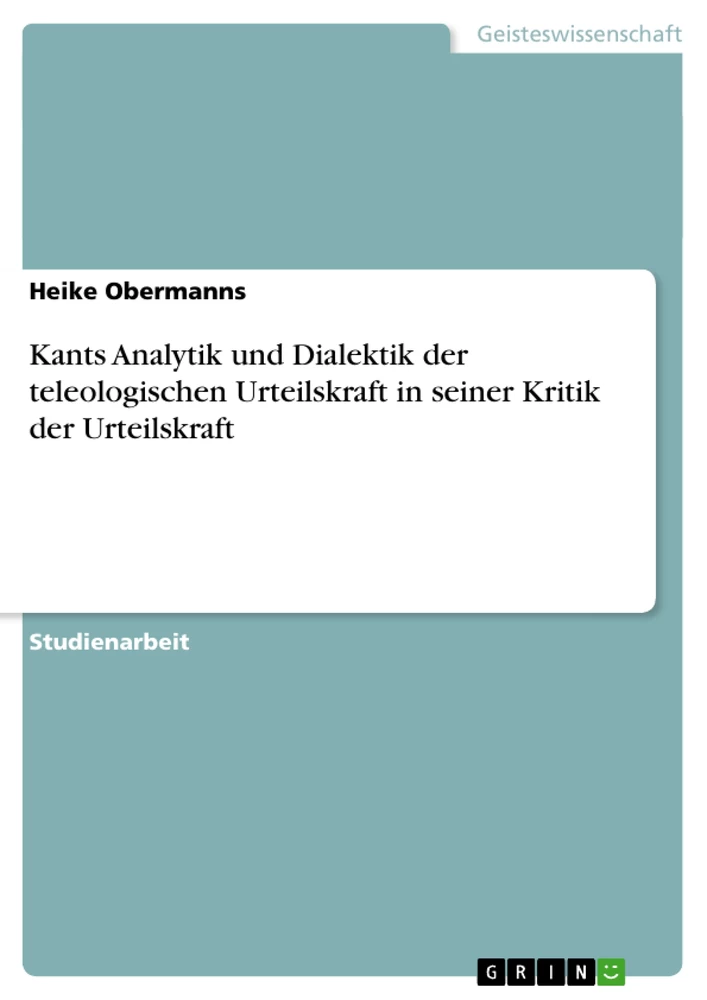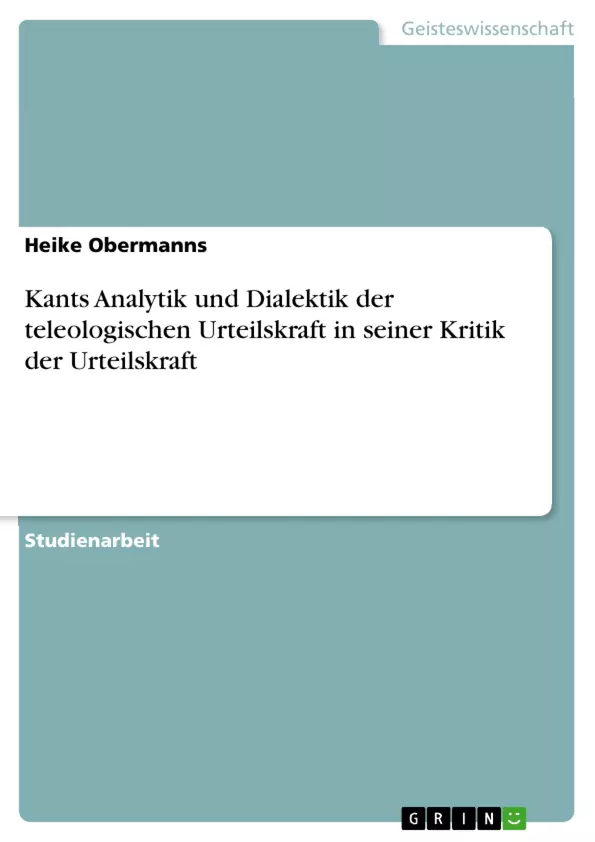In der »Kritik der Urteilskraft« verbindet Kant Untersuchungen zur Ästhetik und zum epistemischen Status naturteleologischer Beurteilungen, die in dieser Kombination zunächst befremdlich erscheinen. Für Kant ist das teleologische Urteil das Pendant zum ästhetischen. Beim letzteren geht es um die subjektive Zweckmäßigkeit, um die Bedeutung von Vorstellungen für das Subjekt; beim ersteren um die objektive Zweckmäßigkeit von Gegenstandsvorstellungen. Die kritische Untersuchung der Urteilskraft ist an den Nachweis gebunden, daß diese über ein eigenes Prinzip a priori verfügt: dasjenige der Zweckmäßigkeit. Kants Kritik der teleologischen Urteilskraft scheint das >moderne Unbehagen< an physikotheologischen Begründungen der Biologie aufzunehmen und oft auch zu antizipieren. Er behandelt fast ausschließlich das Problem des Gebrauchs teleologischer Prinzipien bei der Erklärung von Organismen und untersucht systematisch die Frage, ob und inwieweit die mechanistische Auffassung nicht doch teleologische Erklärungen bedingt bzw. ergänzend heranziehen muß. Er fragt also nicht, ob eher die mechanistische oder die zu seiner Zeit entstehende vitalistische Auffassung recht hat, sondern ob der mechanische Reduktionismus, der ontologische Begründungen ablehnt und als naturwissenschaftliche Methode außer Frage steht, nicht gerade bei der Erklärung von Organismen unzulänglich bleibt und den Rückgriff auf teleologische Ergänzungen immer wieder erzwingt. Kant geht der Frage nach, ob die mechanische Metapher des >Uhrwerks< bei Organismen überhaupt zutrifft und versucht dabei eine Grenzbestimmung anzugeben, inwieweit teleologisches Denken in der Biologie notwendig und zulässig ist, auch wenn die (naturwissenschaftliche) »Emanzipation der Zweckmäßigkeit von der Bezwecktheit durch Gott« akzeptiert wird.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Analytik der teleologischen Urteilskraft
2.1 Die reflektierende Urteilskraft
2.2 Objektive Zweckmäßigkeit
2.3 Die Organismus-Theorie
2.4 Teleologische Maximen
3. Die Dialektik der teleologischen Urteilskraft
3.1 Herleitung der Antinomie
3.2 Idealismus und Realismus der Zweckmäßigkeit
3.3 Die Auflösung der Antinomie
4. Schlußbemerkung
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In der »Kritik der Urteilskraft« verbindet Kant Untersuchungen zur Ästhetik und zum epistemischen Status naturteleologischer Beurteilungen, die in dieser Kombination zunächst befremdlich wirken, wenn man nicht ohnehin, wie z.B. Goethe, künstlerischen und naturwissenschaftliche Interessen gleichermaßen nachgeht. Goethe bekannte dann auch, der KdU ›eine höchst frohe Lebensepoche‹ zu verdanken[1]. Für Kant ist das teleologische Urteil das Pendant zum ästhetischen. Beim letzteren geht es um die subjektive Zweckmäßigkeit, um die Bedeutung von Vorstellungen für das Subjekt; beim ersteren um die objektive Zweckmäßigkeit von Gegenstandsvorstellungen. Die kritische Untersuchung der Urteilskraft ist an den Nachweis gebunden, daß diese über ein eigenes Prinzip a priori verfügt: dasjenige der Zweckmäßigkeit[2]. Man muß sich dabei vergegenwärtigen, daß die metaphysische Teleologie, die in vielfacher Ausgestaltung von der Antike bis zum 18. Jahrhundert Gegenstand der Naturphilosophie war, das Material für Kants Kritik bildete[3]. Ohne die instruktiven philosophiegeschichtlichen Erläuterungen, die Cassirer für das Verständnis der KdU gibt, hier nachzeichnen zu können, kann man - sehr verkürzt - folgenden wissenschaftstheoretischen Hintergrund der kantischen Fragestellung festhalten:
Seitdem Aristoteles in seiner Biologie als Hermeneutik der lebendigen Natur das Verständnis des Lebendigen über die Begriffe Substanz (hypokeímenon), Seele (psyche) und Zweck (télos) eingeführt hat, kam es zu zwei bis zum heutigen Tage miteinander konkurrierenden Grundlegungen der Biologie, die - verkürzt - als mechanistische und vitalistische Auffassung bezeichnet werden können[4].
Bis ins 17. Jahrhundert war die mechanistische Auffassung wissenschaftlich verbreitet, nach der das Leben aus Uranfängen durch Naturgesetze zu begreifen versucht wird. Weder Entstehung noch Entwicklung, noch Prozesse innerhalb und zwischen Lebewesen benötigen dabei weitere ›übernatürliche‹ Erklärungsfaktoren, denn im Rahmen des christlichen Weltbildes wurde der Schluss von der Zweckmäßigkeit des Lebendigen auf die göttliche Weisheit als evident und fraglos angesehen[5] (Physikotheologie). Die neuzeitliche Mathematisierung und experimentelle Methodik der Naturwissenschaft machte auch vor dem Lebendigen nicht Halt: die cartesische Trennung zwischen res cogitans (Geist) und res extensa (Materie) galt auch für alles Lebendige. Lebewesen wurden als kunstvolle Automaten aufgefaßt, und gleichzeitig blieb die physikotheologische Dimension präsent im Gedanken des Schöpfergottes, als dessen Werk diese zweckmäßigen Automaten gesehen wurden. Erst Darwins Evolutionstheorie der »natürlichen Auslese« brachte die Wende zu einem ausschließlich mechanistischen Paradigma der Biologie.
Demgegenüber steht die vitalistische Auffassung, für die jede Erklärung des Lebens aus Elementen und Naturgesetzen unmöglich ist[6]. Leben wird als eine von allem Anorganischem unabhängige Kraft, als immer schon vorausgesetztes ontologisches Prinzip gesehen. Materielle, physikalische, chemische und physiologische Voraussetzungen werden zwar nicht geleugnet, können aber Leben nicht erklären. Dahinter stehen u.a. die aristotelischen Definitionen »Leben heißt Seele haben« und »Leben heißt, Ursache von Bewegung sein können« sowie der Gedanke der Entelechie. Rezeptivität und Spontaneität des Lebendigen steht im Vordergrund, es wird vom Subjektsein her gesehen, nicht vom Objektcharakter[7]. Die Annahme eines ›entelechialen Faktors‹ im Lebewesen konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Auch die berühmte Monadologie von Leibniz, nach der sowohl die Außenperspektive der Monade ein reiner Kausalmechnismus als auch ihre Innenperspektive eine deterministische Entwicklungsteleologie darstellen, war für die moderne Naturwissenschaft aufgrund der These der ‘prästabilierten Harmonie’ unhaltbar.
Kants Kritik der teleologischen Urteilskraft scheint das ›moderne Unbehagen‹ an physikotheologischen Begründungen der Biologie aufzunehmen und oft auch zu antizipieren[8]. Er behandelt fast ausschließlich das Problem des Gebrauchs teleologischer Prinzipien bei der Erklärung von Organismen und untersucht systematisch die Frage, ob und inwieweit die mechanistische Auffassung nicht doch teleologische Erklärungen bedingt bzw. ergänzend heranziehen muß[9]. Er fragt also nicht, ob eher die mechanistische oder die zu seiner Zeit entstehende vitalistische Auffassung recht hat, sondern ob der mechanische Reduktionismus, der ontologische Begründungen ablehnt und als naturwissenschaftliche Methode außer Frage steht, nicht gerade bei der Erklärung von Organismen unzulänglich bleibt und den Rückgriff auf teleologische Ergänzungen immer wieder erzwingt[10]. Wenn Lebewesen und Organismen nach neuzeitlich-mechanistischer Auffassung als ›zweckmäßige Automaten‹ aufgefaßt werden und die Welt als Uhr, so liegt die Teleologie in Form des Planes eines Uhrmacher-Gottes nahe: »Die Welt als Uhr setzte immer einen Uhrmacher voraus, der die Weltuhr in einem Plan gedanklich antizipiert und entwirft.«[11] Kant geht der Frage nach, ob die mechanische Metapher des‹‘Uhrwerks‹ bei Organismen überhaupt zutrifft und versucht dabei eine Grenzbestimmung anzugeben, inwieweit teleologisches Denken in der Biologie notwendig und zulässig ist, auch wenn die (naturwissenschaftliche) »Emanzipation der Zweckmäßigkeit von der Bezwecktheit durch Gott«[12] akzeptiert wird. In der »Kritik der reinen Vernunft« war Kant zu dem Schluss gekommen, daß es ›das spekulative Interesse der Vernunft‹ selbst verlangt, ›alle Anordnung in der Welt so anzusehen, als ob sie aus der Absicht einer allerhöchsten Vernunft entsprossen wäre‹; und solange diese Idee des teleologischen Zusammenhangs (›nexus finalis‹) auf den ›bloß regulativen Gebrauch‹ des Denkens eingeschränkt bleibe, der mechanische Wirkzusammenhang (›nexus effectivus‹) dagegen als objektive Erfahrung gelte, führe sie die Naturbetrachtung ohne dialektischen Schein ›zu der größten systematischen Einheit‹[13]. Die Vernunft will sich sozusagen mit Zufälligkeiten nicht begnügen und entwirft ein Einheitsprinzip - die Idee des Zwecks -, um sich hypothetisch eine Ordnung zu erklären. Im Zentrum der Untersuchung stehen also nicht realontologische Bedingungen oder das Dasein zweckmäßiger Gebilde in Kunst und Natur, sondern »die eigentümliche Richtung, die unsere Erkenntnis nimmt, wenn sie ein Seiendes als zweckmäßig, als Ausprägung einer inneren Form b e u r t e i l t .«[14]
2. Die Analytik der teleologischen Urteilskraft
2.1 Die reflektierende Urteilskraft
In der Einleitung der KdU finden sich die für das Verständnis der teleologischen Urteilskraft entscheidenden Definitionen: Die Urteilskraft generell definiert Kant als »das Vermögen, das Besondere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken.« (B XXVI). Die Urteilskraft, die das Besondere unter ein gegebenes Allgemeines (Regel, Prinzip, Gesetz) subsumiert, ist bestimmend. Wird dagegen das Allgemeine zu gegebenem Besonderen gesucht, ist die Urteilskraft bloß reflektierend. Die bestimmende Urteilskraft steht unter transzendentalen Gesetzen, die ihr apriori vorgegeben sind; die reflektierende Urteilskraft jedoch bedarf noch eines Prinzips ›der Einheit des Mannigfaltigen‹, das sie sich selbst gibt. Sie will partikularen empirischen Naturgesetzen ein einheitliches Prinzip zugrundelegen und geht daher so vor, »als ob gleichfalls ein Verstand (wenn gleich nicht der unsrige) sie zum Behuf unserer Erkenntnisvermögen, um ein System der Erfahrung nach besonderen Naturgesetzen möglich zu machen, gegeben hätte.« (B XXVII) Und dieses Einheitsprinzip der reflektierenden Urteilskraft ist dasjenige der » Zweckmäßigkeit der Natur in ihrer Mannigfaltigkeit.« (B XXVIII)
Da die Urteilskraft ein Mittelglied zwischen den konstitutiven Erkenntnisvermögen Verstand und Vernunft darstellt, kann allerdings von ihrem apriorischem Prinzip nur regulativ Gebrauch gemacht werden[15]. D.h.: da der Zweckbegriff nicht zu den Verstandeskategorien zählt, kann die Beurteilung der Zweckmäßigkeit der Natur nur regulativ und nicht konstitutiv geschehen[16]: »dieses Vermögen gibt sich dadurch nur selbst und nicht der Natur ein Gesetz.« (B XXVIII) Die ›Schlüsse der Urteilskraft‹ suchen also zu einem empirischen Sachverhalt ein Naturgesetz, aus dem er als notwendig einsichtig wird. Die teleologische Urteilskraft beurteilt »die besonderen Naturgesetze so, als ob sie Wirkungen eines zielgerichteten Wollens wären«[17], sie wird bloß logisch gebraucht:
»Dieser transzendentale Begriff einer Zweckmäßigkeit der Natur ist nun weder ein Naturbegriff noch ein Freiheitsbegriff, weil er gar nichts dem Objekte (der Natur) beilegt, sondern nur die einzige Art, wie wir in der Reflexion über die Gegenstände der Natur in Absicht auf eine durchgängig zusammenhängende Erfahrung verfahren müssen, vorstellt, folglich ein subjektives Prinzip (Maxime) der Urteilskraft« (B XXXIV).
Somit zeigt sich, daß der Zweckbegriff eine Umgestaltung erfährt, eine Kantische ›Revolution der Denkart‹: »Der Zweck ist keine objektiv wirkende Naturmacht in den Dingen und hinter den Dingen; sondern er ist ein geistiges Verknüpfungsprinzip, das unsere Beurteilung an die Gesamtheit der Erscheinungen heranbringt.«[18]
2.2 Objektive Zweckmäßigkeit
Die Kritik der teleologischen Urteilskraft beginnt daher mit der Klärung, was am Begriff der objektiven Zweckmäßigkeit a priori und was empirisch ist[19] (§§ 61 - 63). Zum einen wird die objektive Zweckmäßigkeit von der subjektiven des Geschmacksurteils unterschieden; zum anderen will Kant sich vom traditionellen, konstitutiven Gebrauch der Teleologie absetzen[20].
Es gibt keinen Anlaß, so Kant, zu »präsumieren«, daß es in der Natur eine besondere Gesetzmäßigkeit durch Zwecke gibt, und darüber hinaus: uns kann »selbst die Erfahrung die Wirklichkeit derselben nicht beweisen; es müßte denn eine Vernünftelei vorhergegangen sein, die nur den Begriff des Zwecks in die Natur der Dinge hineinspielt« (§ 61, B 268).
Der Zweckbegriff wird analog zu unserem Verständnis von Kausalität in die Natur ›hineingespielt‹, und zwar offenbar dann, wenn der Mechanismus unzureichend erscheint[21]. Er leitet sich nicht aus Erfahrung ab und hängt nicht notwendig mit dem Mechanismus zusammen, sondern wird gerade dann ins Spiel gebracht, wenn Naturprodukte als höchst zufällig erfahren werden: »Denn wenn man z.B. den Bau eines Vogels, die Höhlung in seinem Knochen, die Lage seiner Flügel zur Bewegung und des Schwanzes zum Steuern usw. anführt, so sagt man, daß dieses alles nach dem bloßen nexus effectivus in der Natur, ohne noch eine besondere Art der Kausalität, nämlich die der Zwecke (nexus finalis), zu Hilfe zu nehmen, im höchsten Grade zufällig sei; d.i.daß sich die Natur, als bloßer Mechanism betrachtet, auf tausendfache Art habe anders bilden können« (§ 61, B 269).
Solcherart durch den Mechanismus unterbestimmt, wird der Natur der ›nexus finalis‹ als objektive Zweckmäßigkeit unterstellt, um ein Einheitsprinzip zu gewinnen. Es werden Naturdinge so erklärt, als ob sie sich zielgerichtet entwickelten.
Kant teilt zunächst die objektive Zweckmäßigkeit in eine formale und in eine materiale ein (§ 62). Als Beispiel für formale objektive Zweckmäßigkeit führt er geometrische Figuren an, an denen sich verschiedene zweckmäßige Proportionen feststellen lassen. Diese Zweckmäßigkeit bleibt jedoch formal bzw, wie Kant auch sagt, intellektuell, da sich aus der Beschaffenheit einer geometrischen Figur keine bestimmten, konkreten Zwecke ableiten lassen[22].
Bei der materialen Zweckmäßigkeit dagegen handelt es sich um Gegenstände der materiellen Wirklichkeit; hier unterscheidet Kant zwischen einer äußeren (relativen) und einer inneren (absoluten) Zweckmäßigkeit (§ 63). Die äußere Zweckmäßigkeit unterstellen wir in der Natur, wenn es um ›Nutzbarkeit‹ (für Menschen) oder um ›Zuträglichkeit‹ (für andere Lebewesen) geht. Z.B. hinterlassen die Überschwemmungen des Nils fruchtbares Ackerland oder früheres Meer hat Sandboden zurückgelassen, der für das Gedeihen von Fichten zuträglich ist. Diese Zweckmäßigkeit ist relativ, weil man zwar etwas über die Gegenstände erfährt, aber keine eigentlichen Definitionen der Objekte. Wenn man einen Gegenstand als relativ zweckmäßig für etwas anderes erklärt, ist dies noch kein notwendiger Bestandteil seiner Definition. Nützlichkeit und Zuträglichkeit bleiben letztlich zufällige Beziehungen, die den Dingen nicht selbst innewohnen[23]: »Denn wenn alle diese Naturnützlichkeit auch nicht wäre, so würden wir nichts an der Zulänglichkeit der Naturursachen zu dieser Beschaffenheit vermissen« (§ 62, B 284). Jedoch weist die Tatsache, daß es manchmal sinnvoll sein kann (aber nicht notwendig ist), einem Gegenstand eine relative Zweckmäßigkeit zuzuschreiben, auf eine andere Zweckmäßigkeit hin[24], die den Kern der Analytik bildet: auf Naturzwecke, und damit auf objektiv-materiale-innere Zweckmäßigkeit.
2.3 Die Organismus-Theorie
Ein Ding, das nur als Zweck möglich sei, so Kant, habe die Kausalität seines Ursprungs nicht im Naturmechanismus, sondern »in einer Ursache, deren Vermögen zu wirken durch Begriffe bestimmt wird« (§ 64, B 284). Seine empirische Erkenntnis nach Ursache und Wirkung setze Begriffe der Vernunft voraus. Aus der Perspektive des Verstandes erscheint die Form eines Gegenstandes als zufällig, während die Vernunft sie begrifflich als zweckmäßig beurteilt. Der Vernunft geht es um die Notwendigkeit eines Gegenstandes als Naturprodukt - wir unterstellen ein Vermögen, Wille genannt, das nach Zwecken handelt und so den Gegenstand hervorbringt[25]. Im Gegensatz zu deistischen Systemen, die von einem als wirklich angenommenen Handwerker-Gott ausgehen, der als causa formalis wirkt[26], setzt Kant auf die ›autopoietische‹[27] Variante:
»ein Ding existiert als Naturzweck, wenn es von sich selbst (obgleich in zwiefachem Sinne) Ursache und Wirkung ist« (§ 64, B 286).
Kant verdeutlicht dies am Beispiel eines Baums, der in dreifacher Hinsicht Ursache und Wirkung seiner selbst ist:
1) Der Baum zeugt einen anderen Baum und erzeugt sich somit selbst seiner Gattung nach.
2) Der Baum erzeugt sich selbst als Individuum, und zwar durch Wachstum, das sich von mechanischer Größenzunahme unterscheidet.
3) Die Erhaltung (Ernährung) von Teilen des Baumes hängt wechselweise von derjenigen der anderen Teile ab.
Kant benennt hier also drei Weisen der (Selbst-)Reproduktion eines Systems: 1) Fortpflanzung (Produktion neuer Systeme); 2) Wachstum (erweiterte Reproduktion); 3) gegenseitige Abhängigkeit der Teile voneinander und vom Ganzen (Regeneration)[28].
Nun ist aber der Baum als Organismus nicht von vornherein als Naturzweck zu sehen; der Begriff Naturzweck wird nicht als Synonym für Organismen eingeführt, denn Organismen sind zunächst Gegenstände der Erfahrung. Kants Ausführungen zum Naturzweck gelten für Organismen insofern, als sie als Naturzweck gedacht werden müssen [29].
An der Struktur von Organismen kann Kant jedoch zweierlei aufzeigen: zum einen, wie sich in ihnen sowohl der mechanische als auch die finale Kausalität verbinden; zum anderen, wie sich an ihnen die innere Zweckmäßigkeit entfaltet[30] (§ 65).
Kant nennt zwei Bedingungen für die Rede von Organismen als Naturzwecke. Erstens müssen »die Teile (ihrem Dasein und der Form nach) nur durch ihre Beziehung auf das Ganze möglich [sein]« und zweitens müssen »die Teile desselben sich dadurch zur Einheit eines Ganzen verbinden, daß sie von einander wechselseitig Ursache und Wirkung ihrer Form sind.« (§ 65, B 290f.). Die erste Bedingung gilt auch für Kunstwerke oder technische Produkte, und nur die die zweite Bedingung charakterisiert spezifisch einen Naturzweck. D.h. dieser ist auf keine äußere Ursache zurückzuführen; im Organismus ist nach Kant das Verhältnis des Ganzen und der Teile so zu denken, daß die Idee des Ganzen in jedem Teil schon enthalten ist[31]. Im Mechanismus verfügt kein einzelner Teil über Information über das Ganze. Dagegen soll das Beispiel des Baumes zeigen, daß selbst die kleinsten Komponenten eines Organismus´ in sich selbst alle Eigenschaften einschließen, die insgesamt den vollständigen Organismus bilden - ganz ähnlich wie eine Leibnizsche Monade[32]:
»In einem solchen Produkt der Natur wird ein jeder Teil, so wie er nur durch alle übrigen da ist, auch als um der anderen und des Ganzen willen existierend, d.i. als Werkzeug (Organ) gedacht: welches aber nicht genug ist (denn er könnte auch Werkzeug der Kunst sein und so nur als Zweck überhaupt möglich vorgestellt werden), sondern als ein die anderen Teile (folglich jeder den anderen wechselseitig) hervorbringendes Organ (...), und nur dann und darum wird ein solches Produkt als organisiertes und sich selbst organisierendes Wesen ein Naturzweck genannt werden können.« (§ 65, B291f.)
Kant illustriert dies am Beispiel einer Uhr (sozusagen dem Inbegriff eines Mechanismus): In ihr ist zwar ein Teil Werkzeug, um einen anderen zu bewegen, aber nicht Wirkursache der Hervorbringung des anderen. Hervorbringende Ursache liegt hier außerhalb der Uhr (im Konstrukteur). Keine Uhr bringt eine andere hervor oder bessert sich gar selbst aus. In bezug auf den Verstand, der die Uhr gebaut hat, können die Teile zwar als Endursachen füreinander betrachtet werden, aber nicht als Wirkursachen [33]. Naturzwecke sind dagegen dadurch charakterisiert, daß sie in sich selbst eine »sich fortpflanzende bildende Kraft [haben], welche durch das Bewegungsvermögen allein (den Mechanism) nicht erklärt werden kann.« (§ 65, B 293)[34].
Letztlich verweist der Organismus als Naturzweck für Kant also auf eine (überempirische) Idee, die offenbar in einem physischen Körper inkarniert zu sein scheint[35]. Doch Kant entwirft hier keine Metaphysik der Natur. Es ist nicht die Frage, ob die Natur zweckmäßig verfährt, ob sie von bewußten oder unbewußten Absichten geleitet ist, »sondern ob unsere Beurteilung genötigt sei, eine eigene ›Dingform‹ zu setzen und anzunehmen, die sich von der des Körpers der abstrakten Mechanik unterscheidet«[36]. Die ontologische Dimension muß von der erkenntnistheoretischen unterschieden werden. Nicht für die Konstitution des Organismus, sondern für die Vorstellung, die wir uns von ihm machen, ist eine Idee notwendig[37]. Die Idee des Ganzen als Ursache führt (ontologisch) zum Kunstprodukt, das von einer äußeren Vernunft hergestellt wird. Bei Naturzwecken ist die Idee dagegen »Erkenntnisgrund der systematischen Einheit der Form (...) für den, der es beurteilt.« (§ 65, B 291) Und daher ist der Begriff des Naturzwecks auch »kein konstitutiver Begriff des Verstandes oder der Vernunft, kann aber doch ein regulativer Begriff für die reflektierende Urteilskraft sein« (ebd., B 294f.).
2.4 Teleologische Maximen
[38] In den letzten drei Abschnitten der Analytik (§§ 66-69) geht es um die Anwendung der inneren Zweckmäßigkeit auf die gesamte Natur bzw. um das Verhältnis von Teleologie und Naturwissenschaft. Auf ein Prinzip der Urteilskraft gebracht, formuliert Kant die Teleologie folgendermaßen:
»Ein organisiertes Produkt der Natur ist das, in welchem alles Zweck und wechselseitig Mittel ist. Nichts in ihm ist umsonst, zwecklos oder einem blinden Naturmechanism zuzuschreiben.« (§ 66, B 296)
Dieses (regulative) Prinzip (a priori) nennt Kant »eine Maxime der Beurteilung der inneren Zweckmäßigkeit organisierter Wesen« (ebd.). Der Zweckbegriff leitet sich aus einer Vernunftidee ab[39], so daß die mechanistische Naturerklärung »uns hier nicht mehr genugtun will« (ebd., B 297). Da die Vernunftidee mit der Forderung nach (absoluter) Einheit verbunden ist, führt sie zum Begriff der Natur als System, »zu der Idee eines großes System der Zwecke der Natur« (§ 67, B 303) . Gleichwohl weist Kant den Gedanken zurück, die Teleologie auch als inneres Prinzip der Naturwissenschaft aufzufassen[40] (§ 68). Die Physik abstrahiere gänzlich von der Frage, ob Naturzwecke absichtlich oder unabsichtlich seien, sie würde sich sonst »in ein fremdes Geschäft« einmischen, in die Metaphysik oder gar die Theologie: »Wenn man also für die Naturwissenschaft und ihren Kontext den Begriff von Gott hereinbringt, um sich die Zweckmäßigkeit in der Natur erklärlich zu machen, und hernach diese Zweckmäßigkeit wiederum braucht, um zu beweisen, daß ein Gott sei: so ist in keiner von beiden Wissenschaften innerer Bestand« ( § 68, B 305)[41]. Als Prinzip der reflektierenden Urteilskraft führe die Zweckmäßigkeit keinen besonderen Grund der Kausalität ein, sondern füge »zum Gebrauche der Vernunft« (ebd., B 308) eine andere Art der Forschung als die nach mechanischen Gesetzen hinzu. Der Gebrauch teleologischer Maximen in pragmatischer Hinsicht ist demnach unproblematisch. Aber wenn es so aussieht, als müßte der Begriff des Naturzwecks notwendig als innere Zweckmäßigkeit angenommen werden, entsteht ein prinzipielles Problem[42]. In der Dialektik der teleologischen Urteilskraft versucht Kant das Problem als direkten Widerspruch (Antinomie) zuzuspitzen und grundsätzlich zu lösen.
3. Die Dialektik der teleologischen Urteilskraft
Die Analytik hatte nicht abschließend geklärt, ob die teleologische Beurteilungsart nicht doch in einem grundsätzlichen Widerspruch zur mechanistischen Naturbetrachtung steht. Mit der Argumentationsfigur der Antinomie versucht Kant darüber Klarheit zu gewinnen. Eine Antinomie ergibt sich aus dem Widerspruch von Gesetzen, demnach kann nur ein Vermögen, das selbst gesetzgebend (autonom) arbeitet, sich in einen solchen Widerstreit verwickeln[43]. Die reflektierende Urteilskraft ist innerhalb gewisser Grenzen autonom, weil sie sich selbst eine Regel gibt, wie sie das Allgemeine suchen soll. Sie ist also gesetzgebend (für sich selbst) im Bereich der Gesetz- und Hypothesenbildung der empirischen Naturwissenschaft, und nur dabei kann eine Antinomie der Urteilskraft entstehen. Bei der bestimmenden Urteilskraft ist das Allgemeine vorgegeben, sie ist insofern nicht autonom, daher kann bei ihr keine Antinomie entstehen[44]:
»Aller Anschein einer Autonomie zwischen den Maximen der eigentlich physischen (mechanischen) und der teleologischen (technischen) Erklärungsart beruht also darauf: daß man einem Grundsatz der reflektierenden Urteilskraft mit dem der bestimmenden, und die Autonomie der ersteren (die bloß subjektiv für unseren Vernunftgebrauch in Ansehung der besonderen Erfahrung gilt) mit der Heteronomie der anderen, welche sich nach den von dem Verstande gegebenen (allgemeinen oder besonderen) Gesetzen richten muß, verwechselt.« (§ 71, B 318f.)
Für die reflektierende Urteilskraft entsteht das Problem durch die Einführung des Begriffs des Naturzwecks als des Allgemeinen, unter dem die Organismen zu subsumieren sind. Dieser selbstgegebene Begriff des Naturzwecks könnte widersprüchlich sein, und wenn sich der Widerspruch als unvermeidlich herausstellt, handelt es sich um eine Antinomie. Anders als in der Kritik der reinen Vernunft diskutiert Kant hier also nicht eine Antinomie der ›vorkritischen dogmatischen Vernunft‹, sondern diejenige der bereits ›kritisch geläuterten Urteilskraft‹[45]. Hier geht es darum, einen Widerspruch zwischen zwei Regeln der reflektierenden Urteilskraft darzustellen, um im Ergebnis eine unbegründete Voraussetzung der empirischen Naturwissenschaft zu falsifizieren bzw. zu relativieren[46]. Diese unbegründete Voraussetzung ist für Kant die Hypostasierung der mechanischen (analytischen) Kausalität als einzig gültige Kausalität, zu der der Begriff des Naturzwecks in einen Widerspruch gerät. Da die mechanistische (reduktionistische) Erklärungsweise von Kant jedoch nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird, kommt es im Ergebnis zu ihrer Relativierung. Es geht um die Art der Kausalität, die angewandt wird: wenn man mit Kant davon ausgeht, daß im Organismus das Ganze in den Teilen enthalten ist - und nicht nur mechanisch angenommen wird, die Teile seien Bedingungen des Ganzen -, dann könnte man daraus schließen, daß man es gleichzeitig mit mechanischer und finaler Kausalität zu tun hat[47], dann hätten beide Erklärungsweisen ihre Berechtigung.
3.1 Herleitung der Antinomie
Die Urteilskraft gehe von zwei Maximen aus, so Kant (§ 70, B 314): eine gebe ihr »der bloße Verstand a priori an die Hand« (bestimmende Urteilskraft), die andere wird durch »besondere Erfahrung veranlaßt« (reflektierende Urteilskraft), die nach einem besonderen Prinzip die organische Natur beurteile. Es könne »den Anschein haben«, daß beide nicht nebeneinander Bestand haben können, daß »sich eine Dialektik hervortut, welche die Urteilskraft in dem Prinzip ihrer Reflexion irre macht.« (ebd.). Diese Antinomie lautet:
» Die erste Maxime derselben ist der Satz: Alle Erzeugung materieller Dinge und ihrer Formen muß als nach bloß mechanischen Gesetzen möglich beurteilt werden.
Die zweite Maxime ist der Gegensatz: Einige Produkte der materiellen Natur können nicht als nach bloß mechanischen Gesetzen möglich beurteilt werden (ihre Beurteilung erfordert ein ganz anderes Gesetz der Kausalität, nämlich das der Endursachen).« (§ 70, B 314)
Dies sind, wie Kant gleich darauf schreibt, regulative Grundsätze der Urteilskraft. D.h. sie betreffen gar nicht die objektiven Erkenntnisse, die die empirischen Naturwissenschaften beschäftigen (die Kant nicht im mindesten bezweifelt)[48]. Denn die reflektierende Urteilskraft stellt ein ›subjektives Prinzip‹ dar, das nicht die Objektivität der Naturprodukte konstituiert, sondern nur auf sie reflektiert. Es handelt sich also um eine Antinomie innerhalb der kritisch begründeten Naturwissenschaft[49]. Würde man die Maximen in dogmatische Aussagen über die Wirklichkeit übersetzen, käme man allerdings analog auf denjenigen Widerstreit der vorkantischen Wissenschaft zurück, die nicht zwischen konstitutiven und regulativen Prinzipien unterschied. Kant liegt offenbar daran, diesen Unterschied nochmals zu markieren, indem er sogleich auch den Widerspruch formuliert, der sich ergeben würde, wenn es darum ginge, die Objektivität von Naturprodukten zu konstituieren:
» Satz: Alle Erzeugung materieller Dinge ist nach bloß mechanischen Gesetzen möglich.
Gegensatz: Einige Erzeugung derselben ist nach bloß mechanischen Gesetzen nicht möglich.« (§ 70, B314f.)
Kant erklärt nun ausführlich, daß man beide Gegensatzpaare nicht verwechseln dürfe. Denn das zweite Gegensatzpaar wäre keine Antinomie der Urteilskraft, »sondern ein Widerstreit in der Gesetzgebung der Vernunft« (ebd., B 315). Es stellt letztlich überhaupt keine Antinomie dar, da die Vernunft weder den einen noch den anderen Satz beweisen könne, »weil wir von der Möglichkeit der Dinge nach bloß empirischen Gesetzen der Natur kein bestimmendes Prinzip a priori haben können« (ebd.).
Die Antinomie der Urteilskraft steckt also in den ersten beiden Maximen, und ihre Struktur ist kompliziert[50]: zunächst handelt es sich um insgesamt drei Behauptungen, zwei über den Mechanismus und eine über finale Ursachen, die in Klammern steht. Es geht dabei nicht um einen Widerspruch zwischen mechanischer und teleologischer Naturerklärung, sondern um verschiedene Aussagen über den Mechanismus selbst, nämlich ob dieser notwendig allgemeingültig sein muß oder ob seine Anwendung punktuell unmöglich oder unzureichend ist. Erst, wenn sich die zweite Behauptung als richtig erwiesen hat - daß einige Naturprodukte nicht nach mechanischen Gesetzen als möglich beurteilt werden können -, kommt der in Klammern gesetzte Satz der zweiten Behauptung, die teleologische Maxime, überhaupt in Betracht. Ein Widerspruch ergibt sich erst dann, wenn sich auch die erste Behauptungen als wahr erweist. D.h., ein Konflikt zwischen mechanistischer und teleologischer Naturerklärung ergibt sich erst dann, wenn beide Behauptungen wahr sind und damit die Antinomie innerhalb des Mechanismus eigentlich schon aufgelöst ist. Die Antonimie kann also gelöst werden, indem aufgezeigt wird, daß beide Aussagen über den Mechanismus wahr sein können, und danach muß die gelegentliche Anwendung der Teleologie mit dem kritisch geläuterten Mechanismus ›versöhnt‹ werden[51].
3.2 Idealismus und Realismus der Zweckmäßigkeit
Nicht wenige Interpreten der KdU hat es irritiert, daß Kant der eigentlichen Antinomie der reflektierenden Urteilskraft das Gegensatzpaar der konstitutiven Prinzipien zur Seite stellt, das einen ganz anderen Widerspruch darstellt als den für die Dialektik wichtigen[52] regulativen. Obwohl es hier, wie erwähnt, nicht um eine Antinomie zwischen dogmatischer und kritischer Position wie in der Kritik der reinen Vernunft geht, behandelt Kant dennoch in Vorbereitung der Auflösung der Antinomie die Positionen der von ihm als dogmatisch eingestuften Vorgänger, deren Auffassungen sich analog im zweiten Gegensatzpaar zeigen. Er kritisiert daher zunächst zwei verschiedene »Systeme über die Zweckmäßigkeit der Natur« (§§ 72-74) aus der vorkantischen Epoche. Er bindet sie in die Diskussion der Antinomie ein, vielleicht als Vorstufe und Vergleich[53].
Die zwei Grundpositionen, die Kant kritisiert, wären zum ersten der ›Idealism ‹ der Zweckmäßigkeit (Kasualität - Epikur - und Fatalität - Spinoza -), der die Zweckmäßigkeit der Natur als unabsichtlich auffaßt, und zum zweiten der › Realism ‹ der Zweckmäßigkeit (Hylozoismus und Deismus), der einige Zweckmäßigkeit der Natur als absichtlich auffaßt (§ 72). Der Widerspruch zwischen diesen beiden Auffassungen ist aus kantischer Perspektive eine Pseudo-Antinomie, da sie von konstitutiven Prinzipien ausgehen und über die Zweckfrage gar nicht entscheiden können. Sie sind »insgesamt dogmatisch, d.i. über objektive Prinzipien der Möglichkeit der Dinge (...) unter einander streitig (...), nicht aber etwa über die subjektive Maxime, über die Ursache solcher zweckmäßigen Produkte bloß zu urteilen; in welchem letzterem Falle disparate Prinzipien noch wohl vereinigt werden können, anstatt daß im ersteren kontradiktorisch - entgegengesetzte einander aufheben und neben sich nicht bestehen können.« (§ 72, B 321f.).
Diese Systeme, so Kants Überschrift zum § 73, leisten nicht das, was sie vorgeben: Die Kasualität nehme den blinden Zufall als Erklärungsgrund, wodurch »nichts, auch nicht einmal der Schein in unserem teleologischen Urteil erklärt, mithin der vorgebliche Idealism in demselben keineswegs dargetan wird.« (§ 73, B 325). Spinoza wolle zwar einen Erklärungsgrund der Zweckverknüpfung bei Naturprodukten angeben, verlagere diesen aber in die Einheit des Subjekts und verkenne dabei den Unterschied zwischen objektkonstitutiver Erkenntnis und reflektierendem Urteil: »wenn alle Dinge als Zweck gedacht werden müssen, also ein Ding sein und Zweck sein einerlei ist, so gibt es im Grunde nichts, was besonders als Zweck vorgestellt zu werden verdiente.« (§ 73, B 326). Bei den realistischen Systemen gehe der Hylozoismus von der Möglichkeit einer lebendigen Materie aus, was schon begrifflich einen Widerspruch beinhalte, da Materie per definitionem unbelebt sei. Das Verständnis von der gesamten Natur als eines Lebewesens sei nur »dürftigerweise« brauchbar, insofern es aus der Erfahrung der Natur im Kleinen abgeleitet werden kann, nicht jedoch »a priori ihrer Möglichkeit nach eingesehen werden« (ebd., B 328). Auch der Theismus könne die Möglichkeit von Naturzwecken nicht dogmatisch begründen, wenn er durch die These eines tätigen Verstandes die absichtliche Einführung der Naturzwecke ableite. Er müsse dann beweisen, daß die Zweckmäßigkeit der Materie durch den bloßen Mechanismus unmöglich sei. Hier kommt wieder die Kantische ›kopernikanische Wende‹ zum Tragen: Ein oberster Verstand »kann nur ein Grund für die reflektierende, nicht für die bestimmende Urteilskraft (sein), und kann schlechterdings zu keiner objektiven Behauptung berechtigen.« (ebd., B 329).
Das technische (teleologische) Naturverständnis kann, so Kant, demnach nicht dogmatisch begründet werden; Naturzwecke seien (ontologisch) ›unerklärlich‹; es kann nicht nur »nicht ausgemacht werden, ob Dinge der Natur, als Naturzwecke betrachtet, für ihre Erzeugung eine Kausalität von ganz besonderer Art (die nach Absichten) erfordern oder nicht; sondern es kann auch nicht einmal danach gefragt werden, weil der Begriff eines Naturzwecks seiner objektiven Realität nach durch die Vernunft gar nicht erweislich ist (d.i. er ist nicht für die bestimmende Urteilskraft konstitutiv, sondern für die reflektierende bloß regulativ).« (§ 74, B 330f.)
Eine ›kritische Versöhnung‹ zwischen mechanistischer und teleologischer Naturbetrachtung bleibt daher an die Bedingung gebunden, daß beide nur als spezifische Ordnungsweisen der Naturphänomene eingesetzt werden und darauf verzichten, Abschlußgedanken über den letzten Ursprung der Natur und die einzelnen Formen in ihr dogmatisch zu entfalten[54]. Man kann zwar den transzendenten Grund der Erscheinungswelt im Übersinnlichen vermuten, aber auch das wäre für Kant nicht mehr als »die Projektion eines in der Erfahrung unerreichbaren Zieles über die Grenzen der Erfahrung hinaus«[55].
3.3 Die Auflösung der Antinomie
Mit der Unterscheidung zwischen konstitutiven und regulativen Prinzipien ist die Antinomie der Urteilskraft jedoch noch nicht aufgelöst, denn diese besteht ja innerhalb der reflektierenden Urteilskraft: zwischen der generellen Notwendigkeit mechanistischer Beurteilung und ihrer punktuellen Unmöglichkeit[56]. Die Auflösung der Antinomie sieht Kant in einer ›eigentümlichen Beschaffenheit unseres Verstandes‹ (§ 77). Nicht im Erfahrungsbefund, sondern in der Funktionsweise unseres Verstandes liegt die Ursache für das Hemmnis, Organismen rein mechanisch zu erklären[57]. Schon zuvor hatte Kant darauf hingewiesen, daß Naturdinge für uns nur mechanisch erklärbar sind und wir sie deshalb so beurteilen müssen: »denn nur so viel sieht man vollständig ein, als man nach Begriffen selbst machen und zustande bringen kann« (§ 68, B 309). Wenn die Voraussetzung entfällt, daß alle Gegenstände der Erfahrung für unseren (reduktionistischen) Verstand erklärbar sein müssen, löst sich die Antinomie auf und beide Maximen können zutreffend sein[58]. Die reduktionistische Eigentümlichkeit des menschlichen Verstandes ist nach Kant nicht konstitutiv für die Gegenstände der Erfahrung, so daß diese damit nicht vollständig erfaßbar sein müssen. Daß die Ursachen sich in eine Dualität trennen - einerseits als causa efficiens (Naturmechanismus) und andererseits der causa finalis (Technik der Natur), wodurch sich die Struktur von Organismen definiert, liegt allein an unserer endlichen Auffassungsgabe: wir können nicht gleichzeitig die Einheit eines Gegenstandes anschauen und ihn unter Begriffe fassen, und wir können nicht gleichzeitig ein Objekt konstituieren und es von der Vernunft gesetzt als Endzweck auffassen[59].
Um die mechanistische Eigentümlichkeit des menschlichen Verstandes zu erläutern, führt Kant einen Vergleichsverstand ein, der gegensätzlich arbeitet:
»Unser Verstand ist ein Vermögen der Begriffe, d.i. ein diskursiver Verstand (...) Weil aber zum Erkenntnis doch auch Anschauung gehört, und ein Vermögen einer völligen Spontaneität der Anschauung ein von der Sinnlichkeit unterschiedenes und davon ganz unabhängiges Erkenntnisvermögen, mithin Verstand in der allgemeinsten Bedeutung sein würde: so kann man sich auch einen intuitiven Verstand (negativ, nämlich bloß als nicht diskursiven) denken, welcher nicht vom Allgemeinen zum Besonderen und so zum Einzelnen (durch Begriffe) geht« (§ 77, B 347).
Ein intuitiver (anschauender) Verstand - Kant nennt ihn auch intellectus archetypus - besäße die Fähigkeit, im Denken eines Gegenstandes auch dessen sinnliche Natur mitzuschaffen, d.h. seine möglichen Begriffe zur wirklichen Existenz zu bringen: alle von ihm gedachten Gegenstände können kraft dieses Denkens auch existieren[60]. D.h. sein Denken bestünde in einer intellektuellen Anschauung. Als absolut-unendlichen und absolut-schöpferischen Verstand bezeichnet ihn die Metaphysik und leitet aus ihm die Naturordnung und die Zweckmäßigkeit der Naturformen ab[61].
Der diskursive Verstand dagegen gehe vom »Analytisch-Allgemeinen (von Begriffen) zum Besonderen (der gegebenen empirischen Anschauung)« (ebd., B 348), und die Bestimmung für die Urteilskraft hängt von der Subsumption der Anschauung unter den Begriff ab. Er erschafft also nicht seine Anschauungen, sondern drückt gleichsam dem, was vom Ding an sich bei ihm ankommt, das Siegel der Kategorien auf[62]. Für ihn wäre es ein Widerspruch, das Ganze als (Real-)Grund der Möglichkeit für die Verknüpfung der Teile anzusehen, für ihn gilt, »daß die Vorstellung eines Ganzen den Grund der Möglichkeit der Form desselben und der dazu gehörigen Verknüpfung der Teile enthalte. Da das Ganze nun aber alsdann eine Wirkung (Produkt) sein würde, dessen Vorstellung als die Ursache seiner Möglichkeit angesehen wird, das Produkt aber einer Ursache, deren Bestimmungsgrund bloß die Vorstellung ihrer Wirkung ist, ein Zweck heißt: so folgt daraus, daß es bloß eine Folge der besonderen Beschaffenheit unseres Verstandes sei, wenn wir Produkte der Natur nach einer anderen Art der Kausalität, als der der Naturgesetze der Materie, nämlich nur nach der der Zwecke und Endursachen uns als möglich vorstellen, und daß dieses Prinzip nicht die Möglichkeit solcher Dinge selbst (selbst als Phänomene betrachtet) nach dieser Erzeugungsart, sondern nur die unserem Verstande mögliche Beurteilung derselben angehe.« (§77, B 350)
Für den intuitiven Verstand würde dagegen der Gegensatz zwischen ›möglich‹ und ›wirklich‹, der unsere Erkenntnis bindet, wegfallen. Der diskursive Verstand stößt auf Zufälligkeit der Naturprodukte, die er sich nur durch eine spekulative Konstruktion verständlich machen kann: es denkt sie sich analog zu einem freien Willen, der die mechanische Verkettung der Teile im Hinblick auf die Idee eines Ganzen als Zwecke der Reihe vorgeplant habe[63]. Die Auflösung der Antinomie erfolgt also durch das Argument: Bestimmte Dinge, die wir nicht mechanisch erklären können, müssen wir als künstliche Mechanismen beurteilen, die von einem Verstand bezweckt worden sind; das heißt nicht, daß es einen solchen Verstand gibt oder daß die Dinge nicht nur mechanisch sind, sondern daß wir die kausale Bedingtheit der Teile durch das Ganze nicht anders denken können[64]. Kant führt eine nicht-konstitutive Eigentümlichkeit des Verstandes ein, die wir nicht überwinden können.
So ist letztlich auch die teleologische Erklärung mit dem Mechanismus zu vereinbaren (§ 78). Auch die regulative Annahme, ein Ding sei als Naturprodukt mechanisch erklärbar, könnte in einen Widerspruch zu der Annahme geraten, auch ein Zweck sei Ursache des Produkts[65]:
»Das Prinzip, welches die Vereinbarkeit beider in Beurteilung der Natur nach denselben möglich machen soll, muß in dem, was außerhalb beider (mithin auch außer der möglichen empirischen Naturvorstellung) liegt, von dieser aber doch den Grund enthält, d.i. im Übersinnlichen gesetzt, und eine jede beider Erklärungsarten darauf bezogen werden.«(ebd., B 357).
Wenn die Gegenstände der Erfahrung Erscheinungen eines übersinnlichen Substrats sind, können wir ohne Widerspruch annehmen, daß der Mechanismus die Zwecke eines übersinnlichen Wesens ausführt. Auch der Verweis aufs Übersinnliche bleibt somit logisch und enthält keine metaphysischen Bestimmungen. Dennoch: der Zweckbegriff gibt das fehlende Einheitsprinzip an, unter dem sich die Kausalprozesse als Naturzweck ordnen lassen, und beseitigt so die Zufälligkeit des Besonderen[66]. Kant legt zwar keine dogmatische Handhabung des Zweckbegriffs nahe, scheint ihm aber doch eine ›höhere Dignität‹ als dem Mechanismus beizulegen, wenn er abschließend empfiehlt, »alle Produkte und Ereignisse der Natur, selbst die zweckmäßigsten, so weit mechanisch zu erklären, als es immer in unserem Vermögen (...) steht, dabei aber niemals aus den Augen zu verlieren, daß wir die(se), der wesentlichen Beschaffenheit unserer Vernunft gemäß, jene mechanischen Ursachen ungeachtet, doch zuletzt der Kausalität nach Zwecken unterordnen müssen.« (§ 78, B 363)
4. Schlußbemerkung
Im Gegensatz zu Leibniz holt Kant die teleologische Betrachtung aus der Metaphysik zurück in die Beurteilung von Naturphänomenen. Für Kant blieb der Zweckbegriff jedoch ein ›heuristisches Als-ob-Prinzip‹, so daß für viele Kommentatoren vor allem der ontologische Status der Naturteleologie offen und unbefriedigend blieb. Wenn der Zweckbegriff letztlich doch nur eine Idee unseres Denkens darstelle, die die Erscheinungswelt nicht übersteige und die Wirklichkeit nicht erreiche, wäre gegenüber der Kritik der reinen Vernunft nichts hinzugewonnen und die metaphysischen Dimension führe zu weiterer Problementwicklung im Idealismus[67]. Auch der Kommentar von Frank/Zanetti kommt zu dem Schluß, daß Kant an einer (ontologischen) Aporie zu scheitern drohe: Kants Verweis auf das Übersinnliche, das sowohl die mechanische als auch die teleologische Betrachtungsweise zuläßt, sei »so relativistisch, daß er mechanische Objektivität und teleologische Organizität auf die beiden Aspekte einer und derselben subjektiven Erkenntnisquelle (der reflektierenden Urteilskraft) reduziert.«[68] Wenn das Prinzip, aus dem sich gemeinschaftlich der Mechanismus und die Teleologie ableiten lassen, nur das Übersinnliche sein könne, dann könne die Existenz des Organismus nur bewiesen werden, wenn auch die Existenz des Prinzips, aus dem er sich ableitet, demonstriert würde, nämlich die Existenz der Idee. Das aber würde die Preisgabe aller kritischen Restriktionen, an denen Kant gelegen war, bedeuten. Dies habe dann Schelling in aller Radikalität vollzogen: Mechanismus und Teleologie quellen bei ihm gleichursprünglich aus der Idee der absoluten Identität der Natur und des Geistes.
Doch die ›idealistischen Problementwicklungen‹ führen zu weit in das Gebiet, das Kant als ›Dogmatismus‹ stets ablehnte. Ihm ging es darum, daß wir die Naturphänomene letztlich nicht verstehen können, wenn wir sie nicht aus einem Prinzip, das sich allerdings selbst ›spezifiziert‹[69], hervorgehend denken, und daß eine solche Beurteilung des Besonderen unerläßlich sei, um seine Struktur zu begreifen. Wendet man diese logischen (oder denkpsychologischen) Ergebnisse auf die Natur an, »so gelangen wir damit unmittelbar zu einem neuen Naturbegriff, der nicht, gleich dem Linnéschen, Arten und Klassen einfach nebeneinanderstellt und durch feste unveränderliche Merkmale voneinander abtrennt, sondern der den Zusammenhang der Natur im Übergang der Arten kenntlich zu machen sucht.«[70]
Literaturverzeichnis
Primärtext:
Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, Hamburg 2001 (KdU)
Sekundärliteratur:
Artikel: »Leben, die Seinsform von Lebewesen«, in: Der Brockhaus in Text und Bild 2002, PC-Bibliothek Version 3.0, Mannheim 2002 (8 Seiten)
Artikel: »Teleologie, teleologisch«, in: Ritter, Joachim u. Gründer, Karlfried (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie Bd. 10, Basel 1998, Sp. 970 - 977
Cassirer, Ernst: Kants Leben und Lehre, Berlin 1918
Coreth, Emerich / Schöndorf, Harald: Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts, Stuttgart/ Berlin/ Köln ²1990
Frank, Manfred / Zanetti, Véronique: Kommentar, in: Kant, Immanuel, Schriften zur Ästhetik und Naturphilosophie Bd. 3, Frankfurt am Main 1996
Klemme, Heiner F.: Einleitung, in: Kant, Immanuel, Kritik der Urteilskraft, Hamburg 2001, S. XIII - XCVII
McLaughlin, Peter: Kants Kritik der teleologischen Urteilskraft, Bonn 1989
Obermeier, Otto-Peter: Das zähe Leben eines totgesagten Seinsprinzips: Zu Kants teleologischer Urteilskraft und dem Problem zielgerichteter Prozesse in der Natur, in: Breuninger, Renate (Hrsg.): Philosophie der Subjektivität und das Subjekt der Philosophie, Festschrift für Klaus Giel zum 70. Geburtstag, Würzburg 1997, S. 243-257
Pauen, Michael: Teleologie und Geschichte in der »Kritik der Urteilskraft«, in: Klemme, Heiner F. u.a. (Hrsg.): Aufklärung und Interpretation. Studien zu Kants Philosophie und ihrem Umkreis, Würzburg 1999, S. 197-216
Spaemann, Robert / Löw, Reinhard: Die Frage Wozu? Geschichte und Wiederentdeckung des teleologischen Denkens, München ²1985
Teichert, Dieter: Immanuel Kant: »Kritik der Urteilskraft«, Paderborn 1992
Wohlers, Christian: Kants Theorie der Einheit der Welt. Eine Studie zum Verhältnis von Anschauungsformen, Kausalität und Teleologie bei Kant, Würzburg 2000
[...]
1 vgl. Cassirer, S. 292
2 vgl. Pauen, S.198
3 vgl. Cassirer, S. 303
4 vgl. Art. „Leben...“, S. 3
5 ebd.
6 ebd.; auch Kants Auffassung von Leben als „Bewegung im transzendentalen Verstande“ wird in dem Artikel als vitalistische Position erwähnt. Im Verlauf dieser Arbeit wird aber deutlich werden, daß Kants kritizistische Vorgehensweise demgegenüber gerade die ontologischen Implikationen sowohl der physikotheologischen als auch der vitalistischen Auffassung umgehen will. Das kausal-mechanistische Forschungsprogramm der Naturwissenschaft steht für ihn völlig außer Frage.
7 ebd., S. 4
8 wenngleich die großen idealistischen Systeme eines Schelling oder Hegel nach Kant auch die lebendige Natur onto-theologisch eingebunden haben. Vgl. auch Frank/Zanetti S. 1265: »Wer sich (wie die spekulative idealistische Naturphilosophie) über die kritizistische Beschränkung auf den Als-ob-Charakter teleologischer Annahmen über das Gesamt des Naturprozesses kühn hinwegsetzt, hätte in Kants Augen die Analogie als eine Identitäts-Anzeige verkannt«
9 vgl. McLaughlin, S. 5
10 ebd., S 4
11 ebd., S. 5
12 so eine gelungene Formulierung im Art. »Teleologie«, Sp. 970
13 ebd., Sp. 970f. (KrV B 714-717)
14 Cassirer, S. 303
15 vgl. Klemme, S. XXXII
16 ebd., S. XXXIIIf.
17 Frank/Zanetti, S. 1264: es handelt sich um einen Analogieschluß, weil zwischen der (unterstellten) Zweckmäßigkeit von Naturorganismen und der Absichtlichkeit menschlicher Intentionen keine Identität besteht, sondern allenfalls eine Ähnlichkeit.
18 Cassirer, S. 357
19 vgl. McLaughlin, S. 38
20 vgl. Pauen, S. 202
21 vgl. McLaughlin, S. 39
22 vgl. Teichert, S. 106
23 ebd., S. 107
24 vgl. McLaughlin, S. 41
25 vgl. Klemme, S. LXXIV
26 vgl. McLaughlin, S 42
27 vgl. dazu Obermeier, S. 252: »Kant nimmt hier, genauso wie jene Theoretiker der Autopoiese (Maturana und Varela, H.O.), die alte Differenzierung auf zwischen Artefakten, zwischen vom Menschen zweckvoll Hergestelltem (Uhr) und der sich selbst erzeugenden, autopoietischen Natur.«
28 vgl. McLaughlin, S. 43
29 ebd.
30 vgl. Frank/Zanetti, S. 1270. Dort wird die Relevanz, die die Teleologie für Kant hat, gut verdeutlicht: »Die Logik, in der sich Kants Argumentation entfaltet, geht von der Analyse der Struktur von Organismen zu ihrer äußeren Beziehung und von dort zur Ausweitung der teleologischen Erklärung auf Evolution und Geschichte der Menschheit« (ebd., S. 1271)
31 ebd., S. 1274
32 ebd., S. 1275. Nur ermöglicht es das Phänomen der Selbstorganisation, das Kant hier beschreibt, rein wissenschftstheoretisch nicht, »sich einfach durch einen salto mortale rückwärts aus der Affäre zu ziehen und einen Schöpfergott als Instanz zu benennen, der die Zwecke der Natur bestimmt hat« (Teichert, S. 109)
33 vgl. McLaughlin, S. 46f.
34 Dieses Prinzip der Selbstorganisation bezeichnen Frank/Zanetti als »revolutionär« (S. 1277)
35 ebd., S. 1281
36 Cassirer, S.359
37 vgl. Frank/Zanetti, S. 1285
38 diese Kapitelüberschrift habe ich von McLaughlin übernommen (S. 47). Seiner Auffasung nach macht Kant in diesem Abschnitt »aus der Not eine Tugend«. Da man in der Naturwissenschaft ohne teleogische Ausdrücke ohnehin nicht auskomme, empfehle Kant, sie so viel zu benutzen wie möglich, um dem Mechanismus auf die Spur zu kommen. Teleologische Prinzipien sollen aber nur als Maximen benutzt werden.
39 vgl. Klemme, S. LXXXVI
40 ebd.
41 wie auch in der Kritik der reinen Vernunft erweist sich Kant damit als der (erste?) Philosoph, der - soziologisch formuliert - die Ausdifferenzierung der Wissenschaft explizit bestimmt. Oder wenn man innerhalb der Kantischen Argumentation bleibt, könnte man sagen: »Das Verständnis der Natur als selbst zwecklosem System der Zwecke ist eine Teleologie ohne Theologie.« (Wohlers., S. 189)
42 vgl. McLaughlin, S. 48
43 ebd., S. 117
44 ebd.
45 ebd., S. 118
46 während es in der Kritik der reinen Vernunft darum ging, die (realontologische) Auffassung, die Welt sei als ›Ding an sich‹ erkennbar, als unbegründet zu entlarven und nachzuweisen, daß uns die Welt nur als Erscheinung zugänglich ist (ebd.)
47 vgl. Frank/Zanetti, S. 1285
48 ebd., S. 1286
49 vgl. McLaughlin, S. 123.
50 vgl. Frank/Zanetti, S. 1287 u. McLaughlin, S. 124f.
51 vgl. McLaughlin, S. 125
52 «Dies hat rezeptionsgeschichtlich den Anlaß zu den verschiedenen Mißverständnissen gegeben«, merkt McLaughlin an (S. 143). Er stellt diese ausführlich dar (S. 125ff.). Nach seiner Auffassung gibt es - auch von namhaften Interpreten »keine auch nur halbwegs befriedigende Analyse der Dialektik der teleogischen Urteilskraft, auch keine einigermaßen plausible Erklärung dessen, was Kant möglicherweise habe sagen wollen.« (S. 120). Er versucht diesen Mangel zu beheben, und da ihm das m.E. gut gelingt, folgt diese Arbeit weitgehend seiner Auslegung.
52 vgl. McLaughlin, S. 144
54 vgl. Cassirer, S. 370
55 ebd., S. 371. Kant argumentiert hier gegen die metaphysische Überhöhung sowohl des Mechanismus als auch der Teleologie in der Naturwissenschaft, wie es in dem berühmten Zitat zum Ausdruck kommt: Wir könnten »organisierte Wesen und deren innere Möglichkeit nach bloß mechanischen Prinzipien der Natur nicht einmal zureichend kennen lernen, viel weniger uns erklären«, und es sei abwegig zu hoffen, »daß noch etwa dereinst ein Newton aufstehen könne, der auch nur die Erzeugung eines Grashalms nach Naturgesetzen, die keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen werde; sondern man muß diese Einsicht den Menschen schlechterdings absprechen.« (§ 75, B 337f.)
56 vgl. McLaughlin, S. 146
57 vgl. Frank/Zanetti, S. 1291
58 vgl. McLaughlin, S. 147
59 vgl. Frank/Zanetti, S. 1295
60 ebd., S. 1294
61 vgl. Cassirer, S. 373
62 ebd., S. 1296
63 vgl. Frank/Zanetti, S. 1301
64 vgl. McLaughlin, S. 152
65 ebd., S 159
66 vgl. Spaemann/Löw, S.136
67 vgl. Coreth/Schöndorf, S. 143
68 Frank/Zanetti, S. 1304
69 vgl. Cassirer, S. 380
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument ist eine umfassende Analyse von Kants »Kritik der Urteilskraft«, insbesondere des Teils, der sich mit der teleologischen Urteilskraft beschäftigt. Es behandelt die Verbindung von Ästhetik und Naturteleologie in Kants Werk und untersucht, inwiefern teleologische Prinzipien bei der Erklärung von Organismen notwendig und zulässig sind. Das Dokument bietet eine detaillierte Zusammenfassung der Hauptthemen, Argumente und Konzepte in Kants Text, einschließlich der reflektierenden Urteilskraft, der objektiven Zweckmäßigkeit, der Organismus-Theorie und der teleologischen Maximen.
Was sind die Hauptthemen, die im Dokument behandelt werden?
Die Hauptthemen umfassen:
- Die Beziehung zwischen Ästhetik und Naturteleologie bei Kant.
- Die kritische Untersuchung der Urteilskraft und ihr Prinzip der Zweckmäßigkeit.
- Die Auseinandersetzung mit mechanistischen und vitalistischen Auffassungen des Lebens.
- Die Rolle teleologischer Prinzipien bei der Erklärung von Organismen.
- Die Bedeutung des Begriffs der objektiven Zweckmäßigkeit.
- Die Theorie der Organismen als Naturzwecke.
- Die Dialektik der teleologischen Urteilskraft und die Auflösung der Antinomie.
- Die Vereinbarkeit von mechanistischer und teleologischer Naturbetrachtung.
Was ist die reflektierende Urteilskraft nach Kant?
Die reflektierende Urteilskraft wird als das Vermögen definiert, das Allgemeine zu gegebenem Besonderen zu suchen. Im Gegensatz zur bestimmenden Urteilskraft, die das Besondere unter ein gegebenes Allgemeines subsumiert, bedarf die reflektierende Urteilskraft noch eines Prinzips der Einheit des Mannigfaltigen, das sie sich selbst gibt. Dieses Einheitsprinzip ist dasjenige der Zweckmäßigkeit der Natur in ihrer Mannigfaltigkeit.
Was versteht Kant unter objektiver Zweckmäßigkeit?
Objektive Zweckmäßigkeit bezieht sich auf die zielgerichtete Organisation und Struktur von Naturdingen, insbesondere Organismen. Kant unterscheidet zwischen formaler und materialer Zweckmäßigkeit, wobei letztere in äußere (relative) und innere (absolute) Zweckmäßigkeit unterteilt wird. Naturzwecke, die objektiv-material-innere Zweckmäßigkeit darstellen, bilden den Kern seiner Analyse.
Was ist die Organismus-Theorie in Kants Kontext?
Die Organismus-Theorie besagt, dass Organismen als Naturzwecke betrachtet werden müssen, was bedeutet, dass sie von sich selbst Ursache und Wirkung sind. Kant illustriert dies am Beispiel eines Baumes und nennt drei Weisen der (Selbst-)Reproduktion eines Systems: Fortpflanzung, Wachstum und gegenseitige Abhängigkeit der Teile voneinander und vom Ganzen.
Was sind teleologische Maximen?
Teleologische Maximen sind regulative Prinzipien der Urteilskraft, die dazu dienen, die innere Zweckmäßigkeit organisierter Wesen zu beurteilen. Ein solches Prinzip besagt beispielsweise, dass in einem organisierten Produkt der Natur alles Zweck und wechselseitig Mittel ist.
Was ist die Antinomie der teleologischen Urteilskraft und wie wird sie aufgelöst?
Die Antinomie der teleologischen Urteilskraft ergibt sich aus dem scheinbaren Widerspruch zwischen der Maxime, dass alle Erzeugung materieller Dinge nach bloß mechanischen Gesetzen möglich beurteilt werden muss, und der Maxime, dass einige Produkte der materiellen Natur nicht nach bloß mechanischen Gesetzen möglich beurteilt werden können. Die Auflösung der Antinomie liegt in der Unterscheidung zwischen einem diskursiven Verstand (unserem) und einem intuitiven Verstand (intellectus archetypus) und der Erkenntnis, dass die teleologische Beurteilung eine Folge der besonderen Beschaffenheit unseres Verstandes ist.
Wie vereinbart Kant mechanistische und teleologische Naturbetrachtung?
Kant vereinbart mechanistische und teleologische Naturbetrachtung, indem er beide als spezifische Ordnungsweisen der Naturphänomene einsetzt, die darauf verzichten, Abschlußgedanken über den letzten Ursprung der Natur und die einzelnen Formen in ihr dogmatisch zu entfalten. Der Verweis auf das Übersinnliche ermöglicht es, ohne Widerspruch anzunehmen, dass der Mechanismus die Zwecke eines übersinnlichen Wesens ausführt.
Welche Schlussfolgerung zieht das Dokument über Kants teleologische Urteilskraft?
Das Dokument schließt, dass Kant die teleologische Betrachtung aus der Metaphysik zurück in die Beurteilung von Naturphänomenen holt. Obwohl der Zweckbegriff ein heuristisches Als-ob-Prinzip bleibt, ermöglicht er ein tieferes Verständnis der Struktur von Naturdingen und führt zu einem neuen Naturbegriff, der den Zusammenhang der Natur im Übergang der Arten kenntlich zu machen sucht.
- Citation du texte
- Heike Obermanns (Auteur), 2002, Kants Analytik und Dialektik der teleologischen Urteilskraft in seiner Kritik der Urteilskraft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107219