Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung und Begriffsbestimmung
2. Zur Physiologie des Geschmacks
2.1. Geschmack als „niederer“ Sinn
2.2. Die Aufgaben des Geschmackssinns
3. Der kulinarische Geschmack
3.1. Die künstliche Horizontverengung
3.2. Die kulturelle Formung des Geschmacks
3.3. Präferenzen und Aversionen beim Essen
3.4. Essgeschmack und Essgenuss
4. Der soziale Gebrauch des Geschmacks
4.1. Geschmack als soziales Ordnungskriterium
4.2. Geschmack als Lebensstil
4.3. Geschmack als Mittel zur Ausgrenzung
5. Schluss
6. Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Einleitung und Begriffsbestimmung
Der Terminus Geschmack[1] findet in zwei zum Teil ineinander greifenden Bereichen Verwendung:
Die Physiologie versteht unter Geschmack bzw. Geschmacks- oder Schmecksinn den „insbesondere der Nahrungsprüfung dienende[n] chem[ischen] Sinn“ der es allen Wirbeltieren und dem Menschen erlaubt, die Geschmacksqualitäten süß, sauer, bitter und salzig zu unterscheiden, wobei bitter meist mit Ablehnung verbunden ist. Zu den Geschmacksqualitäten wird neuerdings auch umami gezählt, eine hauptsächlich durch die Aminosäure Glutamat hervorgerufene und für einen Teil des typischen Fleischgeschmacks verantwortliche Qualität (Brockhaus 2006: 619). Als Geschmack kann weiters der mit der gustatorischen Wahrnehmung verbundene Sinneseindruck bezeichnet werden, der bei der Nahrungsaufnahme entsteht.
Die Ästhetik betrachtet Geschmack bzw. guten Geschmack als „das Vermögen, Schönes und Hässliches zu unterscheiden und zu beurteilen“. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts beschäftigt sich die ästhetische Diskussion mit den Fragen, ob Geschmack angeboren oder erworben ist, ob Geschmack auf Verstand oder Sinnlichkeit gegründet ist und ob Geschmacksurteile individuell oder allgemein gültig sind (Brockhaus 2006: 618).
Kaufmann beschreibt die Geschichte des Geschmacks in drei Abschnitten: In der ersten Phase dominiert eine religiöse Ordnung die Auswahl der Nahrungs-mittel und räumt Geschmacksempfindungen nur einen untergeordneten Stellenwert ein. In der zweiten Phase lässt sich „das Aufkommen des subversiven Genusses“ beobachten, dessen „zügellose Explosion“ Kodes und Hierarchien festlegt, die den Geschmack in geordnete Bahnen lenken. Der „gute Geschmack“ erlangt zentrale Bedeutung für das Handeln des Individuums und wird zum Instrument für die Klassifizierung und die Einführung der sozialen Unterschiede. Die dritte Phase lässt sich gegenwärtig festmachen. Eine Steigerung der Wahlmöglichkeiten ins nahezu Unermessliche nötigt den Esser dazu, seinen Geschmack - um der drohenden Unentschiedenheit zu entgehen - stärker festzulegen. Er lässt sich von wiederkehrenden Gewissheiten leiten und bezieht daraus Schutz und Sicherheit. Der Geschmack wird in dieser Phase als „mächtiger inkorporierter sozialer Regulator“, als „objektiv, naturgegeben und essentiell“ erlebt. Das Individuum gibt sich nach Kaufmann der Illusion hin, dass nicht es selbst seinen Geschmack definiert, sondern von ihm definiert wird und ist in Wirklichkeit jedoch „hin und her gerissen zwischen seinem Denken und seinem Geschmack“ (2006: 43-45).
In der vorliegenden Hausarbeit sollen sowohl der physiologische als auch der ästhetische Geschmack sowie deren gegenseitige Beeinflussung betrachtet werden. Der Geschmackssinn, der in den meisten Sinnestheorien zu den niederen, leibnahen und gefühlsgebundenen Sinnen gezählt wird, steht in dem Ruf, verglichen mit anderen Sinnen, physiologisch extrem unterentwickelt zu sein und nur einen geringen Beitrag zum Erkennen der Welt leisten zu können. In deutlichem Widerspruch zu diesen wissenschaftlichen Charakterisierungen steht der gesellschaftliche Gebrauch des Geschmacks, der „eng mit der ästhetischen Urteilskraft und dem Vermögen, zu verallgemeinerungsfähigen Urteilen zu gelangen“, verbunden ist (Barlösius 2000: 59-62).
Die vorliegende Arbeit wurde vom Reader zum Präsenzseminar „Philosophie des Kulinarischen“ (Röttgers/Konersmann 2008) inspiriert und kann nicht umhin, sich einen Vergleich einzuverleiben, den Rigotti zwischen Philosophie und Kochen zieht. Nach Rigotti ist die Wechselbeziehung zwischen Einheit und Vielfalt, aus der die Philosophie ihre Themen und ihre disziplinäre Besonderheit entwickelt hat, das „Zergliedern, Entgegensetzen und neu Zusammenfügen, unter dem Einfluss von Ahnungen, Eingebungen und tiefen Notwendigkeiten“, auch in der Küche zu beobachten: „Bestehen Zubereitung des Essens und Kochen nicht eben im Zerlegen und neu Zusammensetzen, im Mahlen und Verrühren, im Schneiden und Vermischen?“ (2003: 52-54) Genau diese Operationen sollen auch in dieser philosophischen Hausarbeit Anwendung finden und eine Vielfalt an gedanklichen Zutaten, sprichwörtlich „Kraut und Rüben“, zu einer abgerundeten Einheit zusammenfügen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Physiologie des Geschmacks und beleuchtet zum einen Sinnestheorien, die den Geschmack als „niederen“ Sinn klassifizieren und zum anderen Meinungen, die den Geschmack zu „Höherem“ berufen sehen. Weiters stehen die Aufgaben des Geschmackssinns im Mittelpunkt der Betrachtung.
Das dritte Kapitel nimmt den kulinarischen Geschmack in den Blick. Im ersten Unterkapitel wird Plessners Theorie der künstlichen Horizontverengung auf den Bereich der Nahrungsmittelauswahl umgelegt und beschrieben, warum Esskulturen selektiv, isoliert und interessensgebunden sind. Im zweiten Unterkapitel wird die kulturelle Formung des Geschmacks, die eng mit gastronomischen Traditionen, gesundheitlichen, religiösen, moralischen und gruppen-dynamischen Aspekten verbunden ist, betrachtet. Das dritte Unterkapitel konzentriert sich auf Präferenzen und Aversionen beim Essen, die sich einerseits durch ein Zusammenspiel von Neophilie und Neophobie ergeben sowie andererseits auf kulturelle, soziale, genetische oder biologische Bedingungen zurückzuführen sind. Das vierte Unterkapitel nimmt Stellung zu Essgeschmack und Essgenuss. Untersucht werden zum einen die Voraussetzungen für ihre Entstehung sowie zum anderen die Dynamik zwischen individuellen und kulturellen Geschmackszuschreibungen.
Der Inhalt des vierten Kapitels analysiert den sozialen Gebrauch des Geschmacks. Im Unterkapitel „Geschmack als soziales Ordnungskriterium“ werden einerseits Nahrungsmittel als Symbole der gesellschaftlichen Differenzierung untersucht und andererseits wird die Fähigkeit des Geschmacks als Aus-drucksmittel sozialer Differenzen beleuchtet. Das Unterkapitel „Geschmack als Lebensstil“ konzentriert sich auf Bourdieus Studie „Die feinen Unterschiede“, die soziale Gruppen in den Blick rückt, die sich augenscheinlich durch ihren Geschmack und Lebensstil unterscheiden, sowie auf Schulzes Theorie der Erlebnisgesellschaft, in der Erlebnispräferenzen, Stilfragen, Genussweisen und Geschmackssachen ausschlaggebend für die Zuordnung von Individuen zu fünf beschriebenen Milieus sind. Das Unterkapitel „Geschmack als Mittel zur Ausgrenzung“ beschäftigt sich mit dem Einsatz des Geschmacks als „Waffe“ zur Verteidigung einer privilegierten Stellung. Beleuchtet werden die Anstrengungen des Adels im 17. Jahrhundert, sich gegenüber dem aufstrebenden Bürgertum abzugrenzen, Bourdieus Theorie der Distinktion, der ostentative Konsum von Genussmitteln als Demonstration von Status und Exklusivität, die Selbstausgrenzung der Pythagoreer in ihrer Entscheidung für vegetarische Ernährung als Protest gegen die bestehende soziale Hierarchie sowie abschließend die Abwertung fremder Kochpraktiken am Beispiel der Migrationsküchen.
Das fünfte Kapitel, der Schluss, fasst zentrale Erkenntnisse dieser Hausarbeit zusammen.
2. Zur Physiologie des Geschmacks
2.1. Geschmack als „niederer“ Sinn
Die meisten Sinnestheorien hierarchisieren die fünf Sinne entlang ihres Beitrags zur intellektuellen Aneignung und Zivilisierung der menschlichen Umwelt, wobei üblicherweise der Erkenntnisfunktion ein Vorrang vor anderen Fähigkeiten, etwa der Evokation von Lust-, Genuss- oder Ekelempfindungen, eingeräumt wird. Demnach werden der Gesichts- und der Hörsinn als höhere und leibferne Sinne klassifiziert und aufgrund der ihnen zugeschriebenen Fähigkeit zur Intellektualisierung und objektivierenden Erkenntnis der Gruppe der Nahsinne übergeordnet (Barlösius 2000: 62).
Zu den Nahsinnen, den niederen, leibnahen und gefühlsgebundenen Sinnen, werden der Tast-, der Geruchs- und der Geschmackssinn zusammengefasst. Gemeinsam ist ihnen zum einen die Erfahrbarkeit der sinnlichen Qualitäten des Wahrzunehmenden nur durch direkten Kontakt und zum anderen die Emotionalität bei der Begegnung mit diesem, die eine objektive Wahrnehmung und Versprachlichung der Empfindungen behindert. Der Geschmack steht, verglichen mit den anderen Sinnen, zudem in dem Ruf, physiologisch extrem unter-entwickelt zu sein, da er nur vier Qualitäten[2] - süß, sauer, salzig und bitter - unterscheiden und nur wenig dazu beitragen könne, die Welt zu erkennen (Barlösius 2000: 59-62).
Die traditionelle Sinneslehre (Aisthetik) beschreibt den Geschmackssinn als „affektiven, subjektiven Nahsinn“, weil die wahrgenommenen Dinge auf den schmeckenden Menschen physisch einwirken und in sein Leibinneres eindringen. Durch die Notwendigkeit, sich zu ernähren, ist der Mensch gezwungen, die Außenwelt in sich aufzunehmen, was ihn zu einem passiv erleidenden Wesen macht und seiner Bestimmung als „geistiges Wesen“ zuwider läuft (Lemke 2007: 155).
Nach Burdach erscheinen die chemosensorischen Funktionen Riechen und Schmecken im Vergleich zu der visuellen und auditiven Wahrnehmung „primitiv, subjektiv und wenig leistungsfähig“. Als primitiv können sie bezeichnet werden, weil sie in der Evolution wesentlich früher auftraten als die anderen Wahrnehmungsfunktionen, weil sie die einzigen Wahrnehmungskanäle sind, die auch von sämtlichen bekannten Tierarten genutzt werden und zudem mit den ebenfalls „niederen“ Instinkten Nahrungsaufnahme und Sexualität in Zusammenhang stehen. Subjektiv und unzuverlässig sind sie durch ihre enge Verknüpfung mit den körperlich-vitalen Funktionen: So kann z. B. ein eben noch als angenehm empfundener Geschmack oder Geruch nach Übersättigung Ekel hervorrufen. Die geringe Effizienz ergibt sich aus einem Vergleich mit der Leistungsfähigkeit der audiovisuellen Wahrnehmungskanäle. Während Geruchs- und Geschmackssinn nur Objekte intern abbilden können, die sich in unmittelbarem Kontakt bzw. in der näheren Umgebung des wahrnehmenden Subjekts befinden, kann das Gehör, z. B. bei einem Gewitter, Entfernungen von mehreren Kilometern und der Gesichtssinn bei der Betrachtung von Himmelskörpern sogar Distanzen von vielen Lichtjahren überwinden (1988: 9-10).
Lemke betrachtet die geschmackliche Wahrnehmung nicht (nur) als „primitiv, subjektiv und wenig leistungsfähig“ (Burdach), sondern durchaus auch als geistartig, weil sie, wie der Gesichts- und der Hörsinn, „viel Erkenntnis zu geben und viele Unterschiede aufzudecken“ vermag und nicht bloß differenziert zwischen genießbar und ungenießbar oder wohlschmeckend und Ekel er-regend (2007: 156 bzw. 158).
In deutlichem Widerspruch zu den wissenschaftlichen Charakterisierungen des Geschmackssinnes sieht auch Barlösius dessen realen gesellschaftlichen Gebrauch. Der Geschmack ist „eng mit der ästhetischen Urteilskraft und dem Vermögen, zu verallgemeinerungsfähigen Urteilen zu gelangen“ verbunden und gilt als „legitimes Kriterium, um eine kulturelle oder künstlerische Wahl zu treffen“ (2000: 59-61).
2.2. Die Aufgaben des Geschmackssinns
Der Geschmackssinn, das gustatorische System, ist - wie auch der Geruchssinn - ein chemischer Sinn. Beim Schmecken reagieren Rezeptorzellen auf gelöste Moleküle, die mit der Zunge in Berührung kommen[3]. Neben der olfaktorischen ist die gustatorische Wahrnehmung für das Überleben eines Alles(fr)essers (Omnivores) von entscheidender Bedeutung. Da der Mensch als unspezifisches und weltoffenes Lebewesen auf kein bestimmtes Milieu und auf keinen bestimmten Speisezettel festgelegt ist (Gehlen 2004: 38), müssen Nahrungs-mittel und Flüssigkeiten so identifiziert werden, dass giftige Stoffe vermieden und Speisen bzw. Getränke mit hohem Nährwert herausgefunden werden können. Die Geschmacksrezeptoren auf der Zunge tragen dazu bei, das Schlucken und Verdauen von unerwünschten oder schädlichen Stoffen zu verhindern. Der Geruchssinn lehnt eine Speise oft schon im Vorfeld ab, so dass sie erst gar nicht den Weg in den Mund findet (Logue 1995: 99-101).
Der Geschmack hat eine Schutzfunktion. So sendet er z. B. Alarmzeichen aus, wenn er auf bittere Stoffe stößt. Das Misstrauen gegenüber bitteren Substanzen als Warnung vor möglicher (tödlicher) Gefahr ist genetisch prädisponiert. Obwohl bei der Geschmackswahrnehmung im Kontext der Nahrungsaufnahme in der Regel die Signale unterschiedlicher sensorischer Systeme zu einem Gesamteindruck verschmolzen werden, kann die Identifikation der potentiellen Bedrohung durch bittere Stoffe oft nur über das gustatorische System erfolgen (Kaufmann 2006: 16-17). Im Normalfall werden die visuelle Voruntersuchung des Objekts, die Prüfung seiner Dufteigenschaften, die gustatorischen, taktilen, akustischen (z. B. bei knusprigen Speisen), nasal- und trigeminalen Sensationen sowie Temperaturempfindungen zu einem subjektiv einheitlichen Geschmackseindruck verarbeitet (Burdach 1988: 102). Pflanzen und Tiere, die bei dieser Prüfung als essbar bewertet werden, erhalten den Status eines Lebensmittels (Barlösius 1999: 93).
Nach Barlösius ist der Geschmack nicht nur „ein Sinn, der Informationen über seine Umwelt sammelt, sondern er ist [...] eine Aneignungsweise von Umwelt“, da Schmecken und Einverleiben untrennbar miteinander verbunden sind. Jede Speise muss, bevor sie geschluckt wird, die Schranke des Geschmacks passieren, und das gelingt in der Regel nur Speisen, die Genuss versprechen. Der Geschmack hat nicht nur die Funktion, vor giftigen, verdorbenen oder ungenießbaren Nahrungsmitteln zu warnen, sondern er sorgt auch für lukullische Freuden. In jedem Fall nimmt er eine qualitative Prüfung vor, ob das zum Verzehr bestimmte Nahrungsmittel das ist, was es vorgibt zu sein und ob es identisch ist mit bereits getesteten Vergleichsobjekten (1999: 81). Der menschliche Geschmack ist darauf trainiert, „Ähnlichkeiten und Unterschiede in kleinsten Nuancen zu ermitteln, um zu prüfen, ob die Empfindungen dem Erwarteten und Gewohnten entsprechen“. So ist das Kochrezept das kulturelle Instrument, das garantiert, dass eine Speise immer wieder identisch schmeckt (Barlösius 2000: 81-83).
[...]
[1] von ahd. gismac bzw. mdh . gesmac „Geruch, Geschmack(ssinn)“: „Fähigkeit zu schmecken, ästhetisches Urteilsvermögen“ (Etymologisches Wörterbuch des Deutschen A-L 1993: 437).
[2] Neuere Forschungsarbeiten betrachten umami als fünfte Geschmacksqualität (Brockhaus 2006: 619).
[3] Im Gegensatz zum allgemeinen Sprachgebrauch, der in verschiedenen Redewendungen dem Gaumen Bedeutung im Zusammenhang mit der gustatorischen Wahrnehmung zuspricht - z. B. in Form von Gaumenfreuden, Gaumenkitzel oder einem feinen Gaumen - ist es die Zunge, die für lukullische Genüsse verantwortlich zeichnet (Burdach 1988: 46).
- Arbeit zitieren
- Karin Heiduck (Autor:in), 2008, Über den Geschmack - physiologisch und ästhetisch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125525
Kostenlos Autor werden









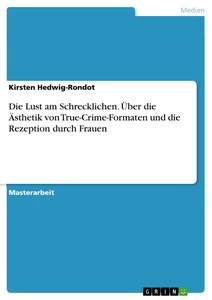










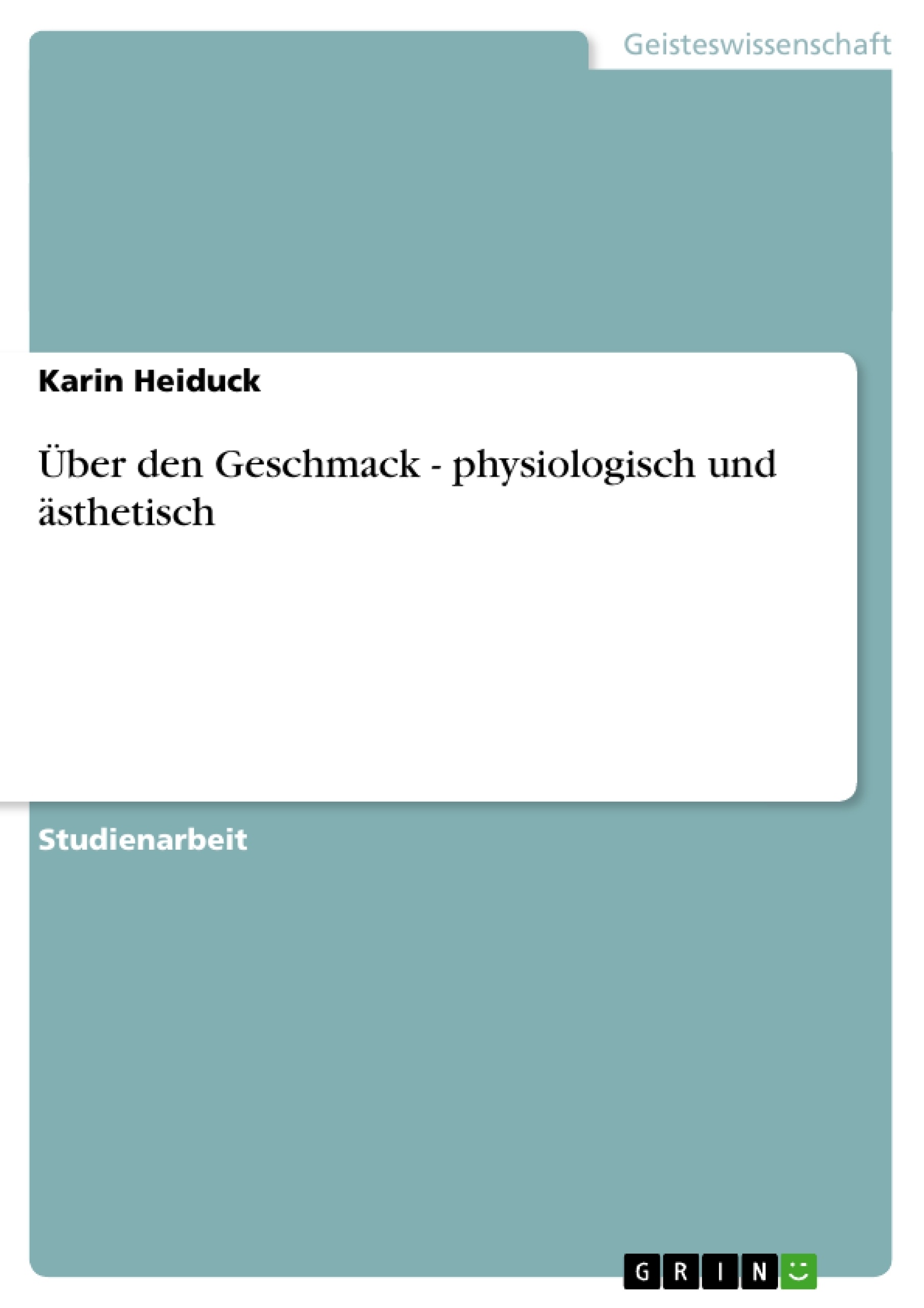

Kommentare