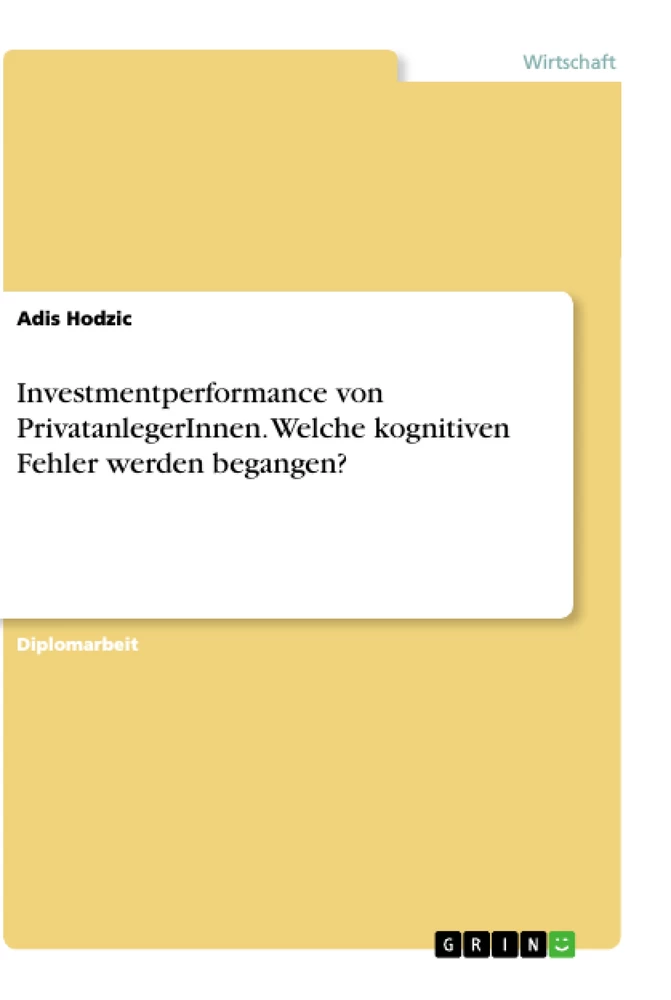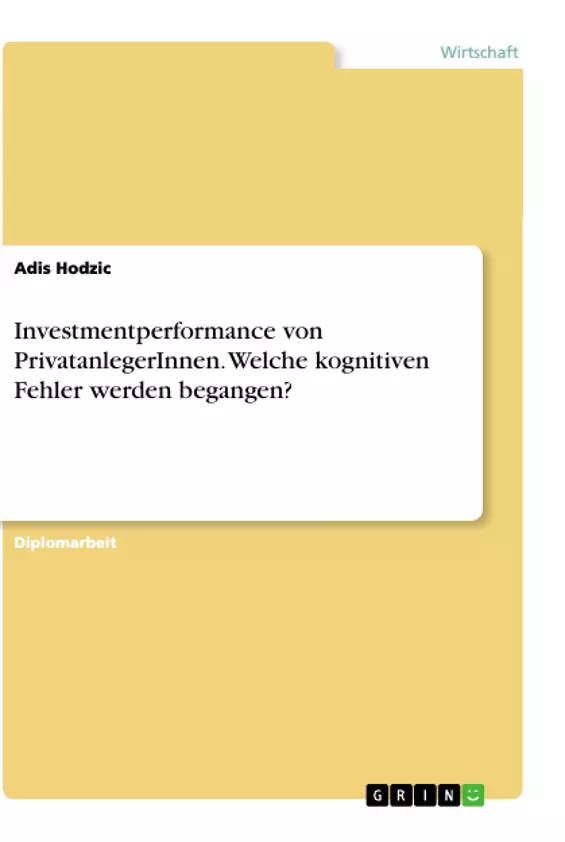Das Thema der vorliegenden Arbeit ist die Investmentperformance von PrivatanlegerInnen. Das Ziel der Arbeit besteht darin, aufbauend auf einem theoretischen Hintergrund, die Ursachen, die Performance und das Risiko wie auch die Handlungsempfehlungen für die fehlerbehafteten Verhaltensweisen der PrivatanlegerInnen eingehend zu analysieren. Die Forschungsfrage lautet: Welche kognitiven Fehler begehen die PrivatanlegerInnen, wenn es darum geht, dass sie ihr Geld veranlagen? Es werden Phänomene oder Verhaltensweisen, die in der Behavioral Finance bekannt sind, aufgezeigt, die im Zuge der Veranlagung/Investitionen einen bedeutenden Einfluss auf das Verhalten der PrivatanlegerInnen haben. Darüber hinaus wird dargelegt, wie sich diese Verhaltensweisen auf die Performance der PrivatanlegerInnen auswirken. Es werden zudem auch Ursachen, die sich für das anomal, entgegen der traditionellen Ökonomik, geprägte Verhalten der PrivatanlegerInnen identifizieren lassen und deren Einfluss auf bestimmte Verhaltensmuster ausführlich erläutert.
Es werden die Ursachen, das Risiko und die Performance sowie Handlungsempfehlungen diskutiert. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass PrivatanlegerInnen durch Phänomene und/oder Verhaltensweisen, die in der Behavioral Financebeheimatet sind, oft fehlerhafte Investitionen/Veranlagungen begehen. Die PrivatanlegerInnen sind daher gegenüber den institutionellen AnlegerInnen/InvestorInnen im Nachteil. Sie verfügen selten über wertvolle Informationen, handeln oft irrational, selbst überschätzt, lassen sich von ihren Emotionen zu fehlerbehaftetem Trading verleiten, investieren in ihnen bekannte Unternehmen und halten unterdiversifizierte Portfolios. Darüber hinaus haben sie Angst vor Verlusten, möchten Reue und Bedauern um jeden Preis verhindern und handeln bei zukünftigen Finanzentscheidungen basierend auf Ergebnissen aus der Vergangenheit. Dies führt dazu, dass die PrivatanlegerInnen in ihren Anlagen meistens eine negative Performance aufweisen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- Traditionelle Ökonomik
- Klassische Entscheidungstheorie
- Rationalität und Nutzen
- Homo Oeconomicus
- Risikoaversion
- Moderne Portfoliotheorie
- Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- Markteffizienzhypothese
- Behavioral Finance
- Prospect Theory
- Mental Accounting
- Framing
- Heuristiken
- Repräsentativitätsheuristik (respresentativeness)
- Verfügbarkeitsheuristik (availability)
- Ankerheuristik (anchoring)
- Herdenverhalten
- Dispositionseffekt
- Selbstüberschätzung (overconfidence)
- Falsche Einschätzung der Wahrscheinlichkeiten (miscalibration)
- Selbstzuschreibung (self attribution)
- Kontrollillusion (illusion of control)
- 2. Warum entsteht das Herdenverhalten unter PrivatanlegerInnen?
- Performance und das Risiko
- Ursachen
- Handlungsanleitungen
- 3. Warum kaufen die PrivatanlegerInnen schlechte Finanzprodukte?
- Performance und das Risiko
- Ursachen
- Handlungsanleitungen
- 4. Warum kaufen PrivatanlegerInnen höchstspekulative Wertpapiere bzw. Lotterie-Aktien?
- Performance und das Risiko
- Ursachen
- Handlungsanleitungen
- 5. Warum veräußern die PrivatanlegerInnen die Gewinneraktien vor den Verliereraktien?
- Performance und das Risiko
- Ursachen
- Handlungsanleitungen
- 6. Warum neigen die PrivatanlegerInnen oft zu sensationssuchendem Verhalten und zur Selbstüberschätzung?
- Performance und das Risiko
- Ursachen
- Handlungsanleitungen
- 7. Was sind Gründe dafür, dass die PrivatanlegerInnen unterdiversifizierte Portfolios halten?
- Performance und das Risiko
- Ursachen
- Handlungsanleitungen
- 8. Warum nützen die PrivatanlegerInnen die technische Analyse?
- Performance und das Risiko
- Ursachen
- Handlungsanleitungen
- 9. Warum bevorzugen PrivatanlegerInnen Wertpapiere aus dem eigenen Land?
- Performance und das Risiko
- Ursachen
- Handlungsanleitungen
- 10. Wie wirken sich die Emotionen der PrivatanlegerInnen auf deren Investments und die Performance aus?
- Performance und Risiko
- Ursachen
- Handlungsanleitungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Anlageentscheidungen von Privatanlegerinnen und analysiert, warum diese oft von irrationalem Verhalten geprägt sind. Sie beleuchtet die Gründe für abweichendes Verhalten von den Prinzipien der traditionellen Ökonomik und der modernen Portfoliotheorie und analysiert die Auswirkungen auf die Performance der Investments.
- Einfluss von Behavioral Finance auf Anlageentscheidungen
- Analyse von Anlagefehlern und irrationalem Verhalten von PrivatanlegerInnen
- Zusammenhang zwischen Anlageverhalten und Performance
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für PrivatanlegerInnen
- Bedeutung von Emotionen und kognitiven Verzerrungen für Anlageentscheidungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung: Dieses Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen der traditionellen Ökonomik und der modernen Portfoliotheorie dar. Es führt die Konzepte von Rationalität, Nutzen, Risikoaversion und dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) ein und liefert einen Überblick über die Entwicklung des Behavioral Finance.
- Kapitel 2: Warum entsteht das Herdenverhalten unter PrivatanlegerInnen?: Dieses Kapitel untersucht das Phänomen des Herdenverhaltens bei PrivatanlegerInnen und analysiert die Ursachen, die zu diesem Verhalten führen. Es diskutiert die Auswirkungen des Herdenverhaltens auf die Performance der Investments und gibt Handlungsanleitungen für PrivatanlegerInnen.
- Kapitel 3: Warum kaufen die PrivatanlegerInnen schlechte Finanzprodukte?: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, warum PrivatanlegerInnen oft in schlechte Finanzprodukte investieren. Es analysiert die Ursachen dieses Verhaltens, die zu Verlusten führen können, und bietet Handlungsanleitungen zur Vermeidung von Anlagefehlern.
- Kapitel 4: Warum kaufen PrivatanlegerInnen höchstspekulative Wertpapiere bzw. Lotterie-Aktien?: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Kauf von spekulativem Wertpapieren und Lotterie-Aktien durch PrivatanlegerInnen. Es untersucht die Gründe für dieses Verhalten und die Auswirkungen auf die Performance der Investments und gibt Handlungsanleitungen für ein rationales Anlageverhalten.
- Kapitel 5: Warum veräußern die PrivatanlegerInnen die Gewinneraktien vor den Verliereraktien?: Dieses Kapitel analysiert das Verhalten von PrivatanlegerInnen, die Gewinneraktien vor Verliereraktien verkaufen. Es untersucht die Ursachen für diesen Dispositionseffekt und die Auswirkungen auf die Performance der Investments und bietet Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Anlageverhaltens.
- Kapitel 6: Warum neigen die PrivatanlegerInnen oft zu sensationssuchendem Verhalten und zur Selbstüberschätzung?: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen für sensationssuchendes Verhalten und Selbstüberschätzung bei PrivatanlegerInnen und analysiert die Auswirkungen auf die Performance der Investments. Es bietet Handlungsanleitungen zur Vermeidung von Fehlentscheidungen, die aus diesen Verhaltensweisen resultieren.
- Kapitel 7: Was sind Gründe dafür, dass die PrivatanlegerInnen unterdiversifizierte Portfolios halten?: Dieses Kapitel behandelt das Thema der Diversifikation von Portfolios und analysiert die Gründe, warum PrivatanlegerInnen oft unterdiversifizierte Portfolios halten. Es untersucht die Auswirkungen dieses Verhaltens auf die Performance und bietet Handlungsanleitungen zur Optimierung der Portfoliostruktur.
- Kapitel 8: Warum nützen die PrivatanlegerInnen die technische Analyse?: Dieses Kapitel beleuchtet den Einsatz der technischen Analyse durch PrivatanlegerInnen und analysiert die Gründe für diese Vorgehensweise. Es untersucht die Auswirkungen der technischen Analyse auf die Performance der Investments und bietet Handlungsanleitungen für ein rationales Anlageverhalten.
- Kapitel 9: Warum bevorzugen PrivatanlegerInnen Wertpapiere aus dem eigenen Land?: Dieses Kapitel untersucht das Phänomen der Heimatbias bei PrivatanlegerInnen und analysiert die Ursachen für diese Präferenz. Es untersucht die Auswirkungen der Heimatbias auf die Performance der Investments und bietet Handlungsanleitungen zur Diversifizierung des Anlageportfolios.
- Kapitel 10: Wie wirken sich die Emotionen der PrivatanlegerInnen auf deren Investments und die Performance aus?: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Emotionen auf Anlageentscheidungen von PrivatanlegerInnen. Es analysiert die Auswirkungen von Emotionen auf die Performance der Investments und bietet Handlungsanleitungen zur Vermeidung von emotionalen Fehlentscheidungen.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit befasst sich mit den Themen Anlageverhalten, Privatanleger, Behavioral Finance, irrationale Anlageentscheidungen, Performance, Risiko, Herdenverhalten, Dispositionseffekt, Selbstüberschätzung, Diversifikation, Heimatbias, Emotionen und Handlungsanleitungen. Die Arbeit untersucht, warum PrivatanlegerInnen von den Prinzipien der traditionellen Ökonomik und der modernen Portfoliotheorie abweichen und welche Auswirkungen dies auf die Performance ihrer Investments hat.
Häufig gestellte Fragen
Welche kognitiven Fehler machen Privatanleger häufig?
Privatanleger unterliegen oft Fehlern wie Selbstüberschätzung (Overconfidence), Herdenverhalten, dem Dispositionseffekt oder der Heimatbias (Home Bias).
Was ist der Dispositionseffekt?
Dies ist die Tendenz, Aktien, die im Plus stehen, zu früh zu verkaufen (um Gewinne zu sichern), während Verlustaktien zu lange gehalten werden (in der Hoffnung auf Erholung).
Was bedeutet „Behavioral Finance“?
Behavioral Finance untersucht, wie psychologische Faktoren und Emotionen die Entscheidungen von Anlegern beeinflussen und warum diese oft vom rationalen Modell des „Homo Oeconomicus“ abweichen.
Warum halten viele Privatanleger unterdiversifizierte Portfolios?
Oft investieren Anleger nur in ihnen bekannte Unternehmen oder Branchen, was zu einem hohen Klumpenrisiko führt, anstatt das Risiko breit über verschiedene Anlageklassen zu streuen.
Wie wirken sich Emotionen auf die Investmentperformance aus?
Angst vor Verlusten oder die Gier nach schnellen Gewinnen führen oft zu fehlerhaftem Trading und emotionalen Fehlentscheidungen, was meist in einer negativen Performance resultiert.
- Quote paper
- Adis Hodzic (Author), 2020, Investmentperformance von PrivatanlegerInnen. Welche kognitiven Fehler werden begangen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/945345