Excerpt
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Probanden/Material und Methoden
2.1 Probanden
2.2 Studienablauf
2.3 Training zur Förderung exekutiver Funktionen
2.4 Analyse der Konzentrationsfähigkeit
2.5 Statistik
3 Ergebnisse
4 Diskussion und Schlussfolgerungen
Literaturverzeichnis
Anhang
Excerpt out of 35 pages
- Quote paper
- Anonymous, 2018, Training exekutiver Funktionen in kleinen und großen Sportspielen. Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/436272
Publish now - it's free
✕
Excerpt from
35
pages
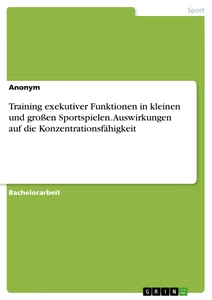
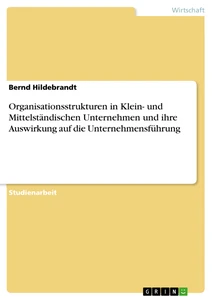
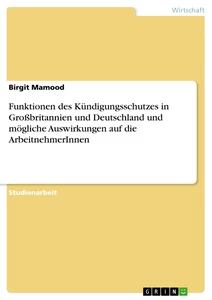
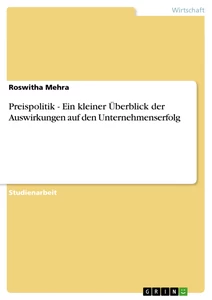
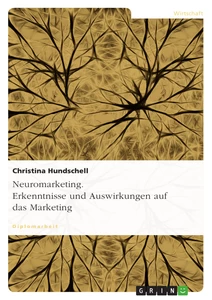

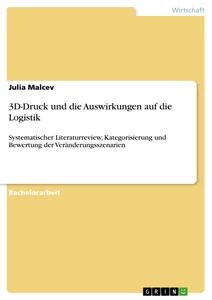
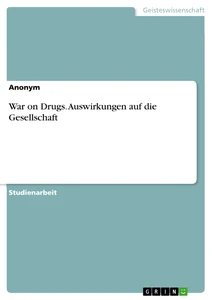
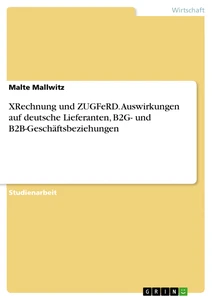
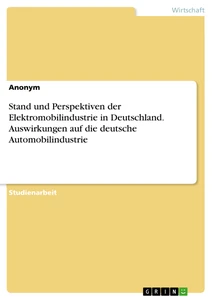
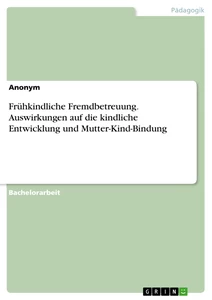

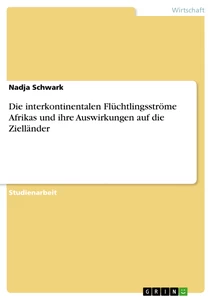
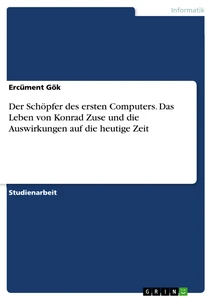
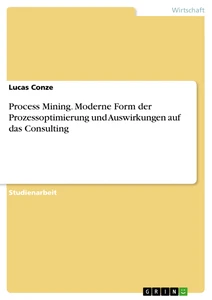
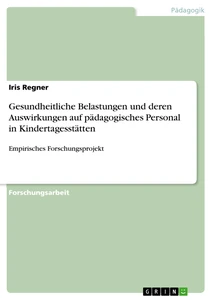
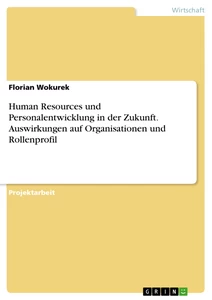
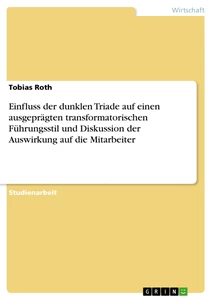

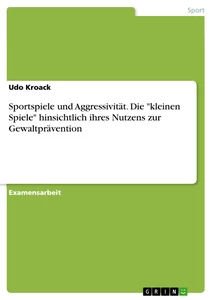
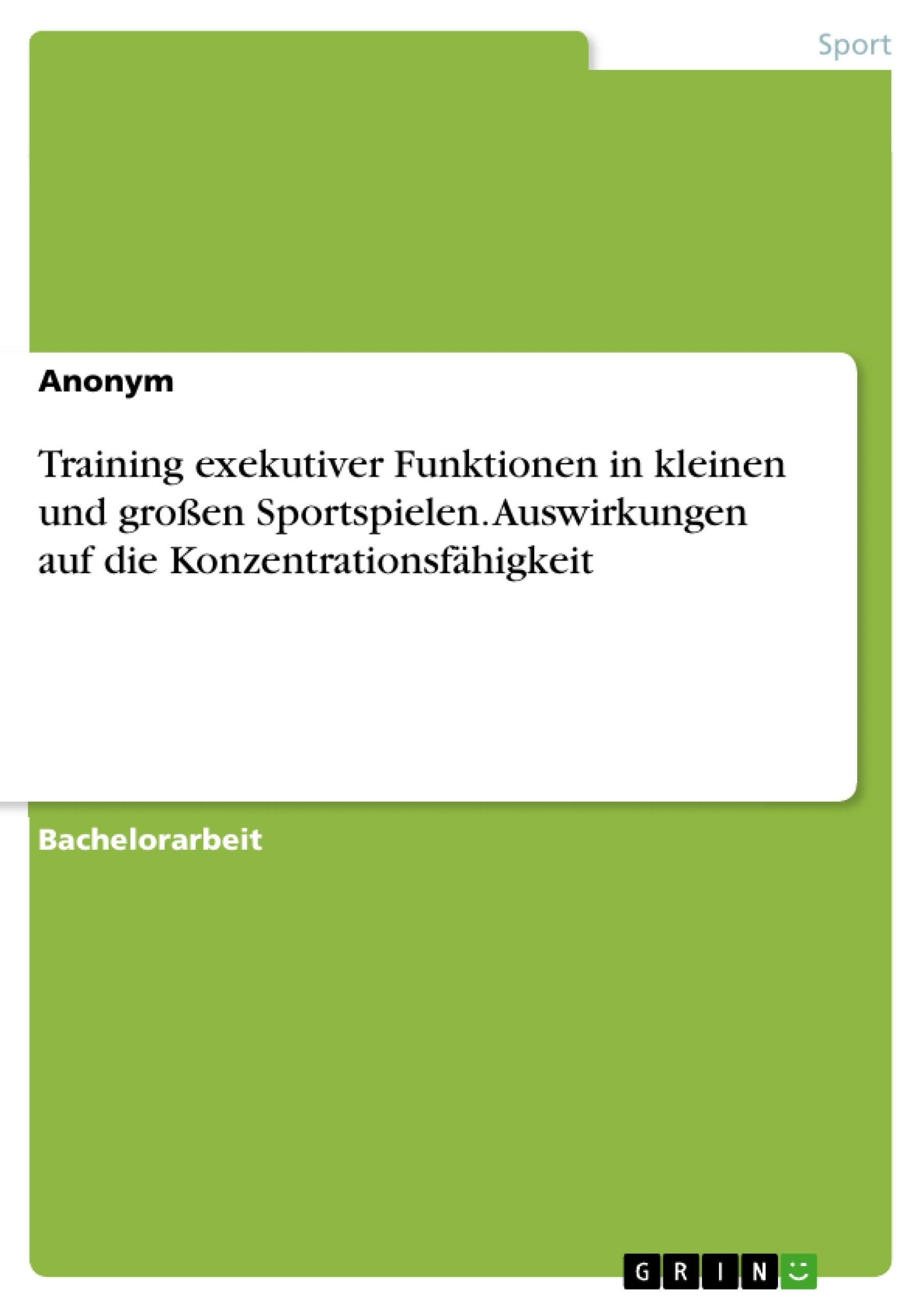

Comments